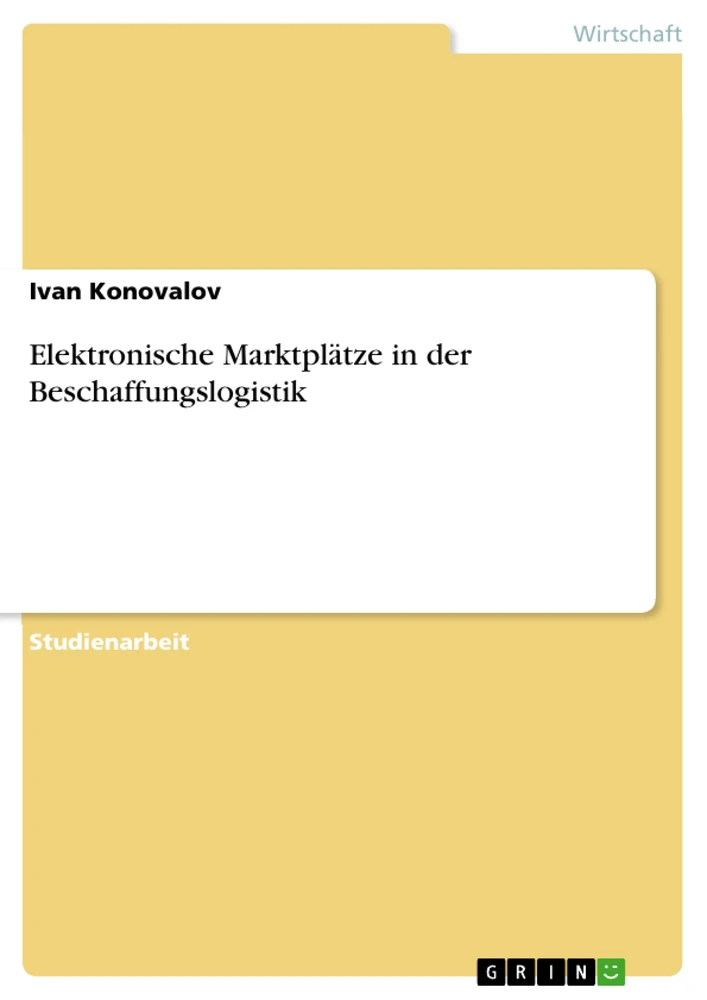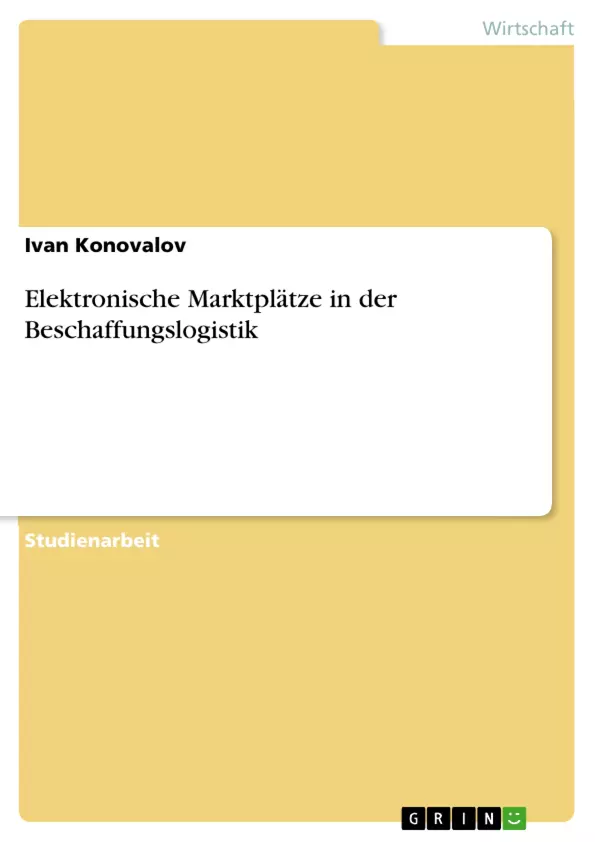In dieser Arbeit werden die elektronischen Marktplätze in der Beschaffungslogistik näher untersucht. Zuerst werden Begriffe definiert und Grundlagen über Strukturen und Merkmale der elektronischen Markplätze erläutert. Nachfolgend werden die Transaktionsprozesse und -modelle der Beschaffung über E-Märkte aufgefasst und die Motive der beteiligten Marktteilnehmer dargelegt. Abschließend folgen die Darstellung kritische Faktoren der Beschaffung über elektronische Märkte, sowie ein Ausblick über die Entwicklung und Akzeptanz in der Zukunft.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinitionen
- 3 Merkmale und Strukturen elektronischer Marktplätze
- 4 Beschaffung über elektronische Marktplätze
- 4.1 Transaktionsprozess
- 4.2 Transaktionsmodelle
- 4.3 Motive der Akteure
- 4.3.1 Anbieter
- 4.3.2 Betreibers
- 4.3.3 Nachfrager
- 5 Kritische Aspekte der Beschaffung über digitale Märkte
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von elektronischen Marktplätzen im Kontext der Beschaffungslogistik. Ziel ist es, die Funktionsweise, Strukturen und Prozesse dieser digitalen Plattformen zu analysieren und ihre Bedeutung für die Beschaffung in Unternehmen zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Begriffen im E-Business
- Merkmale und Strukturen elektronischer Marktplätze
- Transaktionsprozesse und -modelle der Beschaffung über E-Märkte
- Motive der Marktteilnehmer (Anbieter, Betreiber, Nachfrager)
- Kritische Aspekte der Beschaffung über elektronische Marktplätze
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologien für die Geschäftsprozesse und zeigt die Entwicklung der Beschaffung vom papierbasierten Prozess hin zum E-Procurement auf.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden grundlegende Begriffe des E-Business definiert, wie z.B. E-Business, Business, Consumer und Administration. Die Beziehungen zwischen diesen Akteuren werden anhand von Beispielen dargestellt.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel beleuchtet die Merkmale und Strukturen elektronischer Marktplätze. Es werden verschiedene Formen und Modelle des elektronischen Handels vorgestellt und die wichtigsten Akteure auf den digitalen Plattformen betrachtet.
- Kapitel 4: Die Beschaffung über elektronische Marktplätze wird im Detail untersucht. Hierbei werden der Transaktionsprozess, verschiedene Transaktionsmodelle und die Motive der beteiligten Marktteilnehmer analysiert.
Schlüsselwörter
Elektronische Marktplätze, Beschaffungslogistik, E-Procurement, Transaktionsmodelle, E-Business, Anbieter, Betreiber, Nachfrager, kritische Aspekte, digitale Märkte, Entwicklung, Akzeptanz.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter elektronischen Marktplätzen in der Logistik?
Es handelt sich um digitale Plattformen im E-Business, die Anbieter und Nachfrager zusammenbringen, um Transaktionsprozesse in der Beschaffung effizienter zu gestalten.
Was ist der Vorteil von E-Procurement gegenüber klassischen Prozessen?
E-Procurement ersetzt papierbasierte Abläufe durch digitale Prozesse, was zu Zeitersparnis, geringeren Prozesskosten und einer höheren Markttransparenz führt.
Welche Akteure sind an einem elektronischen Marktplatz beteiligt?
Die Hauptakteure sind die Anbieter (Lieferanten), die Nachfrager (Unternehmen) und die Betreiber der Plattform.
Welche Transaktionsmodelle werden unterschieden?
Die Arbeit untersucht verschiedene Modelle und Strukturen, die den Handel zwischen Business (B), Consumer (C) und Administration (A) regeln.
Gibt es kritische Aspekte bei der Nutzung digitaler Märkte?
Ja, die Arbeit thematisiert kritische Faktoren wie Datensicherheit, die Akzeptanz der Nutzer und die Integration in bestehende IT-Systeme.
- Citation du texte
- Ivan Konovalov (Auteur), 2014, Elektronische Marktplätze in der Beschaffungslogistik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373613