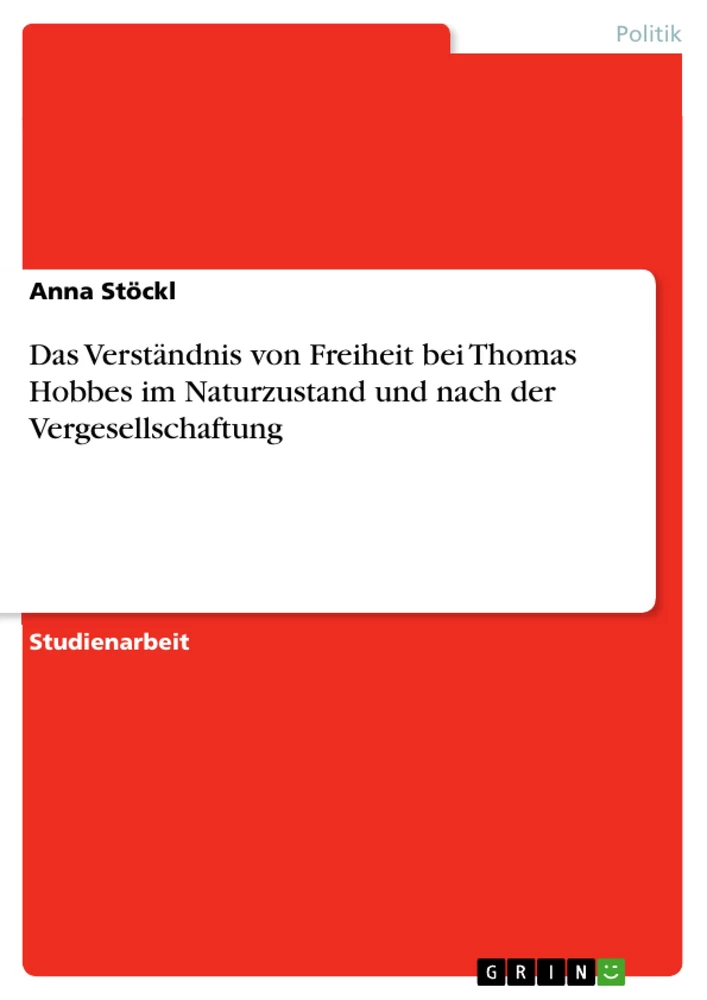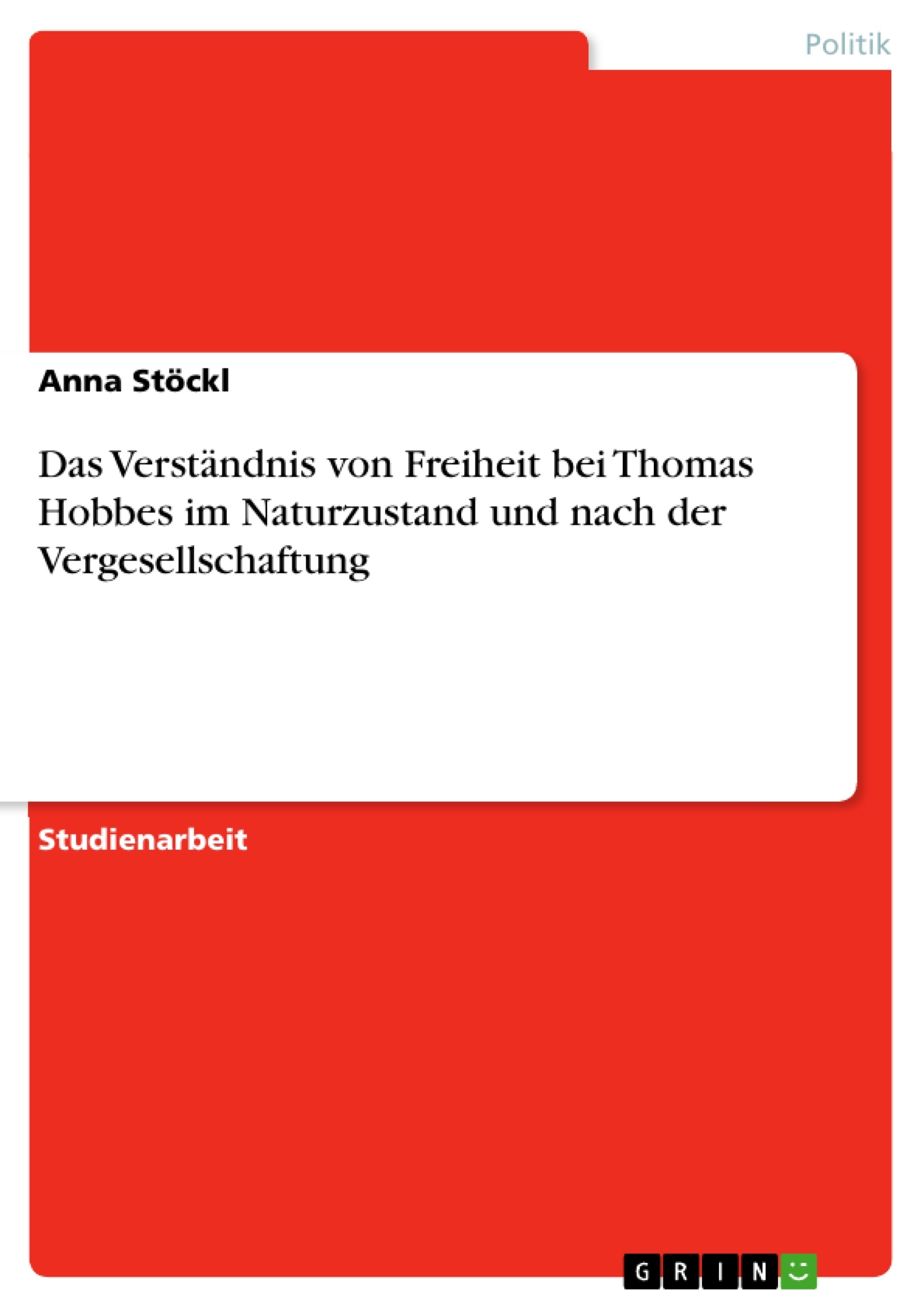Im Rahmen dieser Hausarbeit liegt der Fokus auf dem Verständnis von Freiheit bei Hobbes, jedoch losgelöst von den zeitgeschichtlichen Ereignissen zur damaligen Zeit. Die zu erarbeitende Forschungsfrage lautet: Inwieweit unterscheidet Hobbes die Freiheit der Menschen im Naturzustand von der Freiheit nach der Vergesellschaftung?
Mithilfe der Primärquelle „Leviathan“ wird im ersten, deskriptiven Teil ein Überblick über Thomas Hobbes und seine Staatstheorie, den „Leviathan“, geboten, die Freiheit im Naturzustand und die Freiheit nach der Vergesellschaftung dargestellt, um diese im zweiten Teil mit der Methode des Vergleichs gegenüberzustellen und Gemeinsamkeiten und Gegensätze zu erkennen. Nach der Analyse werden in der Auswertung die vergleichbaren Punkte zusammengefasst und im Fazit die These, dass die Freiheit im Naturzustand eine Ursache für die Errichtung des Leviathan und die Einschränkung der Freiheit nach der Vergesellschaftung ist, relativiert oder bestätigt. Am Ende dieser Hausarbeit werden Schlussfolgerungen gezogen und noch offen stehende Fragen, beziehungsweise ein Blick auf den heutigen Freiheitsbegriff, gegeben. Als Basis der Hausarbeit dient neben Hobbes Werk dem „Leviathan“ (1651), „De Cive“ (1642) als Unterstützung, sie zieht allerdings auch weitere Sekundärquellen hinzu. Der Fokus liegt grundsätzlich auf dem Verständnis von Freiheit.
Im heutigen Zeitalter der Postmoderne sind die Begriffe Freiheit und Sicherheit nicht mehr wegzudenken. Politische Programme, gesellschaftliche Gruppen und Massenmedien diskutieren über das Freiheit- und Sicherheitsmotiv der Menschen des Landes. Seit Jahrzehnten profitieren wir in der Bundesrepublik Deutschland von unseren Freiheitsrechten, wie der Freiheit des Einzelnen, der Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit etc. Doch wie sahen die Freiheiten der Menschen vor fast einem halben Jahrtausend aus?
Zur Zeit von Philosoph und Staatstheoretiker Thomas Hobbes, der 1588 geboren ist, waren die Menschen von Furcht, Bürgerkriegen, Unruhen, kolonialen Eroberungen und Religionskämpfen geprägt. In seiner autobiographischen Arbeit sagt Thomas Hobbes selbst, seine Mutter habe bei der Geburt auch seinen Zwilling zur Welt gebracht, nämlich die Furcht, und diese würde er im Leben nicht mehr loswerden (vgl. Engel 2010: 59f.).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leviathan
- Das Verständnis von Freiheit bei Hobbes
- Freiheit im Naturzustand
- Freiheit im gesellschaftlichen Zustand
- Vergleich
- Auswertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, das Verständnis von Freiheit bei Thomas Hobbes im Naturzustand und im gesellschaftlichen Zustand zu untersuchen. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, inwieweit Hobbes die Freiheit im Naturzustand von der Freiheit nach der Vergesellschaftung unterscheidet.
- Das Menschenbild von Thomas Hobbes
- Der Naturzustand und das Recht auf alles
- Die Entstehung des Leviathan und die Einschränkung der Freiheit
- Die Rolle der Vernunft und der Leidenschaften im Verständnis von Freiheit
- Die Bedeutung von Gerechtigkeit und Eigentum im Kontext der Vergesellschaftung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Freiheit und Sicherheit in der Postmoderne ein und stellt die historische und philosophische Relevanz des Themas heraus. Die Arbeit befasst sich mit Thomas Hobbes' Verständnis von Freiheit, insbesondere im Hinblick auf die Unterschiede zwischen dem Naturzustand und dem gesellschaftlichen Zustand. Die Forschungsfrage der Arbeit lautet: Inwieweit unterscheidet Hobbes die Freiheit der Menschen im Naturzustand von der Freiheit nach der Vergesellschaftung? Die Methode der Arbeit umfasst eine deskriptive Darstellung des Leviathan, die Freiheit im Naturzustand und im gesellschaftlichen Zustand sowie einen Vergleich beider, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Die Auswertung fasst die vergleichbaren Punkte zusammen und das Fazit relativiert oder bestätigt die These, dass die Freiheit im Naturzustand eine Ursache für die Errichtung des Leviathan und die Einschränkung der Freiheit nach der Vergesellschaftung ist.
2. Leviathan
Kapitel 2 bietet einen Überblick über Thomas Hobbes' Werk „Leviathan“, welches ein grundlegendes Werk der Politischen Theorie und Ideengeschichte ist. Hobbes vereint in seinem Werk Naturwissenschaft, Anthropologie, Politik und Religion und legitimiert seinen Prototypen des „Leviathan“. Hobbes' zwei bekannteste Argumente sind: im Naturzustand herrscht ein Krieg aller gegen aller und der Mensch sei dem Menschen ein Wolf. Der Leviathan ist in vier Teile gegliedert, die sich mit dem Menschen, dem Staat, dem christlichen Staat und dem Reich der Finsternis befassen. Die Arbeit konzentriert sich auf die ersten beiden Teile. Thomas Hobbes beginnt mit Definitionen und Erläuterungen über die Empfindung, die Sprache, Vernunft, Wissenschaft und das Denken. Hobbes sieht den Menschen als ein materialistisches, stets am Eigennutz orientiertes Lebewesen, das von Konkurrenzgedanken, Misstrauen und Furcht gegenüber Mitmenschen geleitet wird.
3.1. Freiheit im Naturzustand
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Freiheit der Individuen im Naturzustand. Hobbes setzt Freiheit mit Recht gleich und argumentiert, dass im Naturzustand jeder ein Recht auf alles hat. Dieser Zustand zeichnet sich durch fehlende Gerechtigkeit und Eigentum aus. Hobbes beschreibt die Gefahr, die im Naturzustand für den Einzelnen besteht, da es abhängig von Erfahrung und Charakter stärkere und schwächere Menschen gibt. Die Freiheit im Naturzustand ermöglicht zwar Selbstbewahrung, birgt aber gleichzeitig Gefahren durch andere. Das höchste Ziel der Menschheit wird als Glückseligkeit bezeichnet, die jedoch aufgrund der permanenten Bewegung des Lebens nicht erreicht werden kann. Für den Bürger liegt das höchste Gut im Zustand des Friedens.
3.2. Freiheit im gesellschaftlichen Zustand
Dieser Abschnitt behandelt die Freiheit nach der Vergesellschaftung. Hobbes argumentiert, dass die Einschränkung der Freiheit im gesellschaftlichen Zustand notwendig ist, um den Frieden zu sichern und die Selbstzerstörung der Menschheit zu verhindern. Der Leviathan fungiert als Garant für Sicherheit und Ordnung und schränkt die Freiheit des Einzelnen ein, um das gemeinsame Wohl zu gewährleisten. Die Freiheit im gesellschaftlichen Zustand ist daher eine relative Freiheit, die an die Einhaltung der Gesetze und Regeln gebunden ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Freiheit, Naturzustand, Gesellschaft, Leviathan, Thomas Hobbes, Recht, Gerechtigkeit, Eigentum, Vernunft, Leidenschaften, Krieg aller gegen aller, Selbsterhaltung, Sicherheit, Frieden.
- Quote paper
- Anna Stöckl (Author), 2016, Das Verständnis von Freiheit bei Thomas Hobbes im Naturzustand und nach der Vergesellschaftung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373678