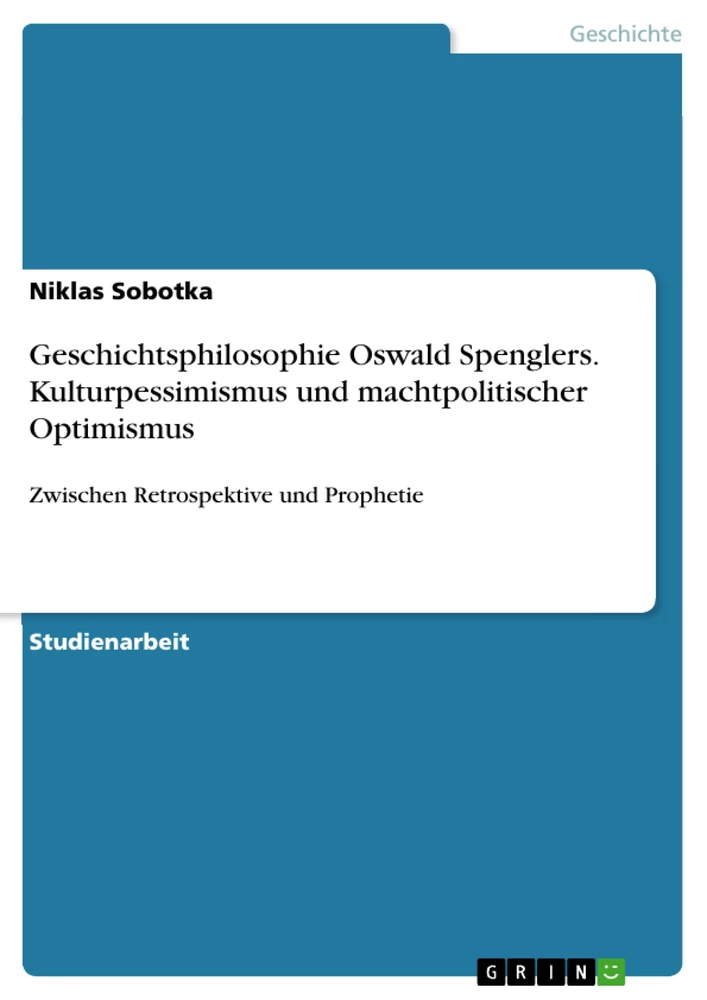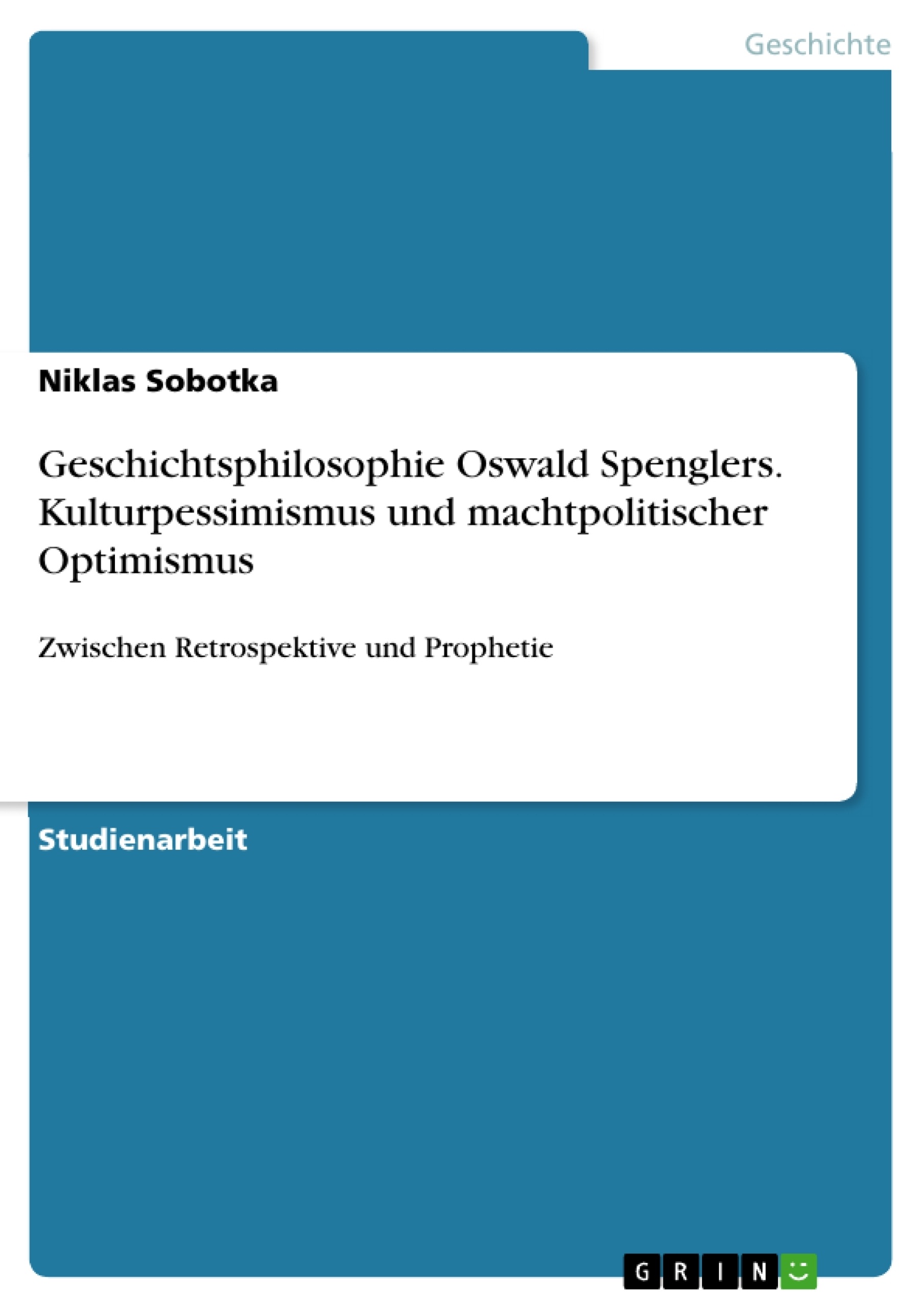Mit Oswald Spengler (1880-1936) verbindet sich ein in seiner Tragweite nicht zu unterschätzender Fatalismus, der nach dem ersten Weltkrieg, vornehmlich in den Jahren 1919 bis 1924, in den gebildeten Schichten der Weimarer Republik eine breite Aufmerksamkeit erfuhr. Der "Untergang des Abendlandes", Spenglers großangelegte Untersuchung zur westlichen Kultur, war ein Bestseller, verfasst mit wissenschaftlichem Anspruch und darauf bedacht einen Entwicklungsgang nachzuzeichnen, der in seinen paralytischen Momenten nicht mehr zu stoppen sei. Dabei verstand man Spengler als einen düsteren Unheilspropheten, der er nach eigenem Ermessen weder war noch sein wollte. So war er, neben anderen bedeutenden Stichwortgebern, Repräsentant der „Konservativen Revolution“, einer Vereinigung rechtskonservativer Intellektueller, die konservatives Gedankengut mit revolutionärem Pathos zu vereinigen strebten und dabei den Nährboden für den Nationalsozialismus abgaben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Person Oswald Spenglers. Prägungen eines Geschichtsphilosophen
- Biographischer Werdegang
- Spengler und die „Konservative Revolution”
- Zu Spenglers „heroischem Nihilismus”
- Einiges zur Geschichte pessimistischer Weltdeutungen
- Zeit- und kulturkritische Aspekte bei Spengler
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit Oswald Spenglers Geschichtsphilosophie und seinem Kulturpessimismus. Sie analysiert die Prägungen und Schlüsselerlebnisse, die seinen intellektuellen Lebensweg bestimmten, sowie seine Teilnahme an der „Konservativen Revolution“. Die Arbeit untersucht Spenglers Geschichtsphilosophie im Kontext seiner pessimistischen Weltdeutung und seinem machtpolitischen Optimismus, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeiten Deutschlands.
- Oswald Spenglers Biographie und seine intellektuellen Prägungen
- Spenglers „heroischer Nihilismus” und seine pessimistische Weltdeutung
- Die „Konservative Revolution” und ihre Bedeutung für Spenglers Denken
- Spenglers Geschichtsphilosophie und sein kulturpessimistischer Impetus
- Spenglers machtpolitischer Optimismus und seine Einschätzung Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Oswald Spengler und sein Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“ vor. Sie beleuchtet Spenglers Anspruch, Geschichte vorauszubestimmen, und seine Methode, die Geschichte vergangener Kulturen mit der Gegenwart zu vergleichen. Spenglers Fokus liegt auf der Antike als einer Kultur, die den von ihm ausgemachten Lebenszyklus bereits vollendet hat.
1. Zur Person Oswald Spenglers. Prägungen eines Geschichtsphilosophen
Dieses Kapitel widmet sich Spenglers Biografie und seinen Prägungen. Es beleuchtet seinen Werdegang, seine Schlüsselerlebnisse und seine Teilnahme an der „Konservativen Revolution“.
1.1 Biographischer Werdegang
Dieser Abschnitt beleuchtet Spenglers Lebensweg, seine Ausbildung und seine frühen Einflüsse.
1.2 Spengler und die „Konservative Revolution”
Dieser Abschnitt untersucht Spenglers Rolle in der „Konservativen Revolution“ und die Auswirkungen dieser Bewegung auf sein Denken.
2. Zu Spenglers „heroischem Nihilismus”
Dieses Kapitel analysiert Spenglers Geschichtsphilosophie und seinen „heroischen Nihilismus”. Es beleuchtet die Geschichte pessimistischer Weltdeutungen und die kulturkritischen Aspekte in Spenglers Werk.
2.1 Einiges zur Geschichte pessimistischer Weltdeutungen
Dieser Abschnitt beleuchtet die Tradition pessimistischer Geschichtsphilosophie und die verschiedenen Perspektiven auf den Verlauf der Geschichte.
2.2 Zeit- und kulturkritische Aspekte bei Spengler
Dieser Abschnitt untersucht Spenglers Zeit- und Kulturkritik sowie seine Sicht auf den Verfall der westlichen Kultur.
Schlüsselwörter
Oswald Spengler, Geschichtsphilosophie, Kulturpessimismus, „heroischer Nihilismus”, „Der Untergang des Abendlandes”, „Konservative Revolution”, Zeitgeschichte, Kulturkritik, Machtpolitik, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema von Oswald Spenglers Hauptwerk?
In "Der Untergang des Abendlandes" zeichnet Spengler einen deterministischen Entwicklungsgang westlicher Kultur nach, den er als unaufhaltsamen Verfall beschreibt.
Was bedeutet Spenglers "heroischer Nihilismus"?
Es beschreibt eine Haltung, die trotz der pessimistischen Weltsicht und der Annahme eines unvermeidlichen Untergangs zu machtpolitischem Handeln und Optimismus aufruft.
Welche Rolle spielte Spengler in der "Konservativen Revolution"?
Er war ein bedeutender Vordenker dieser Bewegung, die konservative Werte mit revolutionärem Pathos verband und den Nährboden für spätere politische Entwicklungen bereitete.
Warum verglich Spengler die Gegenwart mit der Antike?
Er sah in der Antike eine Kultur, die ihren Lebenszyklus bereits vollendet hatte, und nutzte sie als Modell, um die Zukunft des Abendlandes vorauszubestimmen.
Wie wurde Spengler in der Weimarer Republik wahrgenommen?
Er galt als Bestsellerautor und düsterer Unheilsprophet, dessen Thesen besonders in den gebildeten Schichten zwischen 1919 und 1924 große Aufmerksamkeit fanden.
- Citation du texte
- Niklas Sobotka (Auteur), 2015, Geschichtsphilosophie Oswald Spenglers. Kulturpessimismus und machtpolitischer Optimismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373741