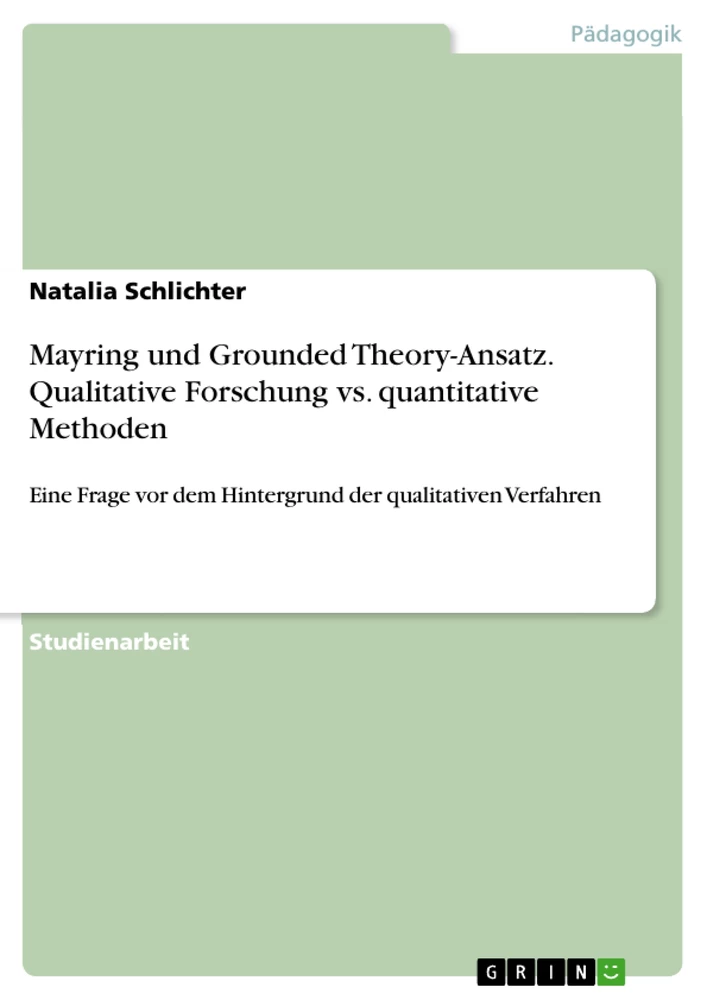In den Sozialwissenschaften, so wie Erziehungswissenschaft, werden vorzugsweise quantitative Methoden bei der Datenerhebung und Auswertung verwendet. Denken wir z.B. an einen Fall aus dem pädagogischen Bereich, wenn eine neu entwickelte Unterrichtmethode auf die Probe gestellt und mit der traditionellen Lehrmethode verglichen wird. Nach der Implementationsphase der neuen Methode in Schulen will man sich, als Mitentwickler der Methode, Rückmeldung über diese verschaffen. Damit allerdings die Ergebnisse ernster aussähen, entwickelt man ein standardisiertes Instrument, z.B. einen standardisierten Fragebogen, mit dem LehrerInnen, SchülerInnen und andere an dem Schul- und Unterrichtsgeschehen beteiligten Personen nach ihrer Meinung bezüglich der Neuerung befragt werden. Mit Hilfe der quantitativen Auswertungsmethoden kommt man zu einem Ergebnis, das aussagekräftig ist und das man nun präsentieren kann.
So ein oder ein ähnlicher Fall, selbstverständlich nicht so vereinfacht, wie in dem oben beschriebenen Beispiel, stellt den Forschungsalltag in den Erziehungswissenschaften dar. Dies lässt den einen oder anderen sich die Frage stellen: „Wo bleiben denn die LehrerInnen und SchülerInnen mit dem, was sie diesbezüglich sagen würden, wenn sie nicht nur Kreuzchen in einem Fragebogen machen sollten, sondern auch Möglichkeit bekämen, ihre individuellen, wenn auch nicht standardisierten Meinungen zu äußern? Besteht die Möglichkeit, die Beteiligten zu befragen, ohne dass ihre Meinung durch die Fragen eines Tests manipuliert oder zumindest in eine gewünschte Richtung gelenkt wird? Und wenn ja, kann dann trotzdem von einem gesicherten Ergebnis gesprochen werden?“
Diese kritische Frage wollen wir mit dieser Arbeit ansatzweise beantworten, wobei natürlich eine Schlussfolgerung im Sinne, eine Forschungsmethode ist besser als die andere, nicht angestrebt wird. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Die qualitativen im Vergleich zu den quantitativen Methoden
- Das zentrale Unterscheidungsmerkmal
- Geschichtlicher Hintergrund der Inhaltsanalyse
- Ziel der qualitativen Methoden
- Interview - Königsweg der qualitativen Datenerhebung
- Das Leitfaden-Interview
- Das Erzählgenerierende Interview
- Qualitative Auswertungsmethoden am Beispiel der Inhaltsanalyse
- Allgemeine Schritte einer qualitativen Auswertung
- Inhaltsanalyse nach Mayring
- Grounded Theory-Ansatz
- Gütekriterien von qualitativen Methoden
- Gütekriterien qualitativer Datenerhebung
- Gütekriterien qualitativer Datenanalysen
- Qualitative vs. quantitative Methoden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden in den Sozialwissenschaften, insbesondere in der Erziehungswissenschaft. Ziel ist es, die qualitative Forschung, speziell die Inhaltsanalyse und den Grounded Theory-Ansatz, vorzustellen und ihre Vorzüge im Gegensatz zu quantitativen Ansätzen herauszuarbeiten. Eine Wertung im Sinne einer Überlegenheit der einen Methode gegenüber der anderen ist nicht beabsichtigt.
- Vergleich qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden
- Vorstellung der Inhaltsanalyse nach Mayring
- Beschreibung des Grounded Theory-Ansatzes
- Gütekriterien qualitativer Forschung
- Das Interview als zentrale Methode der qualitativen Datenerhebung
Zusammenfassung der Kapitel
Die qualitativen im Vergleich zu den quantitativen Methoden: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und vergleicht die Grundprinzipien qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden in den Sozialwissenschaften. Es wird der Unterschied zwischen der Suche nach Gesetzmäßigkeiten (quantitativ) und dem Verstehen einzelner Ereignisse (qualitativ) herausgestellt. Das Interview wird als zentrales Instrument der qualitativen Datenerhebung vorgestellt, im Gegensatz zum standardisierten Fragebogen der quantitativen Forschung. Der geschichtliche Hintergrund der Inhaltsanalyse wird beleuchtet, ihre Anfänge in quantitativen Verfahren und die spätere Entwicklung hin zu einem interpretativen Ansatz werden beschrieben. Schließlich wird das Ziel qualitativer Methoden, insbesondere der Inhaltsanalyse, als systematische Bearbeitung von Kommunikationsmaterial definiert, mit Fokus auf der Erfassung sowohl manifester als auch latenter Sinngehalte.
Interview - Königsweg der qualitativen Datenerhebung: Dieses Kapitel widmet sich dem Interview als Kernmethode der qualitativen Datenerhebung. Es betont die scheinbare Einfachheit des Interviews, gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit, bestimmte Regeln für ein professionelles Interview zu beachten, um valide Ergebnisse zu erhalten. Es werden verschiedene Interviewformen wie Tandem-, Paar- und Gruppeninterviews erwähnt und die Bedeutung des Interviews für den Zugang zu Weltsichten, Erfahrungen und Kontexten der Befragten hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Gewährung des Wortes an die Befragten und der Vermeidung von Manipulation durch vorgegebene Kategorien.
Qualitative Auswertungsmethoden am Beispiel der Inhaltsanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Schritte der qualitativen Datenanalyse und konzentriert sich auf zwei zentrale Methoden: die Inhaltsanalyse nach Mayring und den Grounded Theory-Ansatz. Es werden die jeweiligen Vorgehensweisen, Stärken und Grenzen beider Ansätze erläutert. Das Kapitel betont die Bedeutung der systematischen Auswertung von Kommunikationsmaterial und die Möglichkeit, sowohl manifeste als auch latente Sinngehalte zu analysieren.
Gütekriterien von qualitativen Methoden: Das Kapitel befasst sich mit den Gütekriterien qualitativer Methoden, die sich von den quantitativen Gütekriterien unterscheiden. Es werden die Kriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität im Kontext der qualitativen Datenerhebung und -analyse diskutiert. Es wird zwischen interner und externer Validität differenziert und die spezifischen Herausforderungen bei der Beurteilung der Güte qualitativer Forschung erläutert.
Schlüsselwörter
Qualitative Forschung, quantitative Forschung, Inhaltsanalyse, Grounded Theory, Interview, Datenerhebung, Datenanalyse, Gütekriterien, Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft, Interpretatives Paradigma.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Qualitative vs. Quantitative Forschungsmethoden in den Sozialwissenschaften
Was ist der zentrale Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über qualitative und quantitative Forschungsmethoden in den Sozialwissenschaften, mit besonderem Fokus auf die qualitative Forschung, insbesondere die Inhaltsanalyse und den Grounded Theory-Ansatz. Es vergleicht beide Methoden, beschreibt die Durchführung und Auswertung qualitativer Daten (vor allem mittels Interviews und Inhaltsanalyse) und beleuchtet die Gütekriterien qualitativer Forschung. Eine Bewertung der Überlegenheit einer Methode gegenüber der anderen wird vermieden.
Welche Methoden werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt ausführlich das Leitfaden- und das erzählgenerierende Interview als zentrale Methoden der qualitativen Datenerhebung. Im Bereich der Datenanalyse werden die Inhaltsanalyse nach Mayring und der Grounded Theory-Ansatz im Detail erklärt und verglichen. Quantitative Methoden werden hauptsächlich im Vergleich zu den qualitativen Methoden betrachtet.
Wie werden qualitative und quantitative Methoden verglichen?
Der Vergleich zwischen qualitativen und quantitativen Methoden konzentriert sich auf die grundlegenden Prinzipien. Qualitative Methoden zielen auf das Verstehen einzelner Ereignisse und das Erfassen von Sinnzusammenhängen ab, während quantitative Methoden auf die Suche nach Gesetzmäßigkeiten und die Messung von Variablen ausgerichtet sind. Die jeweiligen Vor- und Nachteile werden im Kontext der Sozialwissenschaften und der Erziehungswissenschaft diskutiert.
Was sind die wichtigsten Schritte der qualitativen Datenanalyse?
Die qualitativen Datenanalyse-Schritte werden am Beispiel der Inhaltsanalyse nach Mayring und des Grounded Theory-Ansatzes illustriert. Beide Ansätze werden hinsichtlich ihrer Vorgehensweise, Stärken und Schwächen erläutert. Die systematische Auswertung von Kommunikationsmaterial und die Analyse manifester sowie latenter Sinngehalte stehen im Mittelpunkt.
Welche Gütekriterien werden für qualitative Methoden diskutiert?
Das Dokument behandelt die Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität im Kontext qualitativer Forschung. Es wird zwischen interner und externer Validität differenziert und die spezifischen Herausforderungen bei der Beurteilung der Güte qualitativer Forschung im Vergleich zu quantitativer Forschung erläutert. Die Kriterien unterscheiden sich von denen quantitativer Methoden.
Welche Rolle spielt das Interview in der qualitativen Forschung?
Das Interview wird als Königsweg der qualitativen Datenerhebung dargestellt. Es werden verschiedene Interviewformen (z.B. Leitfadeninterview, erzählgenerierendes Interview) erwähnt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Interviews für den Zugang zu Weltsichten, Erfahrungen und Kontexten der Befragten und auf der Vermeidung von Manipulation durch vorgegebene Kategorien.
Was sind die Schlüsselwörter des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Qualitative Forschung, quantitative Forschung, Inhaltsanalyse, Grounded Theory, Interview, Datenerhebung, Datenanalyse, Gütekriterien, Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft, Interpretatives Paradigma.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Studierende und Wissenschaftler*innen in den Sozialwissenschaften und der Erziehungswissenschaft, die sich mit Forschungsmethoden auseinandersetzen. Es eignet sich auch für Personen, die ein grundlegendes Verständnis von qualitativen und quantitativen Forschungsansätzen gewinnen möchten.
- Arbeit zitieren
- Natalia Schlichter (Autor:in), 2003, Mayring und Grounded Theory-Ansatz. Qualitative Forschung vs. quantitative Methoden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37385