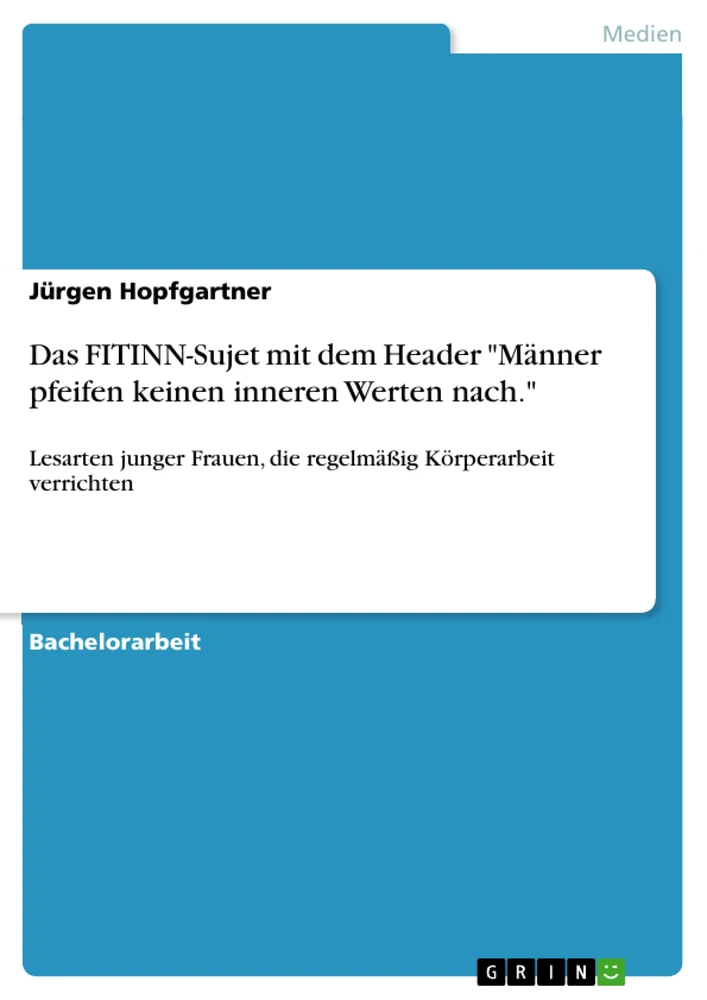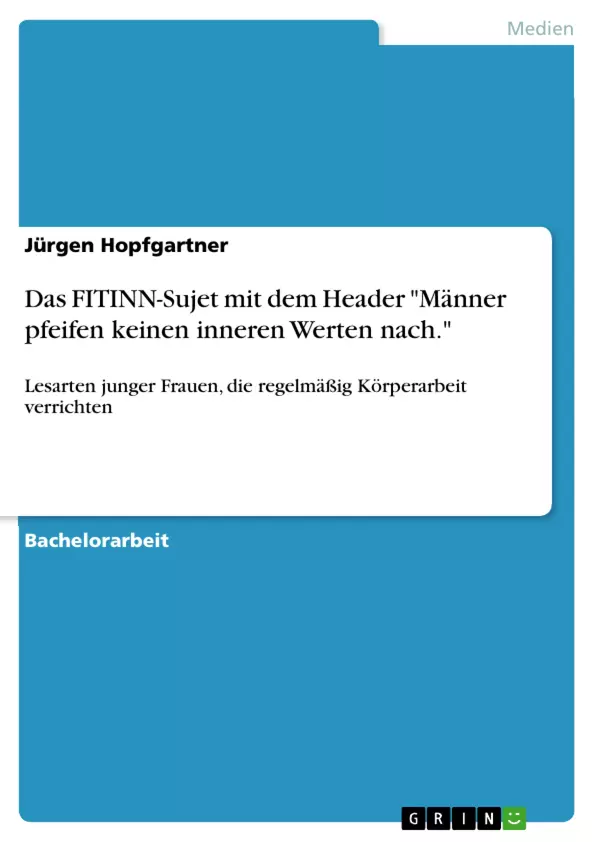Die basale theoretische Prämisse dieser Arbeit ist deutlich vom Symbolischen Interaktionismus (SI) inspiriert, lautet sie doch: Einer medialen Aussage eignet keine objektive Bedeutung. Es ist notwendig, von dieser These auszugehen, da es müßig wäre, eine empirische Fahndung nach Lesarten besagten Sujets einzuschalten, stünde seine Bedeutung a priori fest.
Uwe Flick (2002) qualifiziert den SI als wissenschaftliche Tradition, worin eine qualitative Methodologie steht, die darauf ausgelegt ist, subjektiven Sinn zu entdecken. Ein solcher Ansatz erhebt „die unterschiedlichen Weisen [..] in denen Subjekte Gegenstände, Ereignisse, Erfahrungen etc. mit Bedeutung versehen“ zum Pivot empirischer Sozialforschung. Daher ist geboten, dass auch das methodische Vorgehen zu den Lesarten des Sujets symbolisch-interaktionistischen Charakter trägt.
Weiteres Geleit nimmt das methodische Vorgehen dieser Arbeit von einer spezifischen Auffassung von Theorie, desgleichen ihrer Relation zur Empirie: Im Sinne der Grounded Theory à la Glaser/Strauss erscheinen Theorien mitnichten als Abbilder von Weltausschnitten, sondern vielmehr als Vorverständnisse von Untersuchungsgegenständen, die mit Daten aus dem Feld auseinandergesetzt und dadurch überholt werden sollen (vgl. ebd., S. 72f.). Dementsprechend liefert der erste Abschnitt des Hauptteils dieser Arbeit (Kap. 2) theoretische Kategorien, die im zweiten Abschnitt (Kap. 3) mit Selbstauskünften aus Interviews nicht veri- oder falsifiziert, sondern mit subjektivem Sinn konkretisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Sensibilisierung
- 2.1 Werbung
- 2.1.1 Begriff
- 2.1.2 Intention
- 2.1.3 Botschaft
- 2.1.3.1 Moderne Werbung vs. Postmoderne Werbung
- 2.1.3.2 Mythos und Vorzugsbedeutung
- 2.2 Identität
- 2.2.1 Konzepte
- 2.2.1.1 Postmodernes Subjekt
- 2.2.1.2 Subjekt der Aufklärung
- 2.2.1.3 Soziologisches Subjekt
- 2.2.2 Identitätsrelevanz des Körpers
- 2.2.2.1 Körperbild als Selbstbild
- 2.2.2.2 Körperbiographie als Selbstbiographie
- 2.3 Medienaneignung
- 2.3.1 Begriff
- 2.3.2 Rezeption als Reproduktion
- 2.3.3 Rezeption als Produktion
- 2.3.4 Rezeption als Lektüre
- 3 Empirische Studie
- 3.1 Datenerhebung
- 3.1.1 Experteninterview
- 3.1.2 Problemzentrierte Interviews
- 3.2 Datenaufbereitung
- 3.3 Datenauswertung
- 3.4 Dateninterpretation
- 3.4.1 Vorzugsbedeutung des FITINN-Werbesujets mit dem Header „Männer pfeifen keinen inneren Werten nach“
- 3.4.2 Der Interviewpartnerinnen Lesarten des FITINN-Werbesujets mit dem Header „Männer pfeifen keinen inneren Werten nach“
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Lesarten eines spezifischen FITINN-Werbesujets bei jungen Frauen, die regelmäßig Körperarbeit verrichten. Ziel ist es, die subjektiven Bedeutungszuschreibungen zu analysieren und zu verstehen, wie das Werbesujet mit dem provokanten Header „Männer pfeifen keinen inneren Werten nach“ von dieser Zielgruppe rezipiert und interpretiert wird. Die Arbeit greift dabei auf qualitative Methoden zurück.
- Rezeption und Interpretation von Werbung
- Identitätskonstruktion und Körperbild junger Frauen
- Medienaneignung und -produktion
- Symbolischer Interaktionismus als theoretischer Rahmen
- Qualitative Forschungsmethoden (Experteninterviews, problemzentrierte Interviews)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Forschungsfrage ein: Wie lesen junge Frauen, die regelmäßig Körperarbeit verrichten, das FITINN-Werbesujet mit dem provokanten Header? Sie skizziert den theoretischen Hintergrund, der vom Symbolischen Interaktionismus geprägt ist, und betont die Bedeutung subjektiver Bedeutungszuschreibungen. Das FITINN-Werbesujet selbst wird vorgestellt und die Forschungsfrage im Kontext der Medienwirkungsforschung verortet, wobei der Fokus auf den interpretativen Prozessen liegt, die der Wirkung vorausgehen.
2 Theoretische Sensibilisierung: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen für die empirische Untersuchung. Es werden Konzepte von Werbung, Identität (insbesondere im postmoderne Kontext), und Medienaneignung umfassend diskutiert. Die verschiedenen theoretischen Ansätze, wie der Symbolische Interaktionismus, werden erläutert und ihre Relevanz für die Untersuchung der Lesarten des Werbesujets herausgearbeitet. Die Kapitel erläutert verschiedene Konzepte von Identität, um ein Verständnis für die Relevanz des Körperbildes für die Selbstwahrnehmung zu schaffen. Es wird auf die unterschiedlichen Konzepte des Subjekts eingegangen (postmodernes, aufklärerisches, soziologisches Subjekt).
3 Empirische Studie: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es wird detailliert auf die Datenerhebung (Experteninterview und problemzentrierte Interviews) sowie die Datenaufbereitung und -auswertung eingegangen. Die Interpretation der Daten fokussiert auf die Lesarten des Werbesujets und analysiert, wie die befragten Frauen den provokanten Slogan und das Gesamtbild des Sujets verstehen und in ihren Kontext einordnen. Die Ergebnisse beleuchten die verschiedenen Interpretationsmuster und die Bedeutung des Werbesujets im Kontext der Körperarbeit und des Selbstverständnisses der Interviewpartnerinnen.
Schlüsselwörter
FITINN, Werbung, Körperarbeit, junge Frauen, Lesarten, Medienrezeption, Symbolischer Interaktionismus, Identität, Selbstbild, Qualitative Forschung, problemzentrierte Interviews, Experteninterview, Medienaneignung, Postmoderne.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Lesarten eines FITINN-Werbesujets bei jungen Frauen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die subjektive Interpretation (Lesarten) eines spezifischen FITINN-Werbesujets mit dem provokanten Slogan „Männer pfeifen keinen inneren Werten nach“ bei jungen Frauen, die regelmäßig Körperarbeit verrichten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Bedeutungszuschreibungen und der Rezeption dieses Werbesujets durch die Zielgruppe.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet qualitative Forschungsmethoden, konkret Experteninterviews und problemzentrierte Interviews. Diese Methoden ermöglichen eine detaillierte Erforschung der subjektiven Perspektiven und Interpretationsmuster der befragten Frauen.
Welche theoretischen Konzepte werden behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf den Symbolischen Interaktionismus und behandelt Konzepte aus den Bereichen Werbung, Identität (insbesondere im postmodernen Kontext), Medienaneignung und Körperbild. Es werden verschiedene Konzepte des Subjekts (postmodernes, aufklärerisches, soziologisches Subjekt) diskutiert, um die Relevanz des Körperbildes für die Selbstwahrnehmung zu beleuchten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, die die Forschungsfrage und den theoretischen Hintergrund beschreibt; ein Kapitel zur theoretischen Sensibilisierung mit den Konzepten von Werbung, Identität und Medienaneignung; ein Kapitel zur empirischen Studie mit Methodik, Datenanalyse und Interpretation; und schließlich ein Fazit.
Wie werden die Daten interpretiert?
Die Dateninterpretation konzentriert sich auf die verschiedenen Lesarten des Werbesujets und analysiert, wie die befragten Frauen den provokanten Slogan und das Gesamtbild des Sujets verstehen und in ihren Kontext einordnen. Es werden die Interpretationsmuster und die Bedeutung des Werbesujets im Kontext der Körperarbeit und des Selbstverständnisses der Interviewpartnerinnen beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: FITINN, Werbung, Körperarbeit, junge Frauen, Lesarten, Medienrezeption, Symbolischer Interaktionismus, Identität, Selbstbild, Qualitative Forschung, problemzentrierte Interviews, Experteninterview, Medienaneignung, Postmoderne.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, zu verstehen, wie das ausgewählte FITINN-Werbesujet von jungen Frauen, die regelmäßig Körperarbeit verrichten, rezipiert und interpretiert wird, und welche subjektiven Bedeutungszuschreibungen damit verbunden sind.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Studie beleuchten die verschiedenen Interpretationsmuster der befragten Frauen bezüglich des FITINN-Werbesujets und dessen Bedeutung im Kontext ihrer Körperarbeit und ihres Selbstverständnisses. Die detaillierten Ergebnisse sind im Kapitel "Empirische Studie" beschrieben.
- Arbeit zitieren
- Jürgen Hopfgartner (Autor:in), 2015, Das FITINN-Sujet mit dem Header "Männer pfeifen keinen inneren Werten nach.", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373933