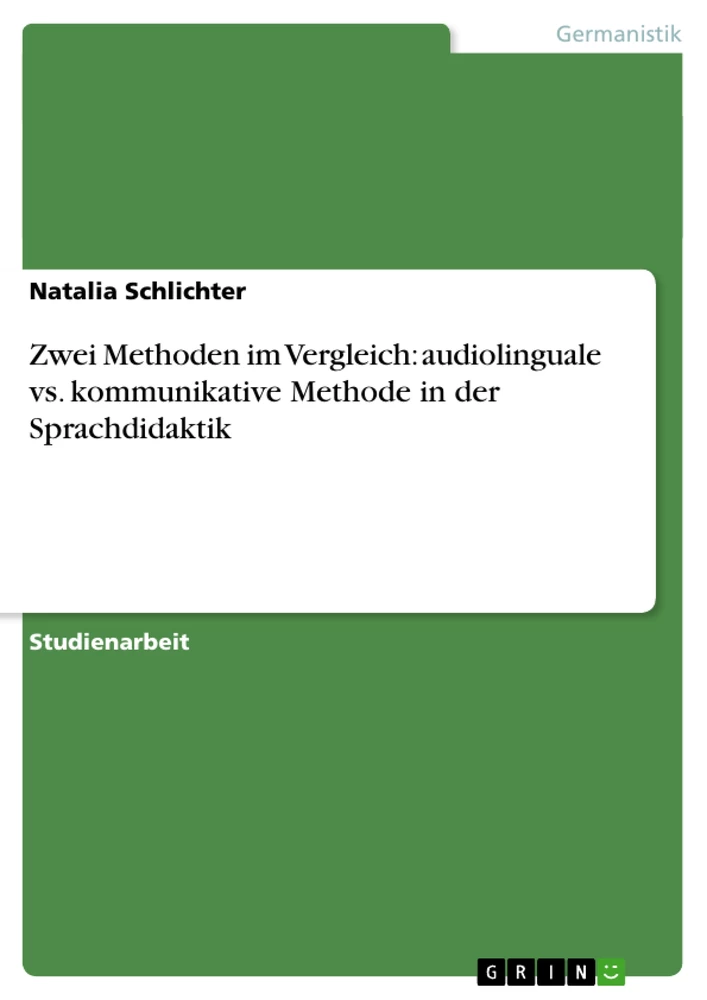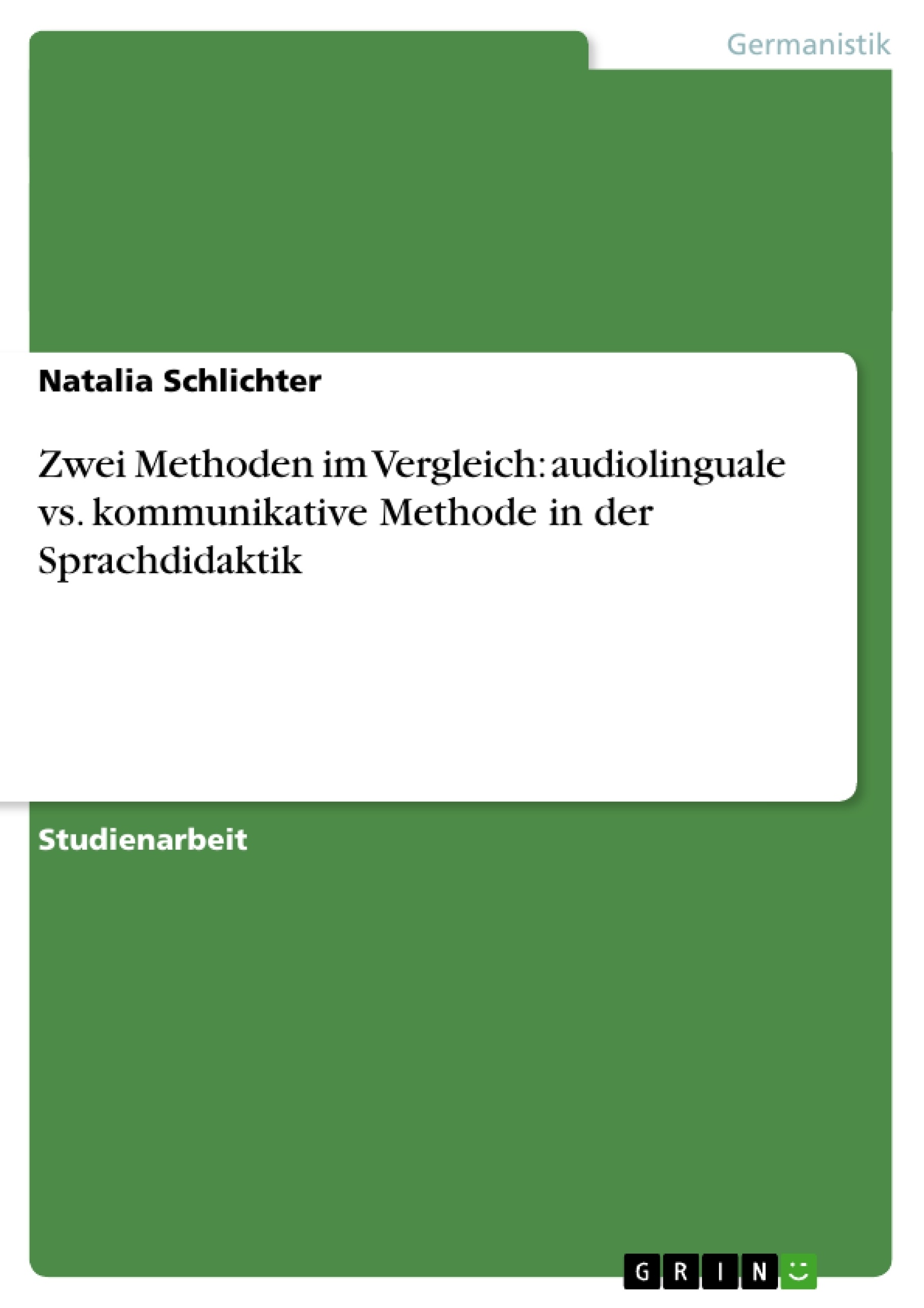1. Methodik
1.1. Der Begriff „Methode/Methodik“
1.2. Merkmale einer Methode
1.3. Mehrere „Wege zum Ziel“
2. Analyse der audio-lingualen Methode
2.1. Gesellschaftliche Hintergründe
2.2. Zielsetzung des Sprachunterrichts
2.3. Prinzipien des Lernens
2.4. Unterrichtsorganisation
2.5. Unterrichtsformen
2.6. Medien, Unterrichtsmaterialien
3. Analyse der kommunikativen Methode
3.1. Gesellschaftliche Hintergründe
3.2. Zielsetzung des Sprachunterrichts
3.3. Prinzipien des Lernens
3.4. Unterrichtsorganisation
3.5. Unterrichtsformen
3.6. Medien, Unterrichtsmaterialien
4. Fremdsprachliche Methode als zeitgemäßes Ereignis
Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Methodik
- Der Begriff „Methode/Methodik“
- Merkmale einer Methode
- Mehrere „Wege zum Ziel“
- Analyse der audio-lingualen Methode
- Gesellschaftliche Hintergründe
- Zielsetzung des Sprachunterrichts
- Prinzipien des Lernens
- Unterrichtsorganisation
- Unterrichtsformen
- Medien, Unterrichtsmaterialien
- Analyse der kommunikativen Methode
- Gesellschaftliche Hintergründe
- Zielsetzung des Sprachunterrichts
- Prinzipien des Lernens
- Unterrichtsorganisation
- Unterrichtsformen
- Medien, Unterrichtsmaterialien
- Fremdsprachliche Methode als zeitgemäßes Ereignis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert und vergleicht die audio-linguale und kommunikative Methode im Fach Deutsch als Fremdsprache. Sie untersucht die geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergründe beider Methoden, die jeweiligen Zielsetzungen des Sprachunterrichts und die Prinzipien des Lernens, die sie zugrunde legen.
- Die Entstehung und Entwicklung der audio-lingualen und kommunikativen Methode
- Die jeweiligen theoretischen Grundlagen und wissenschaftlichen Einflüsse
- Die didaktischen Prinzipien und Unterrichtsorganisationen
- Die jeweiligen Stärken und Schwächen der Methoden
- Die Relevanz der Methoden für den heutigen Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff „Methode/Methodik“ und erläutert verschiedene Definitionen sowie die Bedeutung des Begriffs in der Fachdiskussion. Außerdem werden wichtige Merkmale einer Methode vorgestellt, darunter gesellschaftliche Hintergründe, Zielsetzung des Sprachunterrichts und Prinzipien des Lernens. Das zweite Kapitel analysiert die audio-linguale Methode und beleuchtet die geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergründe, die Zielsetzung des Sprachunterrichts sowie die zugrundeliegenden lernpsychologischen Prinzipien. Das dritte Kapitel befasst sich mit der kommunikativen Methode und untersucht deren Entstehung, Zielsetzung und Prinzipien des Lernens.
Schlüsselwörter
Audio-linguale Methode, Kommunikative Methode, Methodik, Didaktik, Fremdsprachenunterricht, Lernpsychologie, Behaviorismus, Strukturalismus, Zielsetzung, Unterrichtsorganisation, Unterrichtsformen, Medien, Unterrichtsmaterialien, Gesellschaftliche Hintergründe
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet die audio-linguale von der kommunikativen Methode?
Die audio-linguale Methode basiert auf Nachahmung und Gewohnheitsbildung (Behaviorismus), während die kommunikative Methode die Interaktion und Handlungsfähigkeit in realen Situationen betont.
Welche Rolle spielt der Behaviorismus in der Sprachdidaktik?
Der Behaviorismus ist das Fundament der audio-lingualen Methode, bei der Lernen als Reiz-Reaktions-Schema verstanden wird, oft durch ständiges Wiederholen (Drills).
Was ist das Hauptziel der kommunikativen Methode?
Das Ziel ist die „kommunikative Kompetenz“, also die Fähigkeit, sich in der Fremdsprache situationsangemessen und verständlich auszudrücken.
Welche Medien werden in der audio-lingualen Methode bevorzugt?
Typisch ist der Einsatz von Sprachlaboren, Tonbändern und strukturierten Übungsmaterialien zur Einübung korrekter Satzmuster.
Warum sind die gesellschaftlichen Hintergründe für Methoden wichtig?
Methoden entstehen oft als Antwort auf gesellschaftliche Bedürfnisse, wie z.B. die schnelle Sprachausbildung von Soldaten (audio-lingual) oder die Förderung des internationalen Austauschs (kommunikativ).
Welche Methode ist heute zeitgemäßer?
Heutzutage dominiert die kommunikative Methode, wobei oft eklektische Ansätze genutzt werden, die erfolgreiche Elemente verschiedener Methoden kombinieren.
- Quote paper
- Natalia Schlichter (Author), 2002, Zwei Methoden im Vergleich: audiolinguale vs. kommunikative Methode in der Sprachdidaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37397