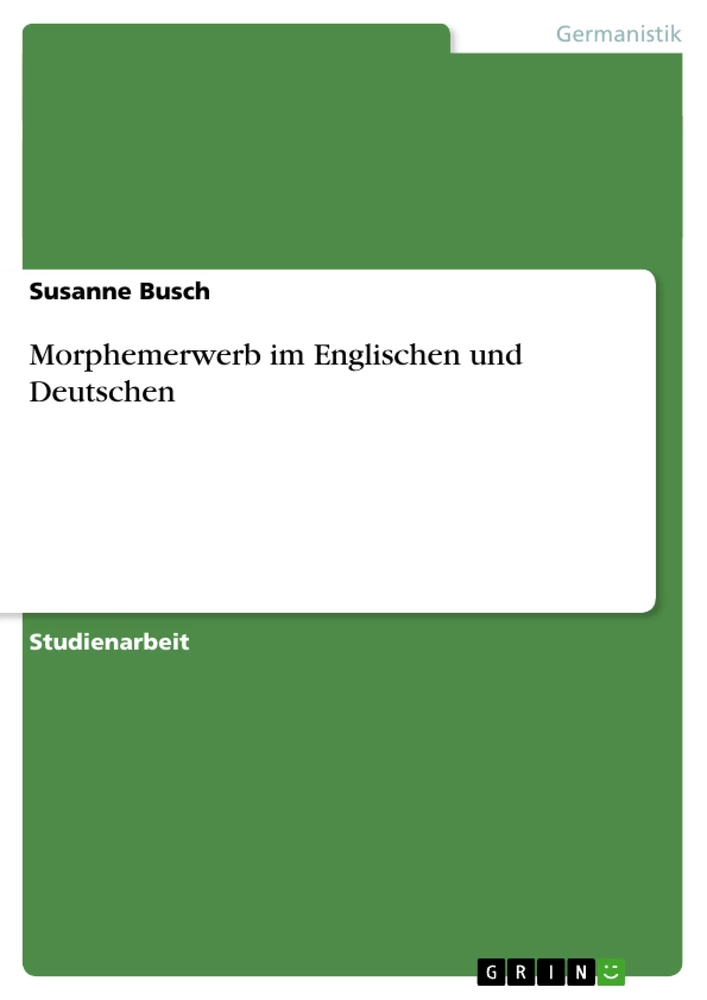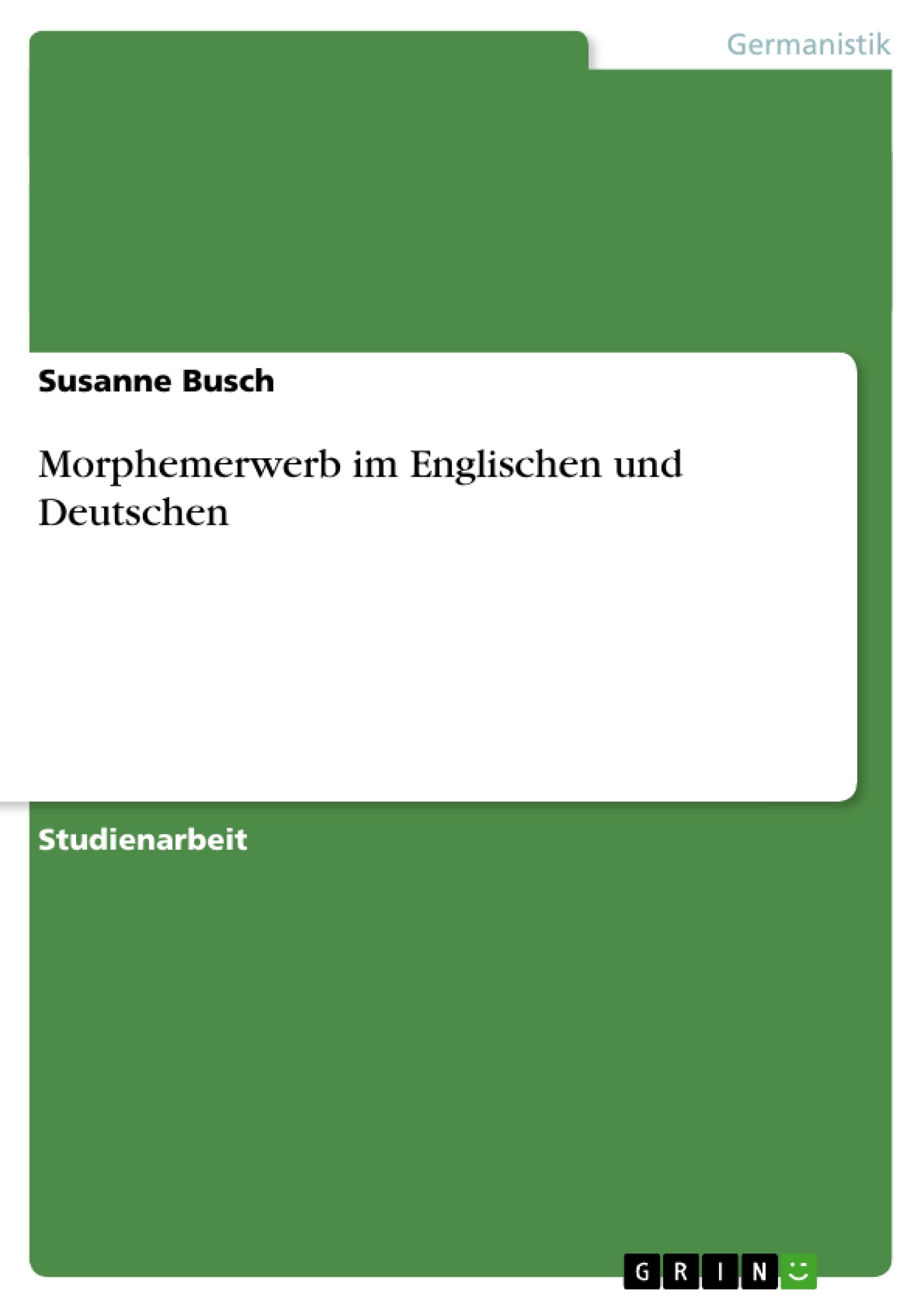Einführung
Wie lernen Kinder Grammatik? Verschiedene Gruppen von Linguisten vertreten bei dieser Frage jeweils unterschiedliche Theorien. Während die Nativisten bei Kindern von einer angeborenen sprachlichen Struktur, einer Universalgrammatik, ausgehen, sind die Behavioristen überzeugt, dass das Kind grammatische Strukturen von Anfang an selbst und nur mit Hilfe der sprachlichen Äußerungen, die es hört, aufbaut und das menschliche Gehirn sich sozusagen von einer Tabula rasa zu einem ausschließlich durch Erfahrungen geprägten Organ entwickelt. Kognitivisten wiederum glauben, dass dem Sprachenlernen nichts anderes als allgemeine Lernmechanismen zugrunde liegen, die das Kind auch für andere Bereiche des Lebens benutzt, also wenn es zum Beispiel Zahlen oder soziale Konventionen lernt. Es wird davon ausgegangen, dass kognitive Entwicklung eine Grundvoraussetzung des Sprachenlernens ist.
Der Interaktionismus stellt das Lernen der Srache als einen wechselseitigen Prozess dar, bei dem Interaktion im Mittelpunkt steht. Diese Theorie sagt jedoch weniger über das eigentliche Erlernen von grammatischen Strukturen aus. In dieser Arbeit soll es um den Grammatikerwerb und zwar im Speziellen um den Morphemerwerb bei deutschsprachigen und englischsprachigen Kindern gehen. Es soll untersucht werden, ob der Morphemerwerb dieser beiden Sprachen überhaupt vergleichbar ist, ob Ähnlichkeiten beim Erwerb zu erkennen sind und mit welcher Art Probleme deutsch- bzw. englischsprachige Kinder eventuell konfroniert werden. Auf den ersten Blick erscheinen die beiden Sprachen ähnlich. Tatsächlich sind Englisch und Deutsch sprachgeschichtlich eng miteinander verbunden. Beides sind westgermanische Sprachen.
Vielleicht kann am Ende der Arbeit eine Aussage darüber getroffen werden, inwieweit so etwas wie eine Universalgrammatik vorhanden ist. Als Schwerpunkte werden neben den morphologischen Besonderheiten der beiden Sprachen die Erwerbsreihenfolge und die Entwicklungsraten beim Morphemerwerb beschrieben. Meine Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die Untersuchungen von Roger Brown (1973) und Anne E. Mills (1985). Brown beobachtete drei Kinder längsschnittlich und veröffentlichte seine Ergebnisse in der für die englische Sprache bisher meistzitierten Studie A First Language (1973. Anne E. Mills stützt ihre Aussagen über den Spracherwerb des Deutschen auf verschiedene Ta gebuchstudien (Preyer, 1882; Lindner, 1898; Schädel, 1905;...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Ein kurzer Überblick: Grammatische Morpheme im Englischen und Deutschen
- 2.1. Verbmorphologie
- 2.2. Nominalmorphologie
- 2.3. Adjektivmorphologie
- 2.4. Präpositionen
- 2.5. Zusammenfassung
- 3. Der Morphemerwerb des Englischen
- 3.1. Erwerbsreihenfolge nach Brown (1973)
- 3.2. Einflussfaktoren auf den Morphemerwerb
- 3.2.1. Gesetz der kumulativen Häufigkeit
- 3.2.2. Häufigkeit
- 3.2.3. Stufen beim Erwerb von unregelmäßigen Formen
- 3.3. Zusammenfassung
- 4. Der Morphemerwerb des Deutschen
- 4.1. Im Vergleich mit dem Englischen
- 4.2. Besonderheiten bei der Entwicklung der Morphologie im Deutschen
- 4.2.4. Frühes Stadium
- 4.2.5. Drei und mehr Wörter (bis 4;0)
- 4.2.6. Spätere Entwicklung (4;0 und älter)
- 5. Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Morphemerwerb bei deutsch- und englischsprachigen Kindern. Es wird erforscht, ob der Morphemerwerb in beiden Sprachen vergleichbar ist, welche Ähnlichkeiten im Erwerb erkennbar sind und welche Schwierigkeiten deutsch- bzw. englischsprachige Kinder möglicherweise begegnen. Die Arbeit konzentriert sich auf die morphologischen Besonderheiten der beiden Sprachen, die Erwerbsreihenfolge und die Entwicklungsraten beim Morphemerwerb.
- Vergleich des Morphemerwerbs im Englischen und Deutschen
- Identifizierung von Ähnlichkeiten und Unterschieden im Erwerbsverlauf
- Analyse der Einflussfaktoren auf den Morphemerwerb
- Beschreibung der Entwicklungsraten und typischen Schwierigkeiten im Morphemerwerb
- Diskussion der Rolle der Universalgrammatik im Kontext des Morphemerwerbs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt verschiedene Theorien zum Grammatikerwerb vor, darunter den Nativismus, den Behaviorismus, den Kognitivismus und den Interaktionismus. Anschließend wird die Zielsetzung der Arbeit erläutert, die den Morphemerwerb bei deutsch- und englischsprachigen Kindern untersucht. Das zweite Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die grammatischen Morpheme im Englischen und Deutschen, wobei die Verb-, Nominal- und Adjektivmorphologie sowie Präpositionen betrachtet werden. Kapitel drei konzentriert sich auf den Morphemerwerb des Englischen, wobei die Erwerbsreihenfolge nach Brown (1973) und die Einflussfaktoren auf den Morphemerwerb, wie das Gesetz der kumulativen Häufigkeit, die Häufigkeit und die Stufen beim Erwerb von unregelmäßigen Formen, analysiert werden. Das vierte Kapitel widmet sich dem Morphemerwerb des Deutschen im Vergleich zum Englischen und behandelt die Besonderheiten bei der Entwicklung der Morphologie im Deutschen.
Schlüsselwörter
Morphemerwerb, Grammatikerwerb, Sprachentwicklung, Englisch, Deutsch, Universalgrammatik, Erwerbsreihenfolge, Einflussfaktoren, Häufigkeit, unregelmäßige Formen, morphologische Besonderheiten.
Häufig gestellte Fragen
Wie lernen Kinder grammatische Morpheme?
Es gibt verschiedene Theorien: Nativisten glauben an eine angeborene Universalgrammatik, Behavioristen an Lernen durch Erfahrung (Tabula rasa) und Kognitivisten an allgemeine Lernmechanismen.
Gibt es Unterschiede beim Morphemerwerb zwischen Deutsch und Englisch?
Ja, obwohl beide westgermanische Sprachen sind, unterscheidet sich die Komplexität der Verb-, Nominal- und Adjektivmorphologie, was zu unterschiedlichen Entwicklungsraten führt.
Was ist die Erwerbsreihenfolge nach Roger Brown?
Roger Brown (1973) stellte in seiner Längsschnittstudie fest, dass Kinder grammatische Morpheme im Englischen in einer relativ festen, vorhersagbaren Reihenfolge erwerben.
Was besagt das Gesetz der kumulativen Häufigkeit?
Es beschreibt den Einfluss der Häufigkeit, mit der ein Kind bestimmte sprachliche Strukturen hört, auf die Geschwindigkeit des Erwerbs dieser Morpheme.
Wie erwerben Kinder unregelmäßige Formen?
Der Erwerb verläuft oft in Stufen: Zuerst werden unregelmäßige Formen korrekt nachgeahmt, dann folgt eine Phase der Übergeneralisierung von Regeln (z.B. "gehte" statt "ging"), bevor die korrekte Form gefestigt wird.
- Quote paper
- Susanne Busch (Author), 2004, Morphemerwerb im Englischen und Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37402