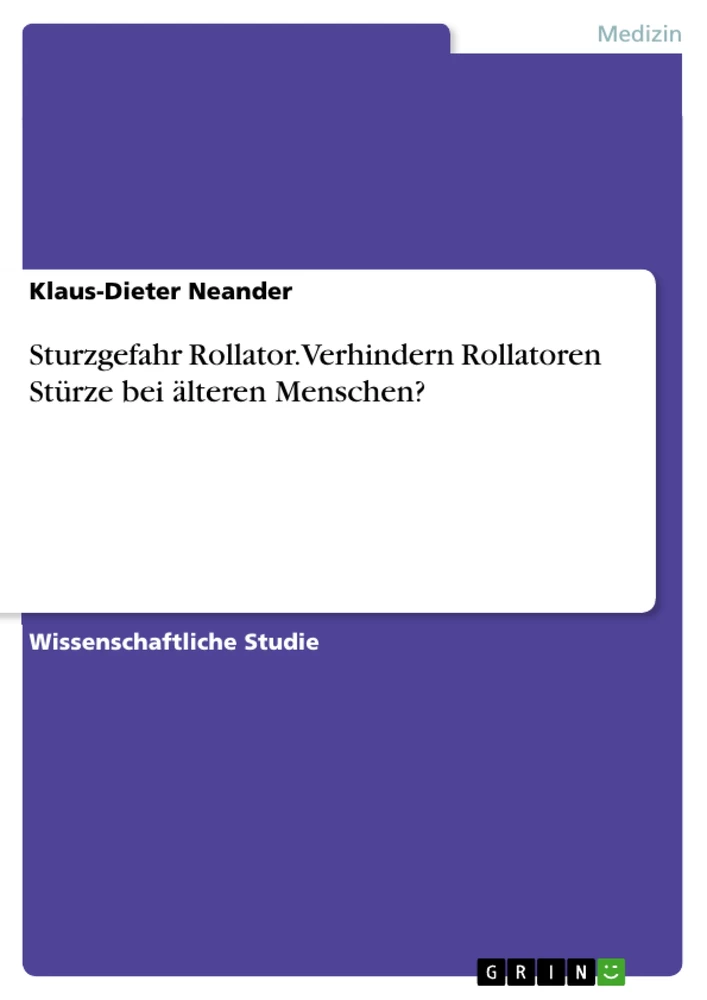Die Studie beschäftigt sich mit der Fragestellung, inwieweit Rollatoren tatsächlich Stürze von Senior_innen verhindern helfen bzw. welche Fatkoren dazu beitragen, dass Nutzer_innen eines Rollators gleichwohl stürzen. Die Studie gibt auch Hinweise auf die Sturzfolgen.
Der Sturzprophylaxe wird in der Pflege ein hoher Stellenwert eingeräumt, weil bekannt ist, dass ältere Menschen – wie sie vorwiegend in Senioreneinrichtungen und in der ambulanten Pflege betreut werden – vermehrt stürzen. Um solche Stürze zu vermindern bzw. die Sturzfolgen zu reduzieren, werden Rollatoren verordnet, weil sich die Personen daran festhalten und abstützen können. Zudem ermöglichen die Rollatoren einen leichteren Transport z.B. der eingekauften Waren, weil sie sämtlich mit einem kleinen Korb ausgerüstet sind und die zwischen den Haltegriffen montierte Sitzgelegenheit die Möglichkeit gibt, sich zwischendurch hinsetzen und ausruhen zu können. Die beschriebenen Vorteile greifen allerdings längst nicht bei allen Nutzer/innen: in der ambulanten Versorgung stürzen Senior/innen immer wieder mit den Rollatoren und sie ziehen sich dabei mehr oder weniger schwere Verletzungen zu. Es war daher Ziel dieser Arbeit, zu untersuchen, wie viele Personen trotz Nutzung eines Rollators stürzen, herauszufinden, ob die gestürzten Personen sich im Vergleich zu den Personen, die nicht stürzten, unterscheiden und schließlich zu dokumentieren, welche Verletzungen sich die gestürzten Personen zuzogen.
Es wurden 168 Personen untersucht: 95 Personen nutzten den Rollator ohne damit zu stürzen, 73 Personen stürzten trotz Rollatornutzung. Zwei Beobachtungsbögen, die die aus der Literatur bekannten für das Sturzrisiko signifikanten Faktoren erfassten, dienten als systematisches Erhebungsinstrument. Die Erhebungsbögen wurden im Rahmen einer Hausarbeit an der Carl Remigius Medical School entwickelt; mit ihnen konnten alle Personen in folgenden Details untersucht werden: Demenz, Inkontinenz, Chair-Rise-Test, Kraftmessung, Sehfähigkeit, Sturzvorgeschichte, Angst und Substanzklassen der Priscus-Liste.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Hinführung zum Thema
- 2 Aktueller Forschungsstand
- 2.1 hinsichtlich Sturzpathogenese
- 2.2 hinsichtlich gesundheitsökonomischer Bedeutung
- 3 Fragestellung
- 4 Methode
- 4.1 Der Erfassungsbogen A
- 4.1.1 Alter, BMI & Geschlecht
- 4.1.2 Demenzdiagnostik
- 4.1.3 Inkontinenzprofile
- 4.1.4 Chair-Rise-Test
- 4.1.5 Kraftmessung
- 4.1.6 Seheinschränkungen
- 4.1.7 Sturzvorgeschichte
- 4.1.8 Angst
- 4.1.9 Substanzklassen der Priscus-Liste
- 4.2 Der Erfassungsbogen B
- 4.2.1 Sturzort und Zeitpunkt des Sturzes
- 4.2.2 Sturzsituation
- 4.2.3 Sturzlokalisation
- 4.2.4 Ausmaß der Verletzungen
- 4.2.5 Sehfähigkeit
- 4.2.6 Technischer Zustand der Rollatoren
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Das untersuchte Patientenkollektiv
- 5.1.1 Alter, BMI & Geschlecht
- 5.1.2 Demenzdiagnostik
- 5.1.3 Inkontinenzprofile
- 5.1.4 Chair-Rise-Test
- 5.1.5 Kraftmessung
- 5.1.6 Seheinschränkungen
- 5.1.7 Sturzvorgeschichte
- 5.1.8 Angst
- 5.1.9 Substanzklassen der Priscus-Liste
- 5.2 Ergebnisse zum Sturzgeschehen (Erhebungsbogen B)
- 5.2.1 Sturzorte und Zeitpunkt des Sturzes
- 5.2.2 Sturzsituation
- 5.2.3 Sturzlokalisation
- 5.2.4 Ausmaß der Verletzungen
- 5.2.5 Sehfähigkeit
- 5.2.6 Technischer Zustand der Rollatoren
- 6 Diskussion
- 6.1 Limitation der Studie
- 6.2 Bewertung der Ergebnisse
- 6.2.1 Sturzgeschehen
- 6.2.2 Unterschiede zwischen den Gruppen
- 7 Fazit und Ausblick
- 7.1 Zukünftige Forschung
- 7.2 Fazit für die Pflegepraxis
- 7.3 Fazit für die Gesundheitspolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Sturzhäufigkeit bei älteren Menschen trotz Rollatornutzung. Es soll geklärt werden, ob sich die Sturz- und Nicht-Sturzgruppe in relevanten Parametern unterscheiden und welche Verletzungen bei Stürzen auftreten.
- Sturzhäufigkeit bei Rollatornutzern
- Vergleichende Analyse von Sturz- und Nicht-Sturzgruppe hinsichtlich verschiedener Risikofaktoren
- Art und Schweregrad der Sturzverletzungen
- Zusammenhang zwischen Rollatorzustand und Sturzereignissen
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für Pflegepraxis und Gesundheitspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Hinführung zum Thema: Dieses Kapitel dient der Einleitung und Kontextualisierung des Themas Sturzprophylaxe bei älteren Menschen unter Berücksichtigung der Rolle von Rollatoren. Es wird die Problematik von Stürzen im Alter und die Bedeutung von Sturzprävention hervorgehoben, insbesondere im Kontext von Senioreneinrichtungen und ambulanter Pflege. Die steigende Anzahl von Stürzen und die damit verbundenen gesundheitlichen und sozioökonomischen Folgen werden diskutiert, um die Relevanz der Forschungsfrage zu untermauern.
2 Aktueller Forschungsstand: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur Sturzpathogenese und den gesundheitsökonomischen Aspekten von Stürzen im Alter. Es werden relevante Studien und Erkenntnisse aus der Literatur präsentiert, die den Kontext für die eigene Untersuchung liefern. Der Fokus liegt dabei auf den bereits bekannten Risikofaktoren für Stürze und den Möglichkeiten der Prävention. Die Zusammenfassung der bisherigen Forschung dient als Grundlage für die Formulierung der Forschungsfrage und der Methodik.
3 Fragestellung: In diesem Kapitel wird die zentrale Forschungsfrage präzise formuliert: Wie viele Personen stürzen trotz Rollatornutzung, wie unterscheiden sich Sturz- und Nicht-Sturzgruppe und welche Verletzungen treten auf? Die Forschungsfrage wird detailliert erläutert und in den Kontext der vorherigen Kapitel eingeordnet. Die Kapitel dient als logische Brücke zwischen dem theoretischen Hintergrund und der methodischen Vorgehensweise der Studie.
4 Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Studie, einschließlich der Auswahl der Teilnehmer, der verwendeten Erhebungsinstrumente (Erfassungsbögen A und B) und des statistischen Vorgehens. Die detaillierte Beschreibung der Erhebungsinstrumente und der Datenerhebung selbst ist wichtig, um die Transparenz und die Reproduzierbarkeit der Studie zu gewährleisten. Die verwendeten Messinstrumente und deren Validität werden erläutert.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie, getrennt nach den Ergebnissen aus Erhebungsbogen A (demografische Daten und Risikofaktoren) und Erhebungsbogen B (Sturzgeschehen und Verletzungen). Die Ergebnisse werden sowohl deskriptiv als auch inferenzstatistisch dargestellt, einschließlich der statistischen Signifikanz der gefundenen Unterschiede zwischen den Gruppen. Diagramme und Tabellen visualisieren die Daten und erleichtern das Verständnis der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Sturzprophylaxe, Rollatoren, ältere Menschen, Sturzrisiko, Risikofaktoren, Sturzprävention, Handkraft, Sehfähigkeit, Demenz, Inkontinenz, Verletzungen, Gesundheitsökonomie, Pflegepraxis, Gesundheitspolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Sturzhäufigkeit bei älteren Menschen trotz Rollatornutzung
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht die Sturzhäufigkeit bei älteren Menschen, die trotz Rollatornutzung stürzen. Es wird analysiert, ob sich Sturz- und Nicht-Sturzgruppe in relevanten Parametern unterscheiden und welche Verletzungen bei Stürzen auftreten.
Welche Ziele verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, die Sturzhäufigkeit bei Rollatornutzern zu ermitteln, Sturz- und Nicht-Sturzgruppe hinsichtlich verschiedener Risikofaktoren zu vergleichen, Art und Schweregrad der Sturzverletzungen zu bestimmen, den Zusammenhang zwischen Rollatorzustand und Sturzereignissen zu analysieren und Handlungsempfehlungen für Pflegepraxis und Gesundheitspolitik abzuleiten.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet zwei Erhebungsbögen (A und B). Erhebungsbogen A erfasst demografische Daten (Alter, BMI, Geschlecht), Demenzdiagnostik, Inkontinenzprofile, Chair-Rise-Test-Ergebnisse, Kraftmessungen, Seheinschränkungen, Sturzvorgeschichte, Angst und Medikamenteneinnahme (Priscus-Liste). Erhebungsbogen B erfasst Sturzort, -zeitpunkt, -situation, -lokalisation, Verletzungsausmaß, Sehfähigkeit während des Sturzes und den technischen Zustand des Rollators. Die Daten werden deskriptiv und inferenzstatistisch ausgewertet.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse werden getrennt nach den Daten aus Erhebungsbogen A (demografische Daten und Risikofaktoren) und Erhebungsbogen B (Sturzgeschehen und Verletzungen) präsentiert. Es werden deskriptive und inferenzstatistische Auswertungen gezeigt, einschließlich der statistischen Signifikanz der Unterschiede zwischen den Gruppen. Diagramme und Tabellen visualisieren die Daten.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Hinführung zum Thema, 2. Aktueller Forschungsstand (inkl. Sturzpathogenese und gesundheitsökonomischer Bedeutung), 3. Fragestellung, 4. Methode (inkl. detaillierter Beschreibung der Erhebungsbögen A und B), 5. Ergebnisse (getrennt nach Erhebungsbogen A und B), 6. Diskussion (inkl. Limitationen der Studie und Bewertung der Ergebnisse), 7. Fazit und Ausblick (inkl. zukünftiger Forschung, Fazit für Pflegepraxis und Gesundheitspolitik).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Sturzprophylaxe, Rollatoren, ältere Menschen, Sturzrisiko, Risikofaktoren, Sturzprävention, Handkraft, Sehfähigkeit, Demenz, Inkontinenz, Verletzungen, Gesundheitsökonomie, Pflegepraxis, Gesundheitspolitik.
Welche Limitationen weist die Studie auf?
Die Limitationen der Studie werden im Kapitel 6 (Diskussion) detailliert beschrieben. Diese Informationen sind im gegebenen Textfragment nicht enthalten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Studie?
Die Schlussfolgerungen der Studie, inklusive der Handlungsempfehlungen für Pflegepraxis und Gesundheitspolitik, sind im Kapitel 7 (Fazit und Ausblick) zusammengefasst. Diese Informationen sind im gegebenen Textfragment nur teilweise enthalten (z.B. die angestrebten Handlungsempfehlungen).
- Arbeit zitieren
- Klaus-Dieter Neander (Autor:in), 2017, Sturzgefahr Rollator. Verhindern Rollatoren Stürze bei älteren Menschen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374273