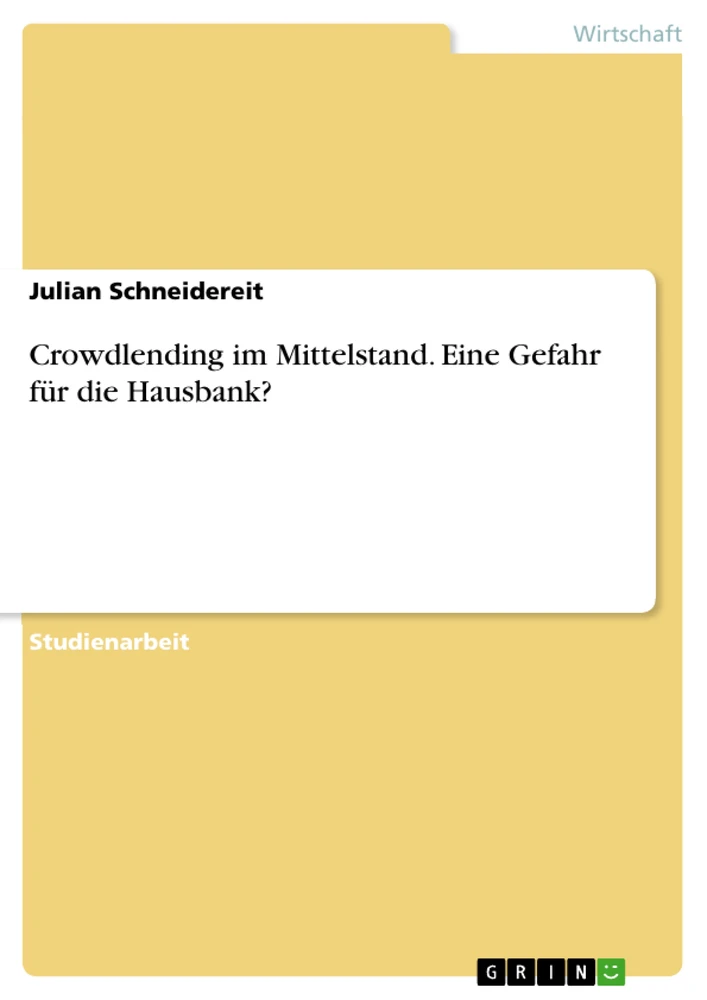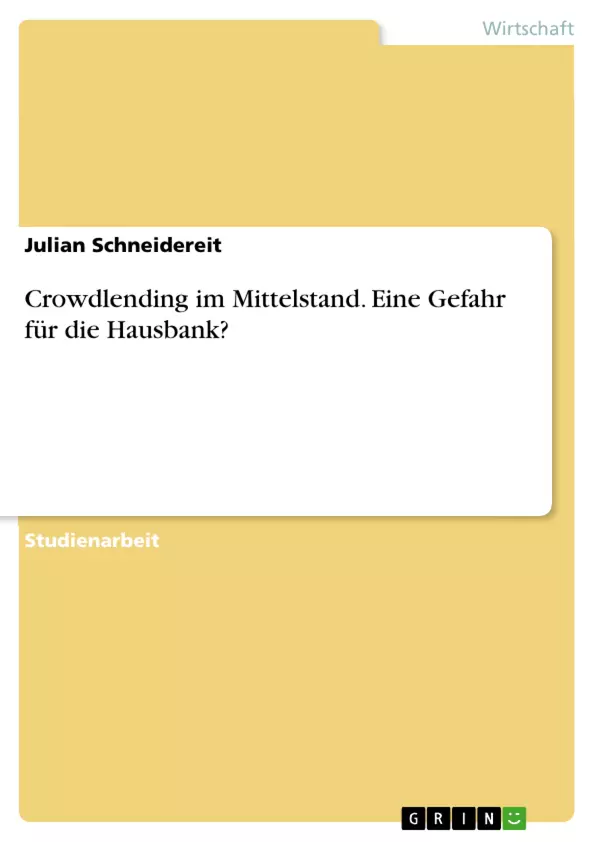"Wozu brauchen wir noch Banken?", diese und zahlreiche ähnliche bankkritische Schlagzeilen betiteln derzeit des Öfteren die Artikel deutscher Wirtschaftsliteratur. Auch Ralf Beck, Professor an der Fachhochschule in Dortmund, beschäftigt sich in seinem Buch "Wer braucht noch Banken?" mit der oben gestellten Frage und beantwortet diese sinnbildlich mit einer "Roten Karte" für diese.
Er beschreibt, dass die bisherigen Bankkunden durch Fintech- Akteure unabhängig vom klassischen Bankwesen werden können. Die oben angesprochenen Fintechs sind neue, innovative Teilnehmer auf dem Finanzmarkt, die mit technischen Lösungen, wie beispielsweise mit Online- Plattformen, die Stellung eines Finanzintermediärs einnehmen, ohne dabei selbst ins Risiko zu gehen, dadurch, dass sie sich zumeist auf Schwarmfinanzierung (Crowdfunding) spezialisieren.Auch in Deutschland erfreut sich dieses Crowdfunding wachsender Beliebtheit.
Vor allem in der Start-up-Szene, in der den neu gegründeten Unternehmen immer häufiger die Kreditvergabe durch Banken wegen strengerer aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen (Stichwort Basel III) verwehrt bleibt, wird auf die hochtechnisierte Konkurrenz zurückgegriffen. Gerhard Dilger und Roland Marko beschreiben die aktuelle Situation zwischen Fintechs und den klassischen Banken sehr treffend mit den Worten: "Gerade im Bereich des darlehenbasierten Crowdfunding, Crowdlending, schließen zunehmend Fintechs diese Finanzierungslücke und setzen sich damit in unmittelbaren Wettbewerb zum klassischen Kreditgeschäft etablierter Banken."
Doch stellen Crowdfundingplattformen, speziell Crowdlending, tatsächlich eine ernstzunehmende Bedrohung für Banken hinsichtlich der klassischen Mittelstandsfinanzierung dar oder werden sich ausschließlich sehr risikobehaftete und innovative Existenzgründer über Crowdlending-Alternativen finanzieren, sodass es nur zu geringen Überschneidungen der Zielgruppen kommt? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich die vorliegende Ausarbeitung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vergleich von Crowdlending und klassischer Bankfinanzierung im Mittelstand
- Begriffsklärung und Darstellung von Crowdlending
- Prozess bzw. Ablauf des Crowdlendings
- Abgrenzung „Mittelstand“
- Vergleich
- Ausgestaltungsmöglichkeiten des Kreditvertrags
- Konditionen und Gebühren
- Zugänglichkeit zu Krediten
- Bürokratischer und zeitlicher Aufwand
- Weitere Vorteile von Bankfinanzierung bzw. Crowdlending
- Zusätzliche Vorteile der Bankfinanzierung
- Zusätzliche Vorteile von Crowdlending
- Zwischenfazit - Crowdlending vs. Hausbank
- Mögliche Veränderungen der Marktgegebenheiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Frage, ob Crowdlending eine ernstzunehmende Bedrohung für Banken hinsichtlich der klassischen Mittelstandsfinanzierung darstellt. Dazu wird zunächst die Definition von Crowdlending erläutert und der Prozess sowie die Abgrenzung des Begriffs „Mittelstand“ vorgestellt. Im Anschluss erfolgt ein Vergleich von Crowdlending und klassischer Bankfinanzierung im Mittelstand, wobei insbesondere die Ausgestaltungsmöglichkeiten des Kreditvertrags, die Konditionen und Gebühren, die Zugänglichkeit zu Krediten und der bürokratische sowie zeitliche Aufwand betrachtet werden. Des Weiteren werden die jeweiligen Vorteile beider Finanzierungsformen beleuchtet und mögliche Veränderungen der Marktgegebenheiten aufgezeigt.
- Definition und Abgrenzung von Crowdlending
- Prozess und Ablauf des Crowdlendings
- Vergleich von Crowdlending und klassischer Bankfinanzierung im Mittelstand
- Mögliche Veränderungen der Marktgegebenheiten
- Bewertung von Crowdlending als alternative Finanzierungsquelle für den Mittelstand
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit dem aktuellen Trend der Bankkritik und stellt Fintech-Akteure als alternative Finanzierungsquellen vor. Die Einleitung veranschaulicht den wachsenden Markt der Online-Finanzdienste in Deutschland und Europa und zeigt die Bedeutung des Crowdfundings auf, insbesondere in der Start-up-Szene. Schließlich wird die Forschungsfrage der Ausarbeitung formuliert, die untersucht, ob Crowdlending eine ernstzunehmende Bedrohung für Banken hinsichtlich der klassischen Mittelstandsfinanzierung darstellt.
Vergleich von Crowdlending und klassischer Bankfinanzierung im Mittelstand
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Crowdlending und zeigt die vier Grundmodelle des Crowdfundings auf. Der Prozess und Ablauf des Crowdlendings wird erläutert, sowie der Begriff „Mittelstand“ abgegrenzt. Im Anschluss wird ein Vergleich von Crowdlending und klassischer Bankfinanzierung im Mittelstand durchgeführt. Hier werden verschiedene Aspekte wie die Ausgestaltungsmöglichkeiten des Kreditvertrags, die Konditionen und Gebühren, die Zugänglichkeit zu Krediten, der bürokratische und zeitliche Aufwand sowie weitere Vorteile beider Finanzierungsformen betrachtet. Abschließend wird ein Zwischenfazit gezogen und die möglichen Veränderungen der Marktgegebenheiten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Ausarbeitung sind Crowdlending, Bankfinanzierung, Mittelstand, Fintech, Crowdfunding, Online-Finanzdienst, Start-up, Kreditvergabe, Finanzierungsalternative, Marktgegebenheiten, Marktentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Crowdlending?
Crowdlending ist eine Form der Schwarmfinanzierung, bei der viele Privatpersonen oder institutionelle Anleger über Online-Plattformen Kredite direkt an Unternehmen vergeben.
Ist Crowdlending eine Gefahr für klassische Hausbanken?
Die Arbeit untersucht, ob Fintechs durch geringere Bürokratie und schnellere Abwicklung eine ernstzunehmende Konkurrenz im Bereich der Mittelstandsfinanzierung darstellen.
Warum nutzen mittelständische Unternehmen Crowdlending?
Oft wegen strengerer Banken-Regulierungen (Basel III), die die Kreditvergabe erschweren, sowie wegen der höheren Flexibilität und Schnelligkeit der Online-Plattformen.
Welche Vorteile bietet die klassische Bankfinanzierung weiterhin?
Vorteile sind oft günstigere Zinskonditionen für etablierte Unternehmen, persönliche Beratung und eine langfristige Geschäftsbeziehung.
Was sind Fintechs?
Fintechs sind innovative Finanztechnologie-Unternehmen, die technische Lösungen nutzen, um Finanzdienstleistungen oft effizienter als traditionelle Banken anzubieten.
- Citar trabajo
- Julian Schneidereit (Autor), 2016, Crowdlending im Mittelstand. Eine Gefahr für die Hausbank?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374349