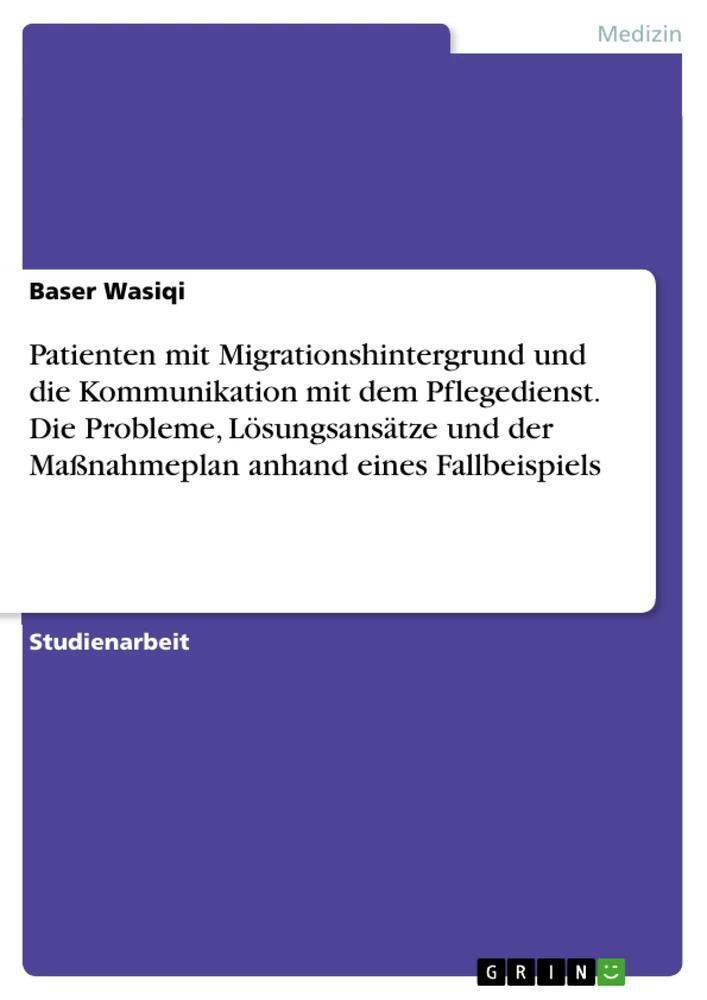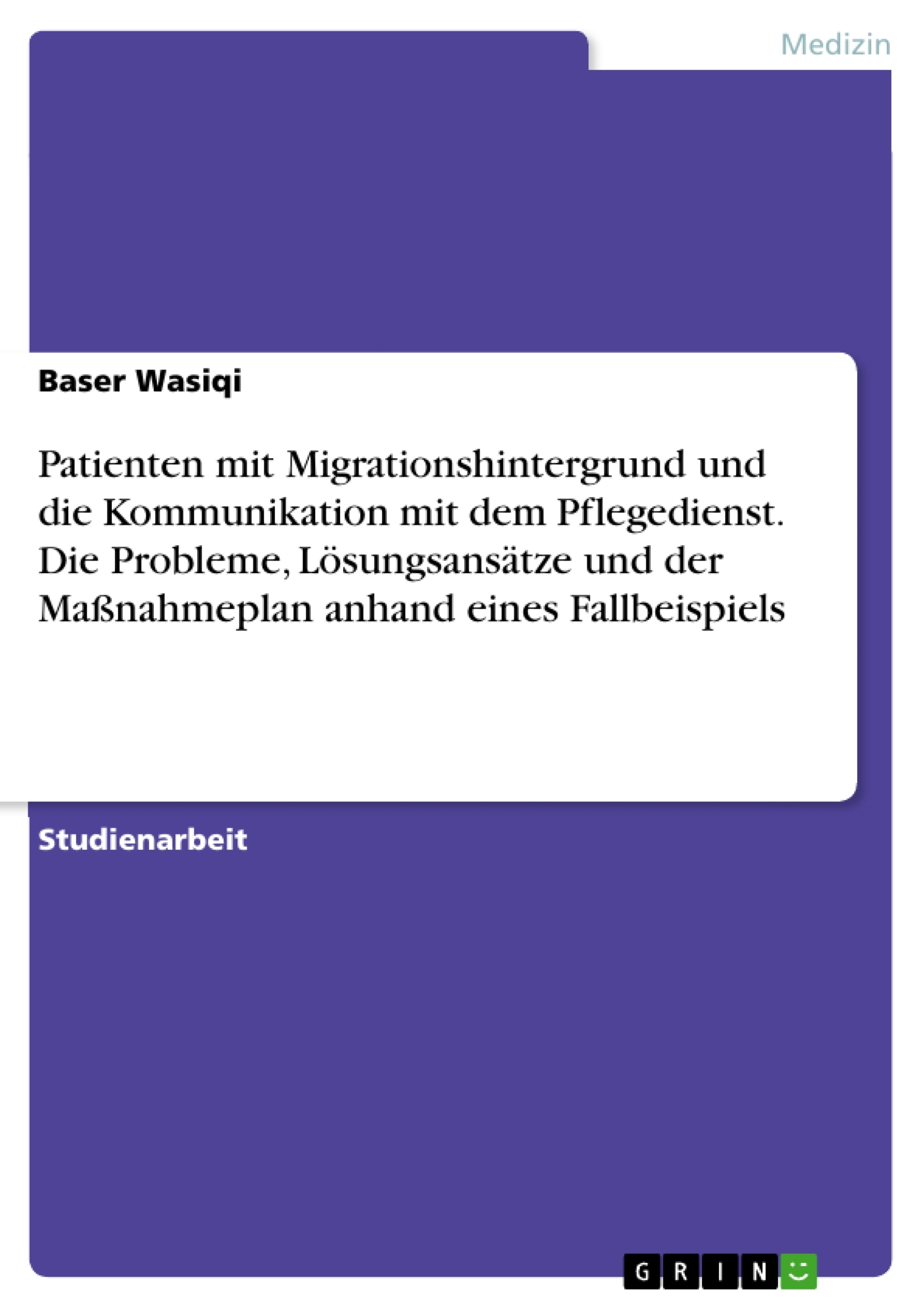Diese Arbeit beschäftigt sich aufgrund des steigenden Bedarfs und der erhöhten Relevanz im Zuge der Flüchtlingszuwanderung nach Deutschland mit der Kommunikation in der Pflege mit Patienten mit Migrationshintergrund. Diese Entwicklungen stellen den Staatsapparat und die gesamte Gesellschaft in der Bundesrepublik und damit auch den Pflegebereich vor Aufgaben, Problemen und großen Herausforderungen.
Das Thema wird durch die Erfahrungen des Autors mit einem betroffenen Patienten, der im vergangenen Jahr 2015 aus Syrien nach Deutschlang kam, praxisorientiert dargestellt. Zunächst wird die Ausgangssituation und die verschiedenen gängigen theoretischen Ansätze und Modelle hinsichtlich der Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Patienten erörtert. Danach werden die praktischen Probleme am Fall des bereits erwähnten Patienten dargestellt. Im Anschluss werden Lösungsansätze und einen Maßnahmenplan zur optimalen Kommunikation mit dem Patienten mit Migrationshintergrund präsentiert und abschließend werden die Erkenntnisse und Ergebnisse zusammengefasst,
Die Kommunikation zwischen Ärzten bzw. Pflegekräften und Patienten ist ein bedeutsamer nicht hinweg zu denkender Bestandteil der Pflege. Der Grundstein für eine vertrauensvolle Arzt- bzw. Pflegepersonal-Patient-Beziehung wird durch die kommunikative Verständigung gelegt. Nur durch diesen kommunikativen Akt, wie auch immer dieser gelagert sein sollte, ist die konstruktive Arbeit für und am Patienten möglich. Oftmals lassen sich nur so Krankheiten vollumfänglich erfassen und Schmerzen des Patienten hinreichen ermitteln. Eine Behandlung ohne Kommunikation mit dem Patienten bringt enorme Hürden mit sich. Im Folgenden möchte sich der Autor daher mit dem Fall befassen, dass die Kommunikation durch sprachliche Barrieren stark eingeschränkt ist und Lösungsansätze geben wie man diesem Problem in der Praxis begegnen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Begründung der Themenwahl
- 2. Die Ausgangssituation. Der Patient und der Pflegedienst
- 2.1. Der Patient und Problemstellung
- 2.2. Der Pflegedienst
- 2.3. Das Pflegeziel
- 3. Die Kommunikation
- 3.1. Kommunikationsebenen
- 3.2. Theoretische Ansätze zur Pflegekommunikation
- 4. Lösungsansätze und Maßnahmeplan
- 4.1. Kommunikation im Sinne des NURSE-Modells
- 4.2. Die migrationsspezifische Anamnese
- 4.3. Leitgedanke der Kulturelle Sensibilität
- 4.4. Weitere Maßnahmen
- 5. Fazit und Aussicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen der Kommunikation in der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund. Ziel ist es, praktische Lösungsansätze und einen Maßnahmenplan zur Verbesserung der Verständigung zu entwickeln und darzustellen. Dies wird anhand eines Fallbeispiels eines syrischen Patienten erläutert.
- Herausforderungen der Kommunikation durch sprachliche Barrieren in der Pflege
- Theoretische Ansätze zur Pflegekommunikation
- Entwicklung eines Maßnahmenplans zur Verbesserung der Kommunikation mit Patienten mit Migrationshintergrund
- Fallbeispiel eines Patienten mit Migrationshintergrund
- Praxisbezogene Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung der Kommunikation in der Pflege und führt das Problem der sprachlichen Barrieren bei Patienten mit Migrationshintergrund ein. Sie verweist auf die steigende Relevanz dieses Themas im Kontext der Flüchtlingszuwanderung nach Deutschland und führt das Zitat von Ursula Lehr an, welches die Wichtigkeit der Patientensprache für eine erfolgreiche Arzt-Patienten-Beziehung unterstreicht. Die Einleitung legt den Fokus auf die notwendige Verbesserung der Kommunikation, um Fehldiagnosen und fehlerhafte Behandlungen zu vermeiden. Die Arbeit wird als praxisbezogener Beitrag, basierend auf den Erfahrungen mit einem syrischen Patienten, angekündigt.
2. Die Ausgangssituation. Der Patient und der Pflegedienst: Dieses Kapitel beschreibt die Ausgangssituation anhand eines 78-jährigen syrischen Patienten (Herr A.), der an einer postinflammatorischen Lungenfibrose, altersbedingter Gebrechlichkeit und Demenz leidet. Die Hauptproblematik liegt in der eingeschränkten Kommunikation aufgrund der fehlenden Deutsch- und Englischkenntnisse des Patienten. Das Kapitel beschreibt die Herausforderungen der Kommunikation im Umgang mit Herrn A., wobei seine eingeschränkte sprachliche Kompetenz hervorgehoben wird, und stellt gleichzeitig den ambulanten Pflegedienst Humana und dessen Qualitätsstandards im Kontext des § 113 SGB XI vor.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kommunikation in der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Kommunikation in der Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund, insbesondere die sprachlichen Barrieren. Sie entwickelt und präsentiert praktische Lösungsansätze und einen Maßnahmenplan zur Verbesserung der Verständigung, anhand eines Fallbeispiels eines syrischen Patienten.
Welche Inhalte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Zielsetzung erläutert. Es folgt eine Beschreibung der Ausgangssituation, die einen 78-jährigen syrischen Patienten mit eingeschränkten Deutsch- und Englischkenntnissen und den ambulanten Pflegedienst Humana vorstellt. Weitere Kapitel befassen sich mit verschiedenen Kommunikationsebenen, theoretischen Ansätzen zur Pflegekommunikation, Lösungsansätzen (inkl. NURSE-Modell, migrationsspezifische Anamnese und kulturelle Sensibilität) und einem Maßnahmenplan. Ein Fazit und Ausblick runden die Arbeit ab.
Welche Herausforderungen werden im Bezug auf die Kommunikation betrachtet?
Die Arbeit fokussiert sich auf die Herausforderungen, die durch sprachliche Barrieren bei Patienten mit Migrationshintergrund entstehen. Es wird der Fall eines syrischen Patienten mit eingeschränkten Sprachkenntnissen detailliert beschrieben, um die praktischen Schwierigkeiten zu verdeutlichen. Die eingeschränkte Kommunikation wird als Hauptproblematik dargestellt, die zu Fehldiagnosen und fehlerhaften Behandlungen führen kann.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt verschiedene Lösungsansätze vor, darunter die Anwendung des NURSE-Modells zur Verbesserung der Kommunikation, die Durchführung einer migrationsspezifischen Anamnese und die Berücksichtigung kultureller Sensibilität. Es wird ein umfassender Maßnahmenplan entwickelt, um die Kommunikation mit Patienten mit Migrationshintergrund zu verbessern.
Welches Fallbeispiel wird verwendet?
Die Arbeit nutzt das Fallbeispiel eines 78-jährigen syrischen Patienten (Herr A.), der an postinflammatorischer Lungenfibrose, altersbedingter Gebrechlichkeit und Demenz leidet und dessen eingeschränkte Sprachkenntnisse die Pflege erschweren.
Welche theoretischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf theoretische Ansätze zur Pflegekommunikation, die im Detail im Text erläutert werden. Das NURSE-Modell wird als konkreter Lösungsansatz vorgestellt.
Wer ist die Zielgruppe der Arbeit?
Die Zielgruppe der Arbeit sind Personen, die im Bereich der Pflege tätig sind und sich mit der Kommunikation mit Patienten mit Migrationshintergrund auseinandersetzen möchten. Die Arbeit bietet praxisbezogene Lösungsansätze und einen konkreten Maßnahmenplan.
Welche Bedeutung hat die Arbeit?
Die Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Pflegequalität für Patienten mit Migrationshintergrund. Durch die Entwicklung praxisbezogener Lösungsansätze und eines Maßnahmenplans trägt sie dazu bei, sprachliche Barrieren zu überwinden und die Kommunikation in der Pflege zu optimieren.
- Quote paper
- Baser Wasiqi (Author), 2017, Patienten mit Migrationshintergrund und die Kommunikation mit dem Pflegedienst. Die Probleme, Lösungsansätze und der Maßnahmeplan anhand eines Fallbeispiels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374434