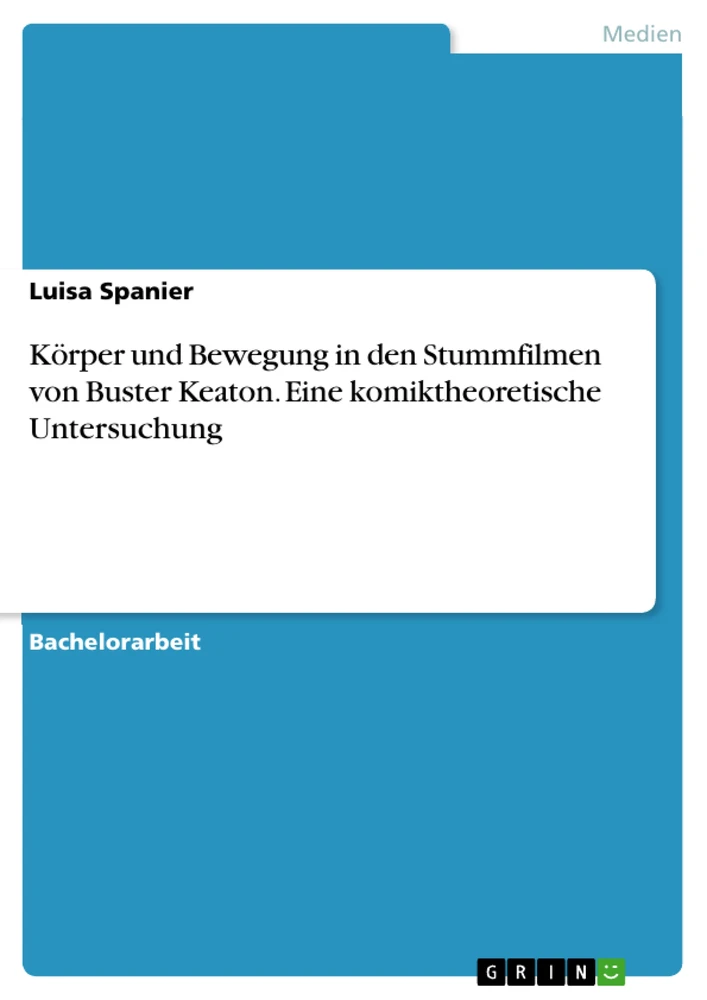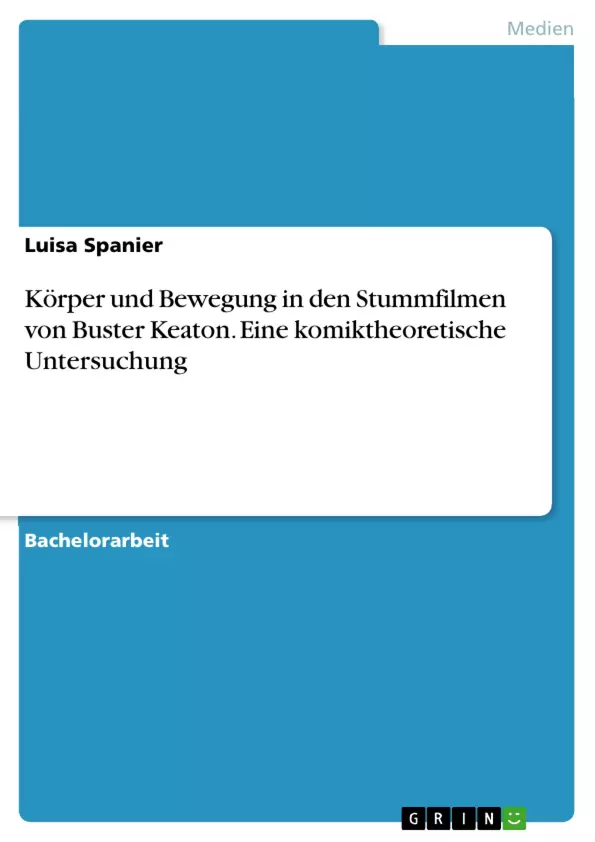Was ist Komik? Worüber lachen wir und warum? Gibt es unterschiedliche Arten des Lachens? Zweifellos ist es komisch, wenn Buster Keaton – amerikanischer Stummfilmkomiker und Meister des Slapsticks – auf einer Bananenschale ausrutscht. Ist es aber nicht ebenso komisch, wenn er genau dies nicht tut, d.h. trotz Bananenschale auf dem Boden gar nichts passiert? An beiden Filmstellen lachen wir, obwohl hier erwartungsgemäß ein Gag den anderen ausschließen müsste. Die Frage ist also, welche Art von Komik diesen und ähnlichen Szenen zugrunde liegt und warum wir über beide lachen können.
Um das herauszufinden, möchte ich mich im Rahmen dieser Arbeit eingehend mit zwei bedeutenden Theorien beschäftigen, die sich mit der Entstehung der Komik auseinandersetzen. Henri Bergson, ein französischer Philosoph, stellte sich schon in seinem Werk „Das Lachen“ die Frage nach den verschiedenen Arten der Komik und des Komischen. Diese wurde von Sigmund Freud, dem österreichischen Neurologen, später wieder aufgegriffen. In seinem Werk „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten“ (1972) untersucht er sehr ausführlich die verschiedenen Techniken des Witzes, aber auch des allgemein Komischen und des Humors.
Ob die beiden Theorien tatsächlich auf die Komik der Stummfilme Buster Keatons anzuwenden sind – denn beide Theorien erheben schließlich den Anspruch auf Allgemeingültigkeit – soll im Laufe der Arbeit mit einer Filmanalyse geprüft werden. Dazu werden drei verschiedene Szenen aus den Filmen Cops (1922), Sherlock Jr. (1924) und The Navigator (1924) betrachtet. Konkret soll darauf eingegangen werden, welche Komik den Gags in diesen Szenen zugrunde liegt und ob die beiden Theorien es schaffen, diese eindeutig zu charakterisieren. Ebenso soll die Frage beantwortet werden, was die Theorien für die Rezeption von Keatons Filmen und ihren kulturellen Wert bedeuten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Bergsons Theorie der Komik
- 2.1 Allgemeines zur Komik
- 2.2 Mensch und Maschine
- 2.3 Mechanismen der Komik
- 3 Freuds Theorie der Komik
- 3.1 Aufwandsdifferenz der Bewegung
- 3.2 Situationskomik und Erwartungsaufwand
- 3.3 Humor als ersparter Gefühlsaufwand
- 4 Buster Keaton
- 4.1 Szene aus Cops
- 4.2 Szene aus Sherlock Jr.
- 4.3 Szene aus The Navigator
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Komik in Buster Keatons Stummfilmen im Kontext zweier bedeutender Komiktheorien, nämlich Henri Bergsons und Sigmund Freuds. Ziel ist es, die Anwendbarkeit der beiden Theorien auf die Komik in Keatons Filmen zu prüfen und zu erforschen, welche Erkenntnisse sie für die Rezeption und den kulturellen Wert seiner Werke liefern.
- Analyse der Komik in Buster Keatons Stummfilmen
- Anwendung der Komiktheorien von Henri Bergson und Sigmund Freud
- Untersuchung der Beziehung zwischen Komik und dem Automatismus
- Bewertung der Relevanz der Theorien für die Rezeption von Keatons Filmen
- Betrachtung des kulturellen Werts von Buster Keatons Stummfilmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Art der Komik in Buster Keatons Stummfilmen und erläutert die Relevanz der Untersuchung im Kontext von Bergsons und Freuds Komiktheorien.
- Kapitel 2: Bergsons Theorie der Komik: Dieses Kapitel beleuchtet Bergsons Theorie des Lachens, wobei die drei Grundvoraussetzungen des Lachens sowie das Prinzip des Automatismus und der „mechanische[n] Starrheit“ im Zentrum stehen.
- Kapitel 3: Freuds Theorie der Komik: Das Kapitel behandelt Freuds Werk „Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten“ und untersucht die verschiedenen Techniken des Witzes und des allgemein Komischen, insbesondere die „Aufwandsdifferenz der Bewegung“ sowie die „Situationskomik und Erwartungsaufwand“.
- Kapitel 4: Buster Keaton: Dieses Kapitel analysiert drei verschiedene Szenen aus Keatons Filmen „Cops“, „Sherlock Jr.“ und „The Navigator“, um die Anwendung der beiden Komiktheorien zu prüfen.
Schlüsselwörter
Stummfilm, Komik, Slapstick, Buster Keaton, Henri Bergson, Sigmund Freud, Automatismus, Mechanismus, Erwartungsaufwand, Situationskomik, Humortheorie, Rezeption, kultureller Wert
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Merkmale von Buster Keatons Komik?
Buster Keatons Komik basiert auf Slapstick, präziser Körperbeherrschung und dem Kontrast zwischen menschlicher Reglosigkeit ("The Great Stone Face") und mechanischen Abläufen.
Wie erklärt Henri Bergson das Lachen in Bezug auf Maschinen?
Bergson vertritt die These, dass wir über "etwas Mechanisches, das auf etwas Lebendiges aufgepfropft wurde", lachen – also wenn ein Mensch sich starr oder wie eine Maschine verhält.
Welchen Ansatz verfolgt Sigmund Freud in seiner Theorie der Komik?
Freud sieht Komik oft als Ergebnis einer "Aufwandsdifferenz". Das Lachen entsteht durch die Ersparnis von psychischem Aufwand, etwa bei Bewegung oder Gefühlen.
Welche Filme von Buster Keaton werden in der Arbeit analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf Szenen aus den Stummfilm-Klassikern „Cops“ (1922), „Sherlock Jr.“ (1924) und „The Navigator“ (1924).
Was versteht Bergson unter "mechanischer Starrheit"?
Damit ist ein Mangel an Anpassungsfähigkeit gemeint. Wenn eine Person in einer Situation nicht flexibel reagiert, sondern ein starres Muster beibehält, wirkt dies komisch.
- Arbeit zitieren
- Luisa Spanier (Autor:in), 2017, Körper und Bewegung in den Stummfilmen von Buster Keaton. Eine komiktheoretische Untersuchung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374445