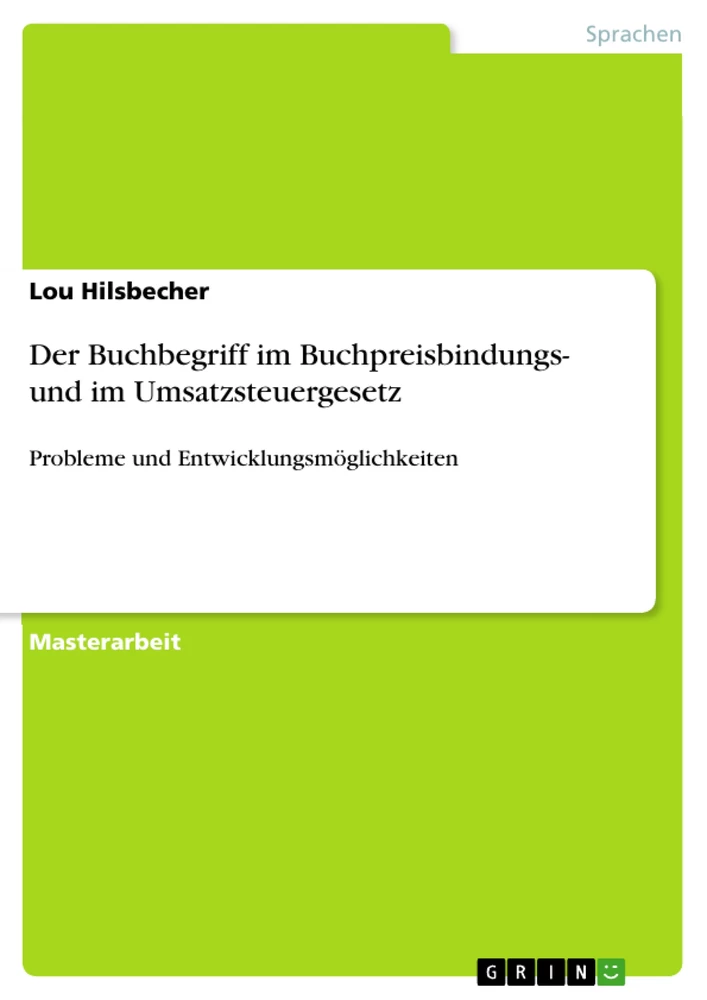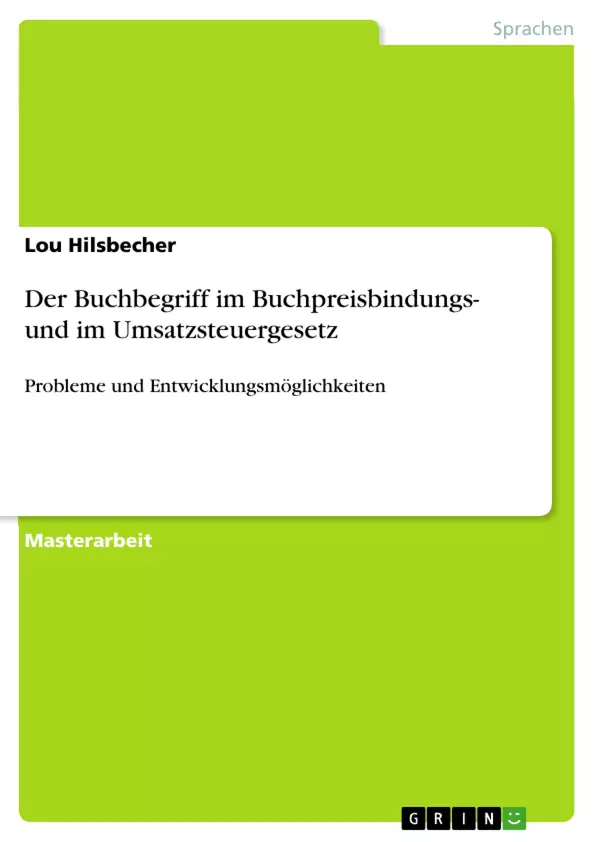Im Zuge der Digitalisierung ab Ende des 20. Jahrhunderts hat sich die globale Gesellschaft sehr schnell und sehr stark verändert. An nahezu allen Stellen des täglichen Lebens bieten digitale Technologien eine Vereinfachung des Alltags und, neben vielen weiteren Dingen, vor allem auch eine Erweiterung und Veränderung unseres Kultur- und Informationskonsums. Insbesondere letzterer Aspekt erfährt vor allem in der globalen Buchbranche durchaus auch kritische Betrachtung: Neuere Technologien werden nicht nur als Erweiterung, sondern vorrangig als Bedrohung bereits bestehender Medien (im Falle der Buchbranche also als Bedrohung des Buches) aufgefasst. Tatsächlich hat sich seit dem Beginn der Digitalisierung der Buchmarkt stark verändert: Seit den späten 1990er Jahren erweiterte sich die seit Jahrhunderten bestehende, um das kulturelle Leitmedium ‚(gedrucktes) Buch’ aufgebaute Branche um eine Mehrzahl neuer, in Materialität und Medialität vom Printbuch verschiedener Publikationsformen.
Diese Arbeit möchte sich, aufbauend auf einer Übersicht zur Medienlandschaft der deutschen Buchbranche im 21. Jahrhundert, zunächst der Definition des Buchbegriffes widmen sowie die Fragen klären, wie sich das Medium Buch im Rahmen der Digitalisierung verändert hat sowie ob und inwiefern eine Neudefinition dieses Begriffes notwendig ist, um auch die neuen Publikationsformen, die sich aktuell auf dem deutschen Buchmarkt etablieren und etabliert haben, miteinzubeziehen. Sodann soll herausgearbeitet werden, welche Konsequenzen die Präsenz dieser neuen Publikationsformen auf dem deutschen Buchmarkt für die Branche mit sich bringt, wenn es um die Anwendung rechtlicher Regulierungen, insbesondere des Buchpreisbindungsgesetzes und des Umsatzsteuergesetzes, geht. Gerade an dieser Stelle, nämlich der rechtlichen Definition besagter neuer Publikationsformen und der Anwendung von buchbranchenrelevanten deutschen Gesetzen auf diese Medien, tritt eine Vielzahl von Problemen auf, die in der Branchenpresse und auch im Alltag der Branchenteilnehmer sehr präsent sind. Weiterhin sollen jedoch auch Problematiken beleuchtet werden, die nicht aus Unzulänglichkeiten in der begrifflichen Definition, sondern vielmehr aus Unterschieden in der materiellen Medialität (print/digital) resultieren. Im Fokus sollen hierbei das Buchpreisbindungsgesetz und das Umsatzsteuergesetz stehen, wobei jedoch in einem kurzen Exkurs auch der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag betrachtet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die deutsche Buchbranche
- Historischer Hintergrund der deutschen Buchbranche
- Die Medienlandschaft der deutschen Buchbranche im 21. Jahrhundert
- Das Medium,Buch'
- Begriffsklärung
- Das (gedruckte) Buch
- Das E-Book
- Weitere Medienformen
- Buchmedien im deutschen Recht
- Das Buchpreisbindungsgesetz
- Der Buchbegriff im Buchpreisbindungsgesetz
- Problematiken bei der Anwendung des Buchpreisbindungsgesetzes
- Das Umsatzsteuergesetz
- Der Buchbegriff im Umsatzsteuergesetz
- Problematiken bei der Anwendung des Umsatzsteuergesetzes
- Exkurs: Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
- Der Medienbegriff im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag: Das E-Book als Telemedium
- Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag in der Anwendung
- Fazit
- Das Buchpreisbindungsgesetz
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Definition des Buchbegriffes im Kontext der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die deutsche Buchbranche. Sie untersucht, wie sich das Medium,Buch' im Rahmen der Digitalisierung verändert hat und ob eine Neudefinition des Buchbegriffes notwendig ist, um auch neue Publikationsformen einzubeziehen. Insbesondere werden die Konsequenzen der Präsenz dieser neuen Publikationsformen für die Anwendung des Buchpreisbindungsgesetzes und des Umsatzsteuergesetzes analysiert.
- Definition des Buchbegriffes im digitalen Zeitalter
- Veränderungen des Mediums,Buch' durch die Digitalisierung
- Anwendung des Buchpreisbindungsgesetzes und des Umsatzsteuergesetzes auf neue Buchmedien
- Problematiken und Entwicklungsmöglichkeiten im Spannungsfeld zwischen traditionellem Buch und digitalen Publikationsformen
- Relevanz des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags für E-Books
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Buchbegriffes in der digitalen Welt dar und führt in die Forschungsfrage ein.
- Die deutsche Buchbranche: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund der deutschen Buchbranche und analysiert die aktuelle Medienlandschaft im 21. Jahrhundert.
- Das Medium,Buch': Hier wird der Buchbegriff im Kontext der Digitalisierung diskutiert und es werden verschiedene Buchformen, insbesondere das (gedruckte) Buch und das E-Book, definiert.
- Buchmedien im deutschen Recht: Dieses Kapitel untersucht den Buchbegriff im Buchpreisbindungsgesetz und im Umsatzsteuergesetz, analysiert die Problematiken bei der Anwendung dieser Gesetze auf neue Publikationsformen und widmet sich in einem Exkurs dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselwörter Buchbegriff, Digitalisierung, Buchbranche, Buchpreisbindungsgesetz, Umsatzsteuergesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, E-Book, Printmedien, Telemedien, Medienlandschaft. Die Arbeit untersucht die Relevanz dieser Begriffe im Kontext der aktuellen Entwicklungen in der Buchbranche.
Häufig gestellte Fragen
Warum muss der Buchbegriff im digitalen Zeitalter neu definiert werden?
Durch die Digitalisierung sind neue Formate wie E-Books entstanden, die sich in Materialität und Medialität vom klassischen Printbuch unterscheiden, was rechtliche Anpassungen erfordert.
Gilt das Buchpreisbindungsgesetz auch für E-Books?
Die Arbeit untersucht die Anwendung des Gesetzes auf digitale Publikationsformen und die damit verbundenen Probleme für die Buchbranche.
Wie werden Bücher im Umsatzsteuergesetz behandelt?
Es wird analysiert, inwieweit unterschiedliche Steuersätze für gedruckte Bücher und digitale Medienformen (E-Books) bestehen und welche Konsequenzen dies hat.
Welche Rolle spielt der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag für E-Books?
E-Books werden rechtlich oft als Telemedien eingestuft, was spezifische Anforderungen an den Jugendmedienschutz stellt, die über die Regeln für Printmedien hinausgehen.
Ist das E-Book eine Bedrohung für das gedruckte Buch?
Die Arbeit beleuchtet die kritische Sicht der Branche, die neue Technologien oft als Bedrohung des kulturellen Leitmediums "Buch" wahrnimmt.
- Arbeit zitieren
- Lou Hilsbecher (Autor:in), 2016, Der Buchbegriff im Buchpreisbindungs- und im Umsatzsteuergesetz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374502