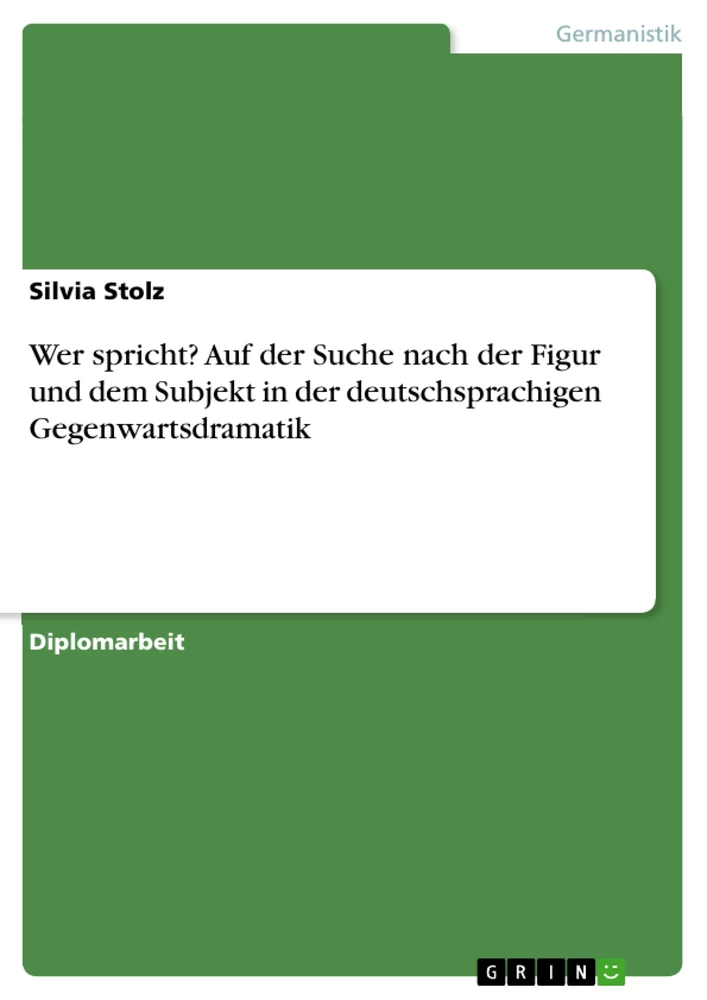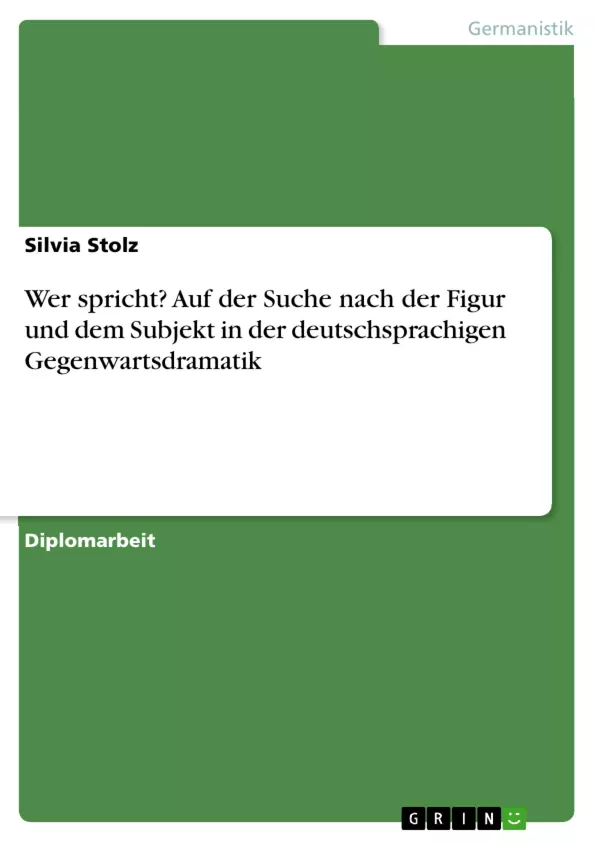Wer spricht? Diese Frage zieht sich, von Foucault und Barthes neu gestellt, durch die Postmoderne. Diese Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Frage nach dem Subjekt, und wie es sich uns in den Figuren der deutschsprachigen Gegenwartsdramatik präsentiert, zu stellen. Sie versucht, genauer zu fassen, welche Arten der Figuren in den zeitgenössischen Stücken zu finden sind und welche verschiedenen, gegenwärtigen Vorstellungen und Ideen sie über das Konzept des Subjekts in seiner Einheit und Vielheit vermitteln. Oder kommunizieren die Dramen gar eine Vorstellung davon, dass das Subjekt, wie der von Barthes proklamierte Autor, längst tot sei?
Wenn auch nicht ihren Tod, so problematisieren verschiedene Dramen oder vielmehr Textformen, die für die Bühne konzipiert sind, die Stellung der dramatischen Figur, stellen damit das Konzept des Subjekts in Frage und verweisen auf Rollenhaftigkeit der lebensweltlichen Rollensegmente. Interessant wird es dabei vor allem dort, wo das dramatische Repräsentationsprinzip als unzureichend für die Darstellung vielschichtiger (subjektiver) Wirklichkeit(en) entlarvt erscheint; interessant im besonderen Falle eben dort, wo die Figur als Sinnzusammenhang und Einheit aufbricht, wo sie nicht als einzelne Person in das Zentrum des Dramas tritt, da sie in dieser Form nicht genügen würde, um die verschiedenen Individuen in ihren pluralen Wirklichkeiten und unterschiedlichen Subjektivitäten aufzugreifen. Letztlich wird selbst die Begrifflichkeit 'Figur' fraglich, wo sie in einzelne Bestandteile zerspringt, kaum noch zu fassen ist, oder sich als eine Art Verlautbarungsinstanz zeigt.
Da das Thema schon innerhalb den Begriffen 'Figur und Subjekt' interdisziplinäre Bezüge zwischen Theater und Philosophie anspricht, dienten zur Analyse der Dramen vor allem Texte aus dem Bereich der Soziologie, Psychologie und der poststrukturalistischen Philosophie (Roland Barthes, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Judith Butler). Neben diesen Grundlagen werden sechs Autoren mit jeweils einem Stück behandelt (Händl Klaus, Falk Richter, Elfriede Jelinek, Kathrin Röggla, Roland Schimmelpfennig und Moritz Rinke).
Sowohl in den Stücken, die Figur des Autors betreffend, wie auch innerhalb der Inszenierungen, schwingt das Pendel zwischen Figuration und der Auflösung der Figuren, zwischen autonomen und heteronomen Subjekten. Spiegelt sich in den Dramen mit offenen oder geschlossenen Figuren das Selbstverständnis des heutigen Menschen wieder?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Autorenbezogene Interpretation
- Textimmanente Interpretation
- Wer spricht?
- Formen des Subjekts
- Innerhalb der Philosophie
- Innerhalb des Dramas
- Innerhalb der heutigen Gesellschaft
- Deutschsprachige Gegenwartsdramatik
- Händl Klaus: Subjekt des Verschwindens
- Unsichere Grundlage
- Die Hauptfigur: Identität des Verschwindens
- Zwängen unterworfenes Subjekt
- Die Nebenfiguren
- Zusammenfassung und Subjekt des Autors
- Falk Richter: Subjekt der Oberfläche
- Subjekt zwischen Raum und Zeit
- Subjekt zwischen den Ebenen
- Technisiertes Subjekt
- Zusammenfassung und Subjekt des Autors
- Kathrin Röggla: Selbstregulierendes Subjekt
- Die Figuren
- Figuren zwischen Realität und Fiktion
- Subjekt der Bio-Macht und der Gouvernementalität
- Zusammenfassung und Subjekt der Autorin
- Elfriede Jelinek: Weibliches Nicht-Subjekt
- Prinzessinnen im Zustand des Nicht-Seins
- Dornröschen und das Subjekt des Performativen
- Intertextualität als Form des Subjektzerfalls
- Die Sprache als Figur des Textes
- Zusammenfassung und Subjekt der Autorin
- Händl Klaus: Subjekt des Verschwindens
- Zurück zum Subjekt!?
- Erneute Frage nach dem Subjekt
- Figürliche Gegenwartsdramatik
- Roland Schimmelpfennig
- Moritz Rinke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Suche nach der Figur und dem Subjekt in der deutschsprachigen Gegenwartsdramatik. Sie analysiert verschiedene Werke und beleuchtet dabei die Darstellung des Subjekts in Bezug auf philosophische und gesellschaftliche Kontexte. Ziel ist es, die Vielfältigkeit und Komplexität des Subjektbegriffs in der heutigen Dramatik zu verdeutlichen.
- Die Bedeutung des Subjektbegriffs in der Philosophie und im Theater
- Die Darstellung des Subjekts in der deutschsprachigen Gegenwartsdramatik
- Die Frage nach der Identität und dem Verschwinden des Subjekts
- Die Rolle von Machtstrukturen und gesellschaftlichen Zwängen in der Subjektbildung
- Die Bedeutung von Sprache und Intertextualität für die Konstruktion des Subjekts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik des Subjekts in der Gegenwartsdramatik ein und beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze. Sie stellt die Frage, wie sich das Subjekt in der heutigen Zeit darstellt und wie es sich in der Dramatik manifestiert.
- Formen des Subjekts: Dieses Kapitel untersucht den Subjektbegriff aus verschiedenen Perspektiven: innerhalb der Philosophie, im Drama und in der heutigen Gesellschaft. Es beleuchtet die vielschichtigen Facetten des Subjekts und die verschiedenen Interpretationen, die ihm zukommen.
- Deutschsprachige Gegenwartsdramatik: Dieses Kapitel analysiert ausgewählte Stücke deutschsprachiger Dramatikerinnen und Dramatiker. Die Analyse fokussiert auf die Darstellung des Subjekts in den jeweiligen Werken und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, denen das Subjekt in der heutigen Zeit gegenübersteht.
- Zurück zum Subjekt!? Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob sich das Subjekt in der Gegenwartsdramatik wiederfindet und ob es eine neue Form des Subjekts in der heutigen Zeit gibt. Es analysiert, wie sich die Dramatik der letzten Jahre mit der Thematik des Subjekts auseinandersetzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert zentrale Begriffe und Konzepte wie Subjekt, Figur, Gegenwartsdramatik, Identität, Verschwinden, Machtstrukturen, Sprache, Intertextualität, Bio-Macht, Gouvernementalität, Performativität, Philosophie, Theater, und die Werke von Händl Klaus, Falk Richter, Kathrin Röggla und Elfriede Jelinek.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser literaturwissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Darstellung der dramatischen Figur und des Subjekts in der deutschsprachigen Gegenwartsdramatik vor dem Hintergrund postmoderner Theorien.
Welche Rolle spielt die Frage „Wer spricht?“?
Diese auf Foucault und Barthes zurückgehende Frage dient als Ausgangspunkt, um zu prüfen, ob das Subjekt im modernen Drama noch als Einheit existiert oder bereits „tot“ bzw. aufgelöst ist.
Welche Dramatiker werden in der Arbeit analysiert?
Analysiert werden Werke von Händl Klaus, Falk Richter, Elfriede Jelinek, Kathrin Röggla, Roland Schimmelpfennig und Moritz Rinke.
Was versteht man unter dem „Subjekt des Verschwindens“ bei Händl Klaus?
Es beschreibt eine Form der Figur, deren Identität unsicher ist und die sich klassischen Zuschreibungen durch Verschwinden oder Entzug entzieht.
Wie thematisiert Elfriede Jelinek das Subjekt?
Jelinek arbeitet oft mit dem Konzept des „weiblichen Nicht-Subjekts“ und nutzt Intertextualität sowie Sprache als eigenständige Figur, um den Zerfall des klassischen Subjekts darzustellen.
- Quote paper
- Silvia Stolz (Author), 2007, Wer spricht? Auf der Suche nach der Figur und dem Subjekt in der deutschsprachigen Gegenwartsdramatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374505