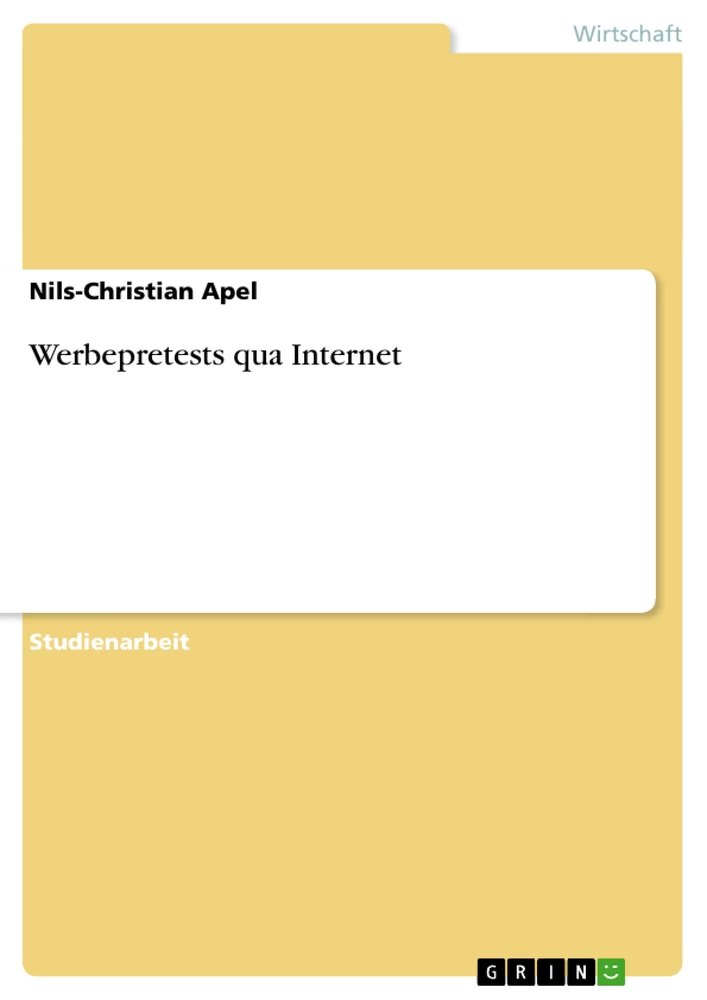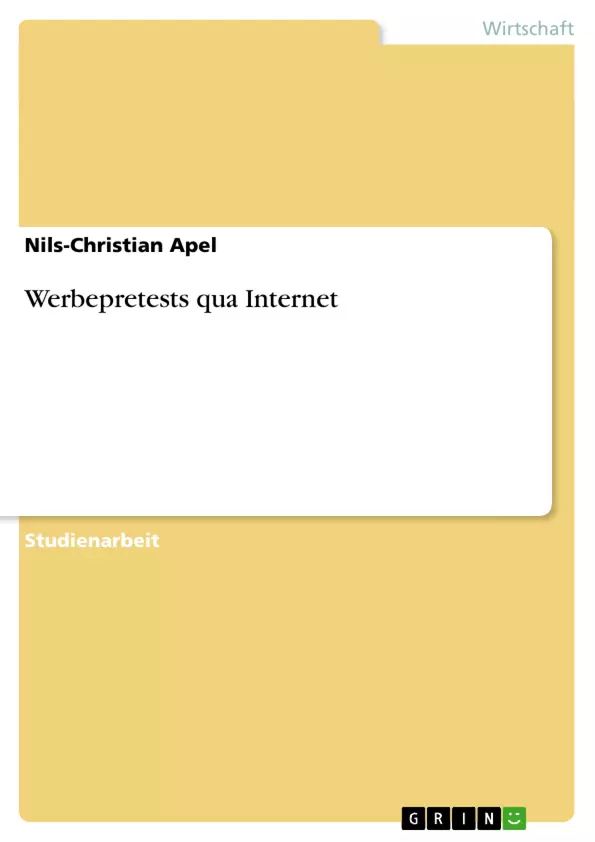Einer aktuellen Studie des Instituts für Marketing und Kommunikation (IMK) zufolge nehmen deutsche Konsumenten durchschnittlich 6000 Werbekontakte pro Tag wahr. In dieses Ergebnis wurden jedoch nicht nur Werbemittel im eigentlichen Sinn (Anzeigen, Werbespots, etc.) einbezogen, sondern auch "indirekte" Werbeträger, wie Logos auf Bekleidung oder Einkaufstüten, wodurch die hohe Zahl relativiert wird. Dennoch ergab die Frage nach den bewußt erinnerten Werbekontakten der letzten vierundzwanzig Stunden nur einen Durchschnittswert von drei Kontakten.
Eine Erhöhung der Kontaktdosis, also eine Steigerung der Werbeaktivitäten, um die Wahrscheinlichkeit der bewußten Aufnahme durch die Konsumenten anzuheben, scheint in diesem Zusammenhang für die Werbetreibenden wenig ratsam. Vielmehr sind Instrumente gefragt, mit denen die Werbewirkung zuverlässig prognostiziert werden kann, um somit einem Scheitern der Werbung, verbunden mit immensen Kosten und eventuellen Imageschäden, beispielsweise durch falsch verstandene Werbeaussagen, bereits im Vorfeld der Schaltung entgegenzuwirken.
Da durch die Verwendung von Pretests die Werbewirkung nachweislich gesteigert, sowie das Risiko von finanziellen Fehlentscheidungen minimiert werden kann, empfiehlt sich dieses Instrument in der Praxis. Nicht selten jedoch wird der Pretest als kreativitäts- und qualitätshemmend bezeichnet und seinen Ergebnissen mangelnder Realitätsbezug vorgeworfen.
Durch den Einsatz des Internets als Basis für Werbepretests ergeben sich jedoch neue Einsatzfelder, die die Vorteile des Mediums optimal ausnutzen und somit nicht nur qualitativen, sondern auch finanziellen Nutzen bieten.
"Werbepretests qua Internet" verleiht einen Überblick über die Werbewirkungsforschung im allgemeinen und geht auf Vor- und Nachteile von Pretests ein. Praktische Beispiele von Pretests im Internet und deren kritische Würdigung geben letzten Endes einen Eindruck der Möglichkeiten, sowie der Grenzen der Online-Werbewirkungsforschung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Betrachtung
- Werbewirkungsforschung
- Methoden
- Befragung
- Beobachtung
- Experiment
- Mehrmethodenuntersuchungen
- Instrumente und Meßgrößen
- Tachistoskop
- Blickaufzeichnung
- Recall (Wiedererinnerung)
- Recognition (Wiedererkennung)
- Likeability (Gefallen)
- Methoden
- Werbepretests
- Grundsätzliches zu Werbepretests
- Werbepretests qua Internet
- Ausgewählte Online-Pretests
- Praxis: WEB.ADTest
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Werbewirkungsforschung im Allgemeinen, sowie die Vor- und Nachteile von Pretests zu beleuchten. Anhand von praktischen Beispielen von Pretests im Internet und deren kritischer Würdigung sollen die Möglichkeiten und Grenzen der Online-Werbewirkungsforschung aufgezeigt werden.
- Grundlagen der Werbewirkungsforschung
- Methoden und Instrumente der Werbewirkungsforschung
- Potenzial und Grenzen von Werbepretests
- Einsatz von Online-Pretests
- Kritische Würdigung von Online-Pretests
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Relevanz von Werbewirkungsforschung angesichts der täglichen Reizüberflutung durch Werbung. Die Arbeit erläutert die Notwendigkeit von Werbepretests, um Werbewirkung zu prognostizieren und finanzielle Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Kapitel 2 vermittelt einen Überblick über die wichtigsten Methoden und Instrumente der Werbewirkungsforschung. Dazu gehören Befragung, Beobachtung und Experiment. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der Methoden werden im Detail diskutiert.
Das Kapitel über Werbepretests beleuchtet zunächst die grundsätzliche Bedeutung und Funktionsweise von Pretests. Im Fokus stehen anschließend Werbepretests im Internet, ihre spezifischen Vorteile und Herausforderungen sowie ausgewählte Beispiele für Online-Pretests.
Schlüsselwörter
Werbewirkungsforschung, Werbepretests, Online-Pretests, Methoden, Instrumente, Befragung, Beobachtung, Experiment, Web.ADTest, Online-Marketing, Marktforschung, Kundenverhalten, Werbewirkung, Effizienz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel eines Werbepretests?
Ein Pretest soll die Wirkung einer Werbemaßnahme prognostizieren, um finanzielle Fehlentscheidungen und Imageschäden vor der eigentlichen Schaltung zu vermeiden.
Welche Vorteile bieten Pretests über das Internet?
Online-Pretests sind oft kostengünstiger, schneller durchzuführen und ermöglichen den Zugriff auf eine breite, geografisch verteilte Zielgruppe in ihrem natürlichen Umfeld.
Was unterscheidet „Recall“ von „Recognition“?
Recall misst die aktive Wiedererinnerung an eine Werbung ohne Hilfe, während Recognition die Wiedererkennung einer gezeigten Werbebotschaft prüft.
Was ist ein Tachistoskop?
Ein Gerät in der Werbeforschung, das Bilder für Bruchteile von Sekunden zeigt, um die Wahrnehmungsschwelle und die visuelle Durchsetzungskraft eines Werbemittels zu testen.
Warum wird Kritik an Werbepretests geübt?
Kritiker bemängeln oft einen mangelnden Realitätsbezug der Testsituation und befürchten, dass Pretests die Kreativität von Werbeagenturen einschränken könnten.
- Quote paper
- Nils-Christian Apel (Author), 2005, Werbepretests qua Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37455