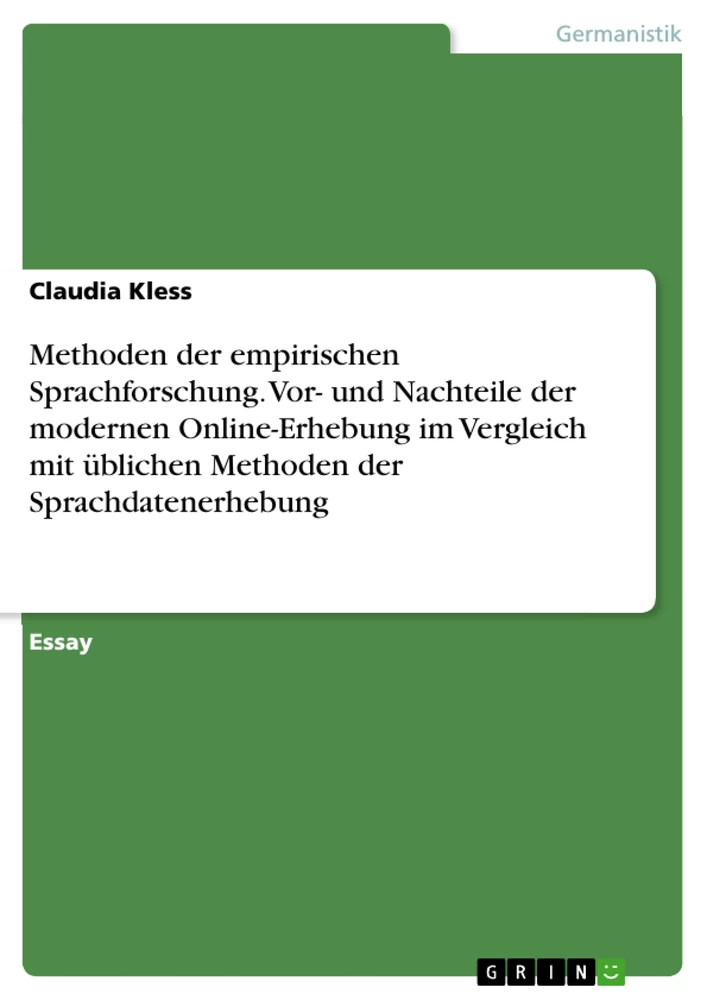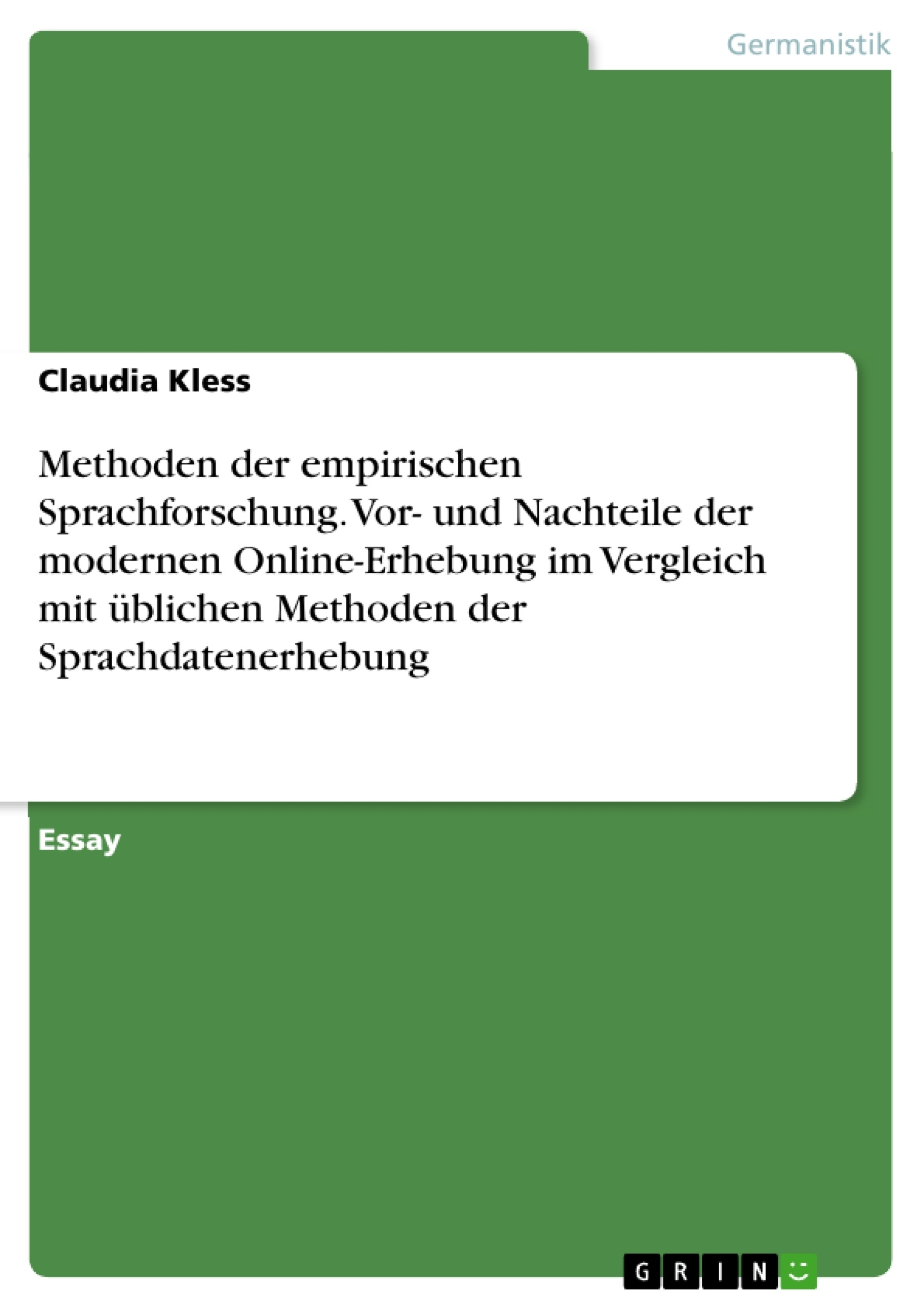Diese Arbeit konzentriert sich darauf, einen Überblick über die Organisation einer Sprachdatenerhebung zu geben. Dabei soll auch darauf geachtet werden, auf möglichen Schwierigkeiten innerhalb der Planung und Durchführung hinzuweisen. Das besondere Augenmerk liegt dabei aber auf den verschiedenen Methoden der Sprachdatenerhebung, die auf ihre Vor- und Nachteile hin untersucht werden sollen. Zum Schluss soll durch den Vergleich der Vorgehensweise des „Wortatlas der deutschen Umgangssprachen“ von Jürgen Eichhoff mit der modernen Methode des „Atlas der deutschen Alltagssprache“ von Stephan Elspaß und Robert Möller aufgezeigt werden, für welche Untersuchungsgegenstände die jeweilige Vorgehensweise am besten geeignet ist.
Innerhalb der empirischen Sprachforschung ist die Sprachgeographie ein wichtiger Forschungsbereich. Sie beschäftigt sich damit, sprachliche und metasprachliche Phänomene an bestimmten Punkten zu verorten und dann durch Kartierung zu veranschaulichen. Doch immer wieder trifft man dabei auf die gleiche Frage: Welchen Nutzen kann man aus empirischer Sprachforschung ziehen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Planung und Durchführung einer empirischen Sprachdatenerhebung
- Hypothesenbildung und Planung
- Methoden eines Samplings
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Organisation einer empirischen Sprachdatenerhebung. Besonderer Fokus liegt dabei auf der detaillierten Untersuchung verschiedener Methoden der Sprachdatenerhebung, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile. Die Arbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen bei der Planung und Durchführung solcher Erhebungen aufzuzeigen und zu erläutern, wie diese bewältigt werden können.
- Planung und Durchführung von empirischen Sprachdatenerhebungen
- Methoden der Sprachdatenerhebung und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile
- Herausforderungen bei der Planung und Durchführung von Sprachdatenerhebungen
- Vergleich verschiedener Ansätze zur Sprachdatenerhebung
- Entwicklung eines fundierten Verständnisses für die Organisation und Durchführung von empirischen Sprachdatenerhebungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der empirischen Sprachforschung und ihre Bedeutung für die Sprachgeographie ein. Sie beleuchtet die Herausforderungen bei der Untersuchung der Alltagssprache und die Notwendigkeit, verschiedene regionale, stilistische und situationsspezifische Varianten zu erfassen.
Planung und Durchführung einer empirischen Sprachdatenerhebung
Hypothesenbildung und Planung
Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Schritte der Hypothesenbildung und Planung einer empirischen Sprachdatenerhebung. Er diskutiert die Bedeutung der Beobachtungsadäquatheit und das Problem des Beobachterparadoxons. Darüber hinaus werden wichtige Aspekte des Datenschutzes und der Entwicklung geeigneter Methoden und Fragetechniken erläutert.
Methoden eines Samplings
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die verschiedenen Methoden des Samplings, die zur Auswahl von Gewährspersonen für eine empirische Sprachdatenerhebung verwendet werden können. Er vergleicht die Vor- und Nachteile der Zufallsstichprobe und der Quotenstichprobe und diskutiert die Bedeutung der Repräsentativität der Stichprobe.
Schlüsselwörter
Empirische Sprachforschung, Sprachgeographie, Alltagssprache, Sprachdatenerhebung, Methodenvergleich, Sampling, Stichproben, Beobachtungsadäquatheit, Beobachterparadox, Datenschutzrecht, Zufallsstichprobe, Quotenstichprobe.
- Quote paper
- Claudia Kless (Author), 2013, Methoden der empirischen Sprachforschung. Vor- und Nachteile der modernen Online-Erhebung im Vergleich mit üblichen Methoden der Sprachdatenerhebung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374675