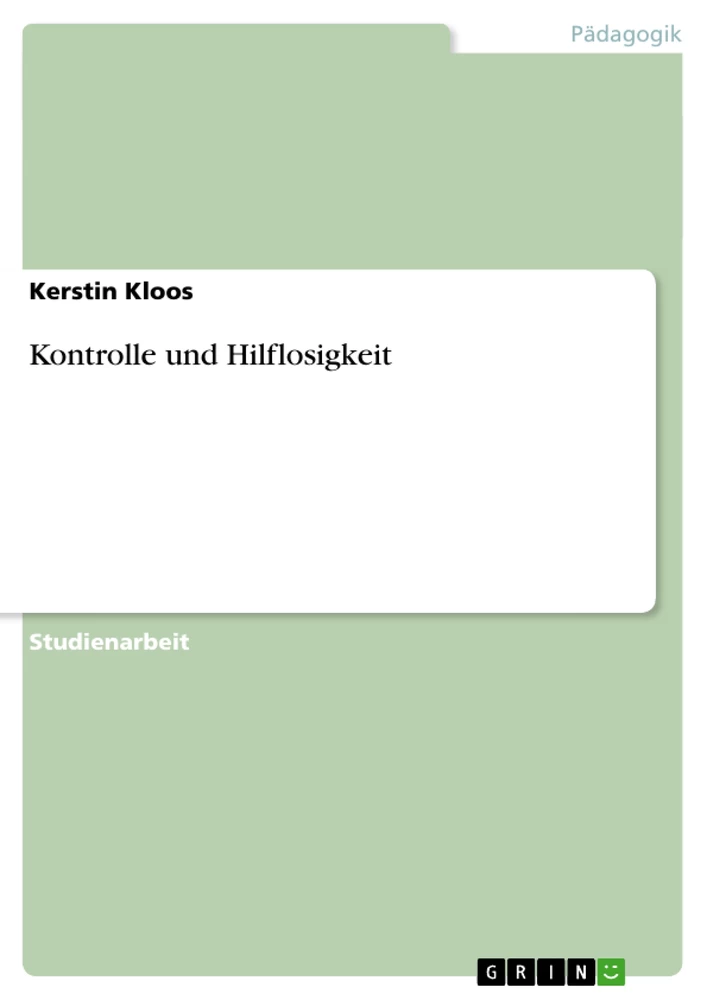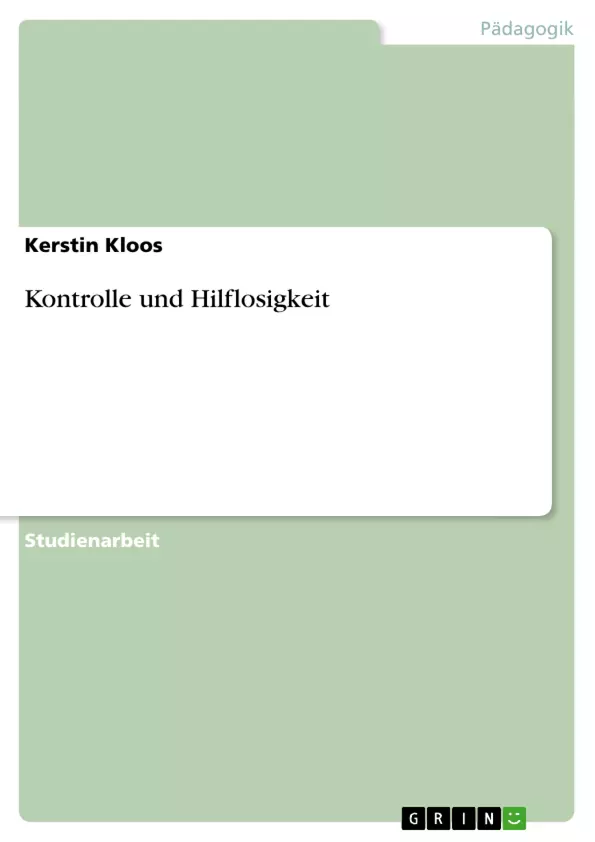Einleitung
Prof. Dr. Franz Petermann schreibt in seinem Nachwort zu Seligmans „Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit“: Zwar scheinen Unkontrollierbarkeit, Nichtplanbares und Unverhofftes nicht in eine hochtechnisierte Welt zu passen; trotzdem findet man heute immer häufiger Erscheinungsformen der Macht-, Hilf- oder Hoffnungslosigkeit.1 Ein aktuelles Beispiel für Petermanns Aussage ist die Hochwasserkatastrophe im Osten Deutschlands. Trotz Wettervorhersagen, Dämmen, Deichen und Sandsäcken konnten die Wassermassen nicht unter Kontrolle gebracht werden. Die menschliche Kontrolle hatte ihre Grenzen erreicht, die Menschen konnten nichts mehr bewirken. Sie standen vor den Ruinen ihrer Häuser und resignierten. Ein gewaltiger Wasserstrom hatte ihnen ihr Hab und Gut genommen. Und sie hatten nichts dagegen tun können. Und wenn sie noch etwas tun wollten und noch nicht bereit waren aufzugeben, wurden sie von Feuerwehr und technischem Hilfswerk gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Das brisante aktuelle Beispiel beschreibt genau das Problem, das diese Hausarbeit behandeln soll: Was ist Kontrolle, wie erfährt der Mensch sie und wie fasst er sie auf? Was passiert, wenn Menschen ihre Kontrolle verlieren? Warum werden manche Menschen schnell hilflos, andere dafür nicht?
Im ersten Abschnitt sollen zunächst Kontrolle, Unkontrollierbarkeit und Kontrollgrundbedürfnis definiert und die kognitiven Grundlagen dafür kurz erklärt werden. Darauf folgt ein Kapitel mit verschiedenen Aspekten zur Kontrollmeinung, der subjektiven Ansicht jedes Einzelnen über seine eigene Wirksamkeit. Der zweite Teil hat den Kontrollverlust und die daraus entstehende Hilflosigkeit zum Thema. Die Grundlage bildet die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman. Mir war jedoch wichtig, auch noch einige Ergänzungen zu dieser Theorie anzuführen, um zu zeigen, dass die ursprüngliche Idee unvollständig ist. Natürlich wird zur erlernten Hilflosigkeit immer noch geforscht und eine Darstellung dieser Theorie kann kaum vollständig sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Hauptteil
- 2.1 Die Theorie der eigenen Wirksamkeit
- 2.1.1 Was ist Kontrolle?
- 2.1.1.1 Der Begriff Kontrolle
- 2.1.1.2 Unkontrollierbarkeit
- 2.1.1.3 Das Kontrollgrundbedürfnis
- 2.1.1.4 Die lerntheoretische Grundlage: Instrumentelles Konditionieren
- 2.1.2 Aspekte der Kontrollmeinung
- 2.1.2.1 Die Erfahrung von Kontrolle
- 2.1.2.2 Die Kontrollüberzeugungstheorie nach J. B. Rotter
- 2.1.2.3 Die Selbstwirksamkeitstheorie in Anlehnung an Albert Bandura
- 2.1.2.4 Die Fehleinschätzung der eigenen Kontrolle: Kontrollillusion
- 2.2 Hilflosigkeit als Reaktion auf den Verlust von Kontrolle
- 2.2.1 Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman
- 2.2.2 Ergänzungen und Reformulierungen der Seligmanschen Theorie
- 2.2.2.1 Die attributionstheoretische Reformulierung
- 2.2.2.2 Das Reaktanz- Hilflosigkeits- Modell
- 2.2.2.3 Ein 4-Stufen-Modell nach Flammer
- 3.0 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Kontrolle, Kontrollverlust und der daraus resultierenden Hilflosigkeit. Ziel ist es, das Verständnis für den Begriff Kontrolle und die subjektive Wahrnehmung der eigenen Wirksamkeit zu vertiefen. Weiterhin soll die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman erläutert und durch ergänzende Theorien erweitert werden.
- Der Begriff Kontrolle und seine verschiedenen Aspekte.
- Das Kontrollgrundbedürfnis des Menschen und seine lerntheoretischen Grundlagen.
- Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman.
- Ergänzende und reformulierende Ansätze zur Theorie der erlernten Hilflosigkeit.
- Die subjektive Wahrnehmung von Kontrolle und deren Einfluss auf das Handeln.
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: Die Einleitung führt anhand des Beispiels der Hochwasserkatastrophe in Ostdeutschland das zentrale Thema der Hausarbeit ein: den Verlust von Kontrolle und die daraus resultierende Hilflosigkeit. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zu behandelnden Aspekte: Definition von Kontrolle und Unkontrollierbarkeit, das Kontrollgrundbedürfnis und die verschiedenen Theorien zur erlernten Hilflosigkeit.
2.0 Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt konzentriert sich auf die Theorie der eigenen Wirksamkeit. Zunächst werden Kontrolle, Unkontrollierbarkeit und das Kontrollgrundbedürfnis definiert. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die erklären, warum Menschen Kontrolle anstreben und wie sie Kontrolle erlernen, wobei der Fokus auf dem instrumentellen Konditionieren liegt. Der zweite Abschnitt widmet sich der Hilflosigkeit als Reaktion auf Kontrollverlust. Hier steht die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman im Mittelpunkt, ergänzt durch attributionstheoretische Reformulierungen, das Reaktanz-Hilflosigkeits-Modell und ein 4-Stufen-Modell nach Flammer. Diese Erweiterungen beleuchten die Komplexität des Themas und zeigen die Grenzen der ursprünglichen Seligmanschen Theorie auf.
Schlüsselwörter
Kontrolle, Unkontrollierbarkeit, Kontrollgrundbedürfnis, erlernte Hilflosigkeit, Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung, Attributionstheorie, Reaktanz, Handlungskontrolle, subjektive Kontrolle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Kontrolle, Kontrollverlust und erlernte Hilflosigkeit
Was ist der Hauptfokus dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Kontrolle, Kontrollverlust und der daraus resultierenden Hilflosigkeit. Sie beleuchtet das Verständnis für den Begriff Kontrolle, die subjektive Wahrnehmung der eigenen Wirksamkeit und die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman, erweitert durch ergänzende Theorien.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von Kontrolle und Unkontrollierbarkeit, das Kontrollgrundbedürfnis des Menschen und seine lerntheoretischen Grundlagen (insbesondere instrumentelles Konditionieren), die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman, ergänzende und reformulierende Ansätze zur Theorie der erlernten Hilflosigkeit (attributionstheoretische Reformulierung, Reaktanz-Hilflosigkeits-Modell, 4-Stufen-Modell nach Flammer), die subjektive Wahrnehmung von Kontrolle und deren Einfluss auf das Handeln, sowie verschiedene Theorien zur eigenen Wirksamkeit (z.B. Rotter, Bandura).
Welche Theorien werden im Detail erläutert?
Die Hausarbeit erläutert im Detail die Theorie der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman und verschiedene ergänzende Theorien. Dazu gehören die Kontrollüberzeugungstheorie nach J. B. Rotter, die Selbstwirksamkeitstheorie nach Albert Bandura, attributionstheoretische Reformulierungen der Theorie der erlernten Hilflosigkeit, das Reaktanz-Hilflosigkeits-Modell und ein 4-Stufen-Modell nach Flammer.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: Einleitung, Hauptteil und Zusammenfassung. Der Hauptteil unterteilt sich in zwei Abschnitte: Die Theorie der eigenen Wirksamkeit (inkl. Kontrolle, Unkontrollierbarkeit, Kontrollgrundbedürfnis und verschiedene Ansätze zum Erlernen von Kontrolle) und Hilflosigkeit als Reaktion auf Kontrollverlust (inkl. der Theorie der erlernten Hilflosigkeit und deren Erweiterungen).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Kontrolle, Unkontrollierbarkeit, Kontrollgrundbedürfnis, erlernte Hilflosigkeit, Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung, Attributionstheorie, Reaktanz, Handlungskontrolle und subjektive Kontrolle.
Wie wird der Begriff "Kontrolle" in der Hausarbeit definiert?
Die Hausarbeit definiert den Begriff "Kontrolle" und seine verschiedenen Aspekte, untersucht das Kontrollgrundbedürfnis und beleuchtet, wie die subjektive Wahrnehmung von Kontrolle das Handeln beeinflusst. Die Definition wird im Kontext verschiedener Theorien (z.B. instrumentelles Konditionieren) erläutert.
Welche Beispiele werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Einleitung verwendet das Beispiel der Hochwasserkatastrophe in Ostdeutschland, um den Kontrollverlust und die daraus resultierende Hilflosigkeit zu veranschaulichen.
- Quote paper
- Kerstin Kloos (Author), 2002, Kontrolle und Hilflosigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37501