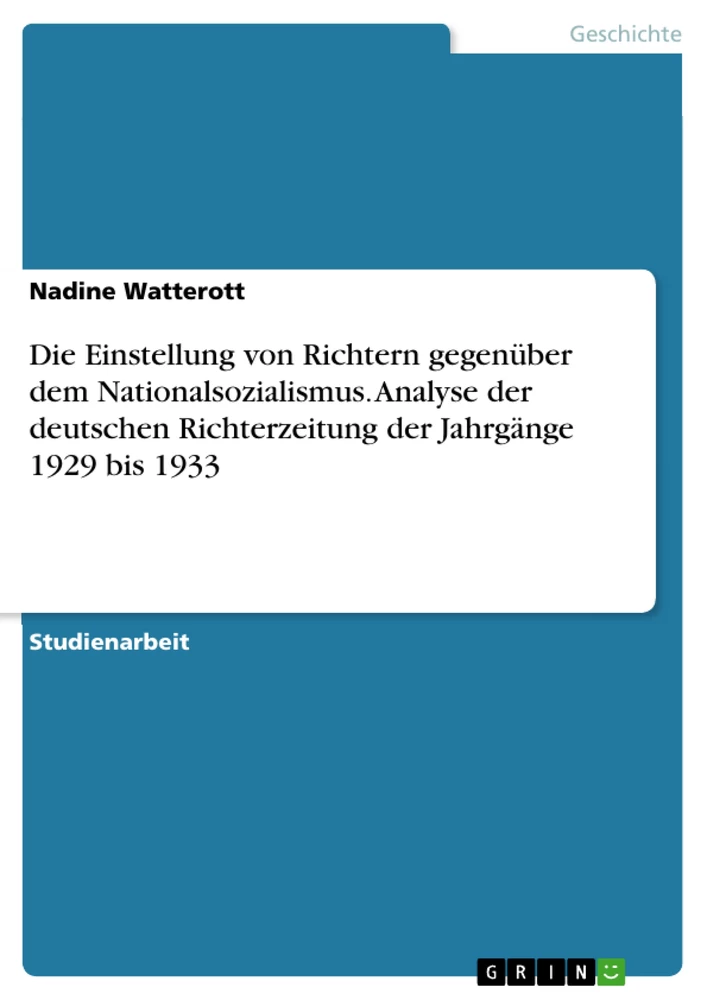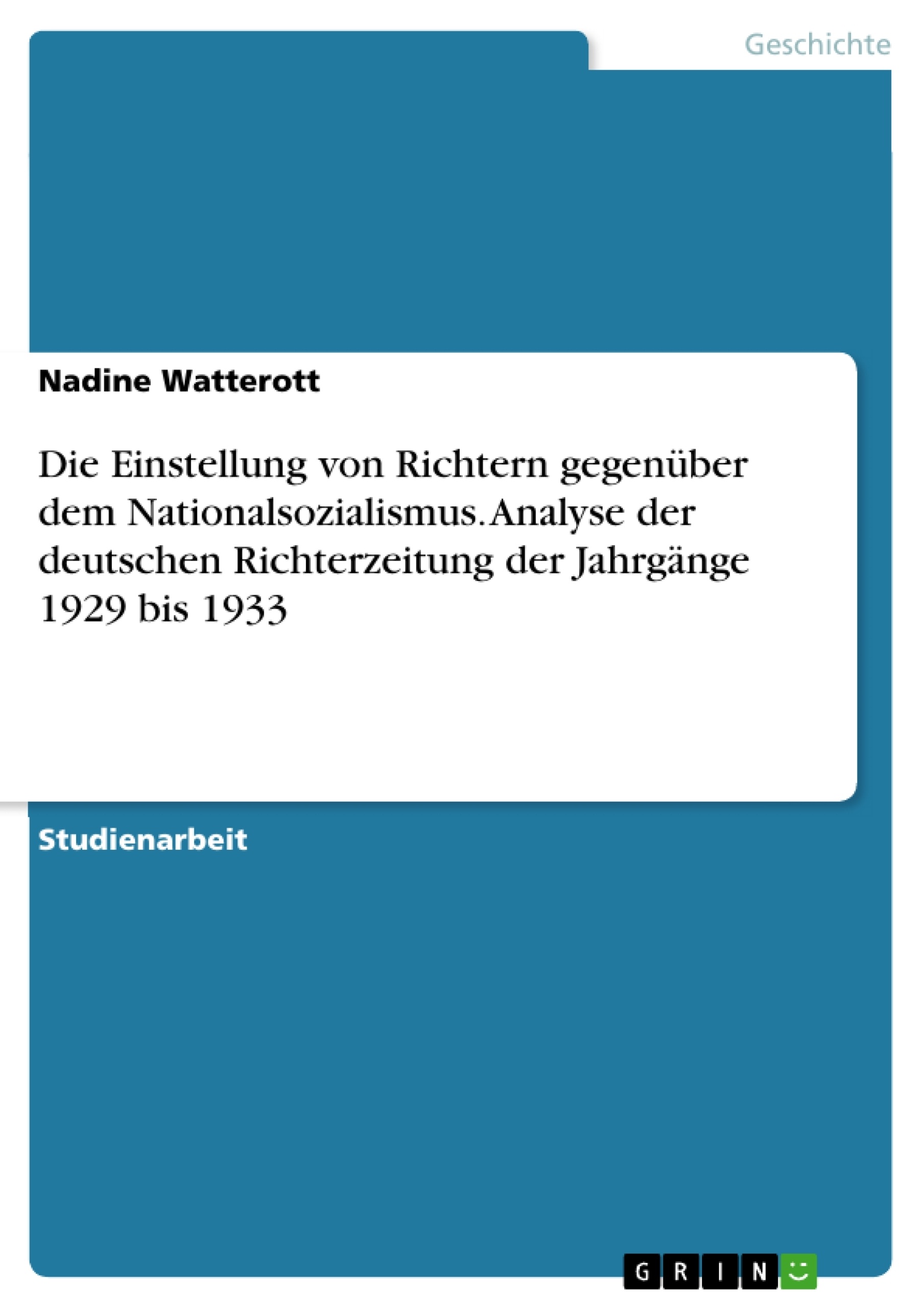Im heutigen Weltbild stehen Richter für Recht und Gesetz, vielleicht sogar Gerechtigkeit. Der Nationalsozialismus steht für Unrecht und Ungerechtigkeit. Dies wirft die Frage auf, wie Richter diesem Staat dienen und ihr Amt im Namen des Unrechts ausführen konnten. In der Forschung wird diskutiert inwieweit Richter im Nationalsozialismus, oder auch Juristen im Allgemeinen, Opfer ihrer eigenen Sozialisation und ihres eigenen Weltbildes waren.
In dieser Arbeit soll es darum gehen, wie die Richter zu der nationalsozialistischen Ideologie standen bzw. inwieweit ihre eigene Weltanschauung ihre Handlungsweise im Bezug zum Nationalsozialismus beeinflusste. Um dies herauszugfinden, wurden Artikel der „deutschen Richterzeitung“ der Jahrgänge 1929 bis 1933 auf Hinweise, über die Einstellung von Richtern zur Politik und ihrem eigenen Beruf, untersucht. Dabei wurden fünfzehn Artikel gefunden, die sich zu der Einstellung von Richtern äußern, auf fünf davon soll in dieser Arbeit näher eingegangen werden. Zusammen mit den Ergebnissen aus der Forschung soll am Ende ein begründetes Fazit gezogen werden, wie die Richter zum Nationalsozialismus standen bzw. inwieweit ihre Einstellung ihr Verhalten zum Nationalsozialismus beeinflusste.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsmeinungen zur Einstellung der Richter
- Beurteilung der Einstellung der Richter anhand Artikeln der ,,Deutschen Richterzeitung“.
- Die „Deutsche Richterzeitung“ aus den Jahrgängen 1929-1932.
- Die,,Deutsche Richterzeitung“ Jahrgang 1933...
- Fazit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Einstellung von Richtern zum Nationalsozialismus. Sie untersucht, wie Richter zu der nationalsozialistischen Ideologie standen und inwieweit ihre eigene Weltanschauung ihre Handlungsweise im Bezug zum Nationalsozialismus beeinflusste. Dafür werden Artikel der „deutschen Richterzeitung“ aus den Jahren 1929 bis 1933 analysiert, um Hinweise auf die Einstellung von Richtern zur Politik und ihrem eigenen Beruf zu finden.
- Die Rolle der Richter im Nationalsozialismus
- Die Einflussnahme der eigenen Weltanschauung auf die Handlungen von Richtern
- Die Analyse von Artikeln der „deutschen Richterzeitung“
- Die Bedeutung der richterlichen Unabhängigkeit und der Gewaltenteilung
- Der Rechtspositivismus und seine Auswirkungen auf die Justiz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Einstellung von Richtern zum Nationalsozialismus und die Relevanz der Analyse von Artikeln der „deutschen Richterzeitung“ dar. Das zweite Kapitel beleuchtet verschiedene Forschungsmeinungen zur Einstellung der Richter und ihren moralischen Prägungen. Es wird darauf hingewiesen, dass Richter im Nationalsozialismus keine homogene Gruppe waren, aber in ihrer Weltanschauung oft Gemeinsamkeiten aufwiesen, insbesondere durch einen konservativen Hintergrund und eine starke Betonung des Rechtspositivismus. Das dritte Kapitel analysiert die „Deutsche Richterzeitung“ und gliedert sich in zwei Abschnitte: 1929-1932 und 1933. Die Analyse des ersten Abschnitts zeigt, dass in diesem Zeitraum die Einstellung von Richtern zur Politik und ihrem Beruf geprägt war von einem hohen moralischen Anspruch auf Unabhängigkeit und dem Festhalten an den Prinzipien von Gesetzmäßigkeit und Gerechtigkeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie der Einstellung von Richtern zum Nationalsozialismus, der Rolle der Justiz im NS-Staat, der „deutschen Richterzeitung“ als Quelle für die Erforschung der richterlichen Weltanschauung, der Bedeutung der richterlichen Unabhängigkeit und der Gewaltenteilung, sowie dem Rechtspositivismus und seiner Auswirkungen auf die Justiz.
Häufig gestellte Fragen
Wie standen deutsche Richter zwischen 1929 und 1933 zum Nationalsozialismus?
Die Arbeit zeigt, dass viele Richter durch eine konservative Sozialisation und einen ausgeprägten Rechtspositivismus geprägt waren, was sie anfällig für die Ideologie des NS-Staates machte.
Welche Rolle spielt die „Deutsche Richterzeitung“ in dieser Analyse?
Die Fachzeitschrift dient als Primärquelle, um die öffentliche Meinung und das Selbstverständnis der Richterschaft in den entscheidenden Übergangsjahren von der Weimarer Republik zum NS-Regime zu untersuchen.
Was bedeutet Rechtspositivismus im Kontext der NS-Justiz?
Rechtspositivismus bedeutet das strikte Festhalten an geltenden Gesetzen ohne moralische Prüfung. Dies führte dazu, dass Richter auch Unrechtsgesetze der Nationalsozialisten ohne Widerstand ausführten.
Waren Richter im Nationalsozialismus Opfer oder Täter?
Die Forschung diskutiert, inwieweit Juristen Opfer ihrer eigenen Sozialisation waren. Die Arbeit kommt jedoch zu dem Schluss, dass ihre Weltanschauung ihr Handeln im Sinne des Regimes maßgeblich beeinflusste.
Wie veränderte sich die Haltung der Richterzeitung im Jahr 1933?
Während vor 1933 noch moralische Ansprüche an Unabhängigkeit dominierten, lässt sich ab 1933 eine Anpassung an die neuen politischen Realitäten und die nationalsozialistische Ideologie feststellen.
- Arbeit zitieren
- Nadine Watterott (Autor:in), 2016, Die Einstellung von Richtern gegenüber dem Nationalsozialismus. Analyse der deutschen Richterzeitung der Jahrgänge 1929 bis 1933, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375022