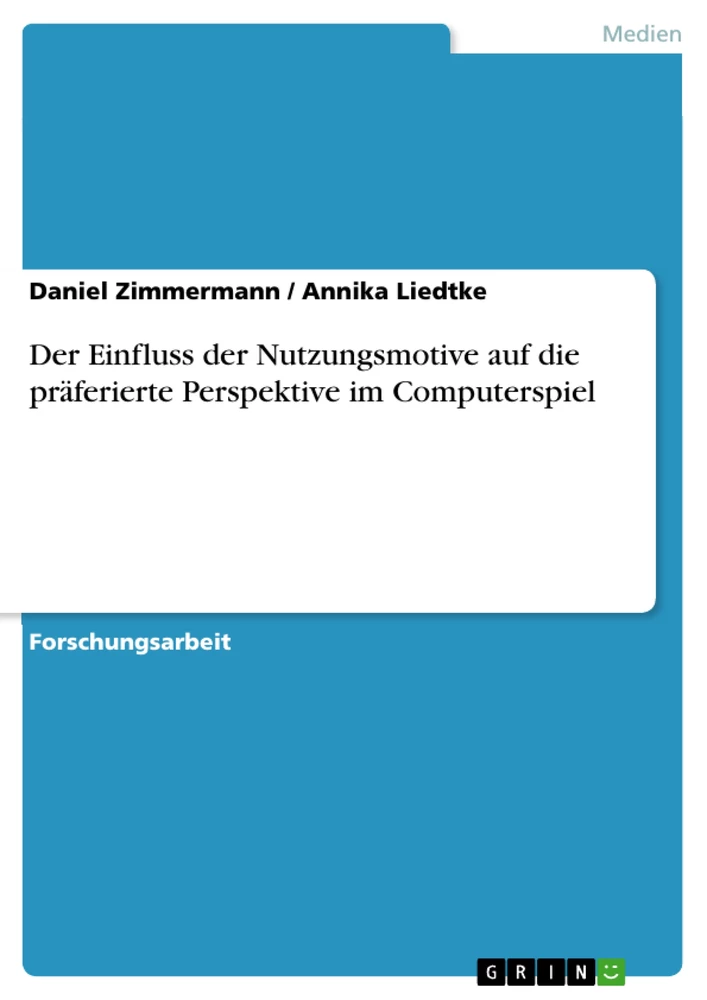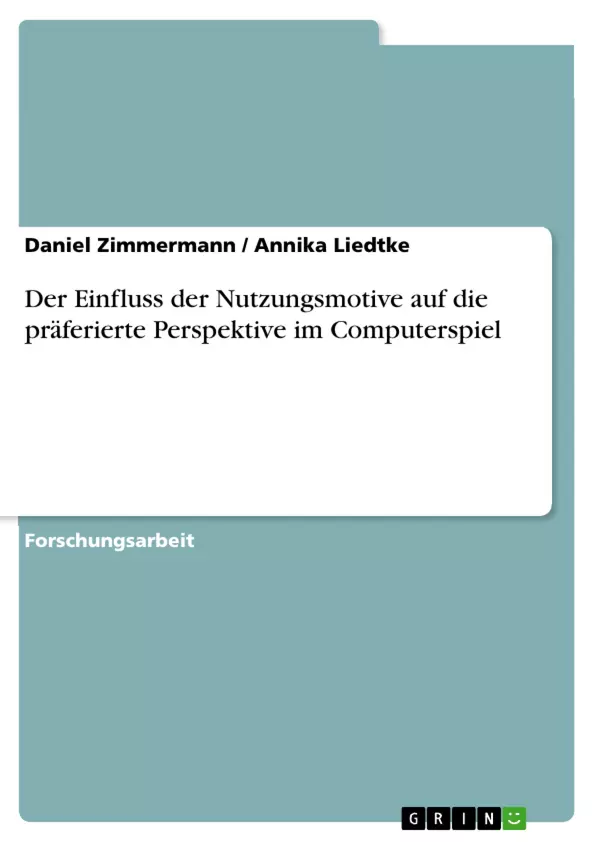Im Gegensatz zu älteren Medien zeichnet Games vor allem die Möglichkeit zur Interaktion aus. Dies zeigt sich bspw. in der Möglichkeit, den Ablauf des Spiels aktiv beeinflussen zu können oder in dem schlichten Umstand, dass ein Spiel nicht ohne das aktive Handeln des Spielers fortfahren kann. Die Interaktivität erstreckt sich aber auch auf Personalisierungsmöglichkeiten. Der Spieler kann bspw. die Steuerung an seine Vorlieben anpassen. Eine Studie belegt, dass Nutzer mit Fokus auf Wettbewerb mit anderen Spielern die Grafikeinstellungen des Games reduzieren, um auf diese Weise eine schnellere Berechnung der Grafik zu erreichen. Durch die zügigere Darstellung erhoffen sie sich einen Vorteil und belegen somit, dass Nutzer im Rahmen des Spiels gegebene Möglichkeiten nutzen, um dieses ihren Nutzungsmotiven anzupassen.
Die Autoren möchten in einem Versuch belegen, dass ein ähnliches Verhalten auch beim Wechseln der Perspektive zu beobachten ist. Da zu diesem speziellen Thema keinerlei Erkenntnisse vorliegen, muss jedoch zunächst herausgefunden werden, ob diese Möglichkeit überhaupt genutzt wird. Erst im Anschluss können mögliche Gründe für das Verhalten untersucht werden. Die primäre Vermutung dabei ist der Wechsel des Nutzungsmotivs. Nach diesem einführenden Umriss des anvisierten Forschungsfeldes lässt sich nun folgende Hypothese zusammenfassend formulieren:
Beim Computerspielen existieren Zusammenhänge zwischen präferierter Perspektive und dominantem Nutzungsmotiv.
Ziel der Arbeit ist es, diesen Zusammenhang genauer zu definieren und mit einem empirischen Versuch zu belegen. Dabei handelt es sich um eine Kombination quantitativer und qualitativer Methoden. Zentraler Bestandteil ist dabei ein Test, bei dem das Computerspielen untersucht werden soll. Dabei wird das Spielen desn Games Nascar ‘14 beobachtet, während Gesicht und Spielgeschehen aufgenommen werden. Vor der Nutzung werden Fragebögen beantwortet, abschließend erfolgt ein qualitatives Interview. Die genauere Beschreibung des Forschungsdesigns erfolgt in Kapitel vier.
Die gewonnenen Ergebnisse werden anschließend in Kapitel fünf mit den vorangestellten Vermutungen verglichen und Schlussfolgerungen gezogen. Das Fazit soll letztlich mit einem kritischem Blick auf die aktuelle Arbeit, Ausblick auf zukünftige Forschungstätigkeiten in diesem Umfeld geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Perspektiven im Computerspiel
- 2.1 First-Person Perspektive
- 2.2 Third-Person Perspektive
- 2.3 Schlussfolgerung
- 2.4 Anwendung auf das Forschungsvorhaben
- 3. Nutzungsmotivation
- 3.1 Uses-and-Gratifications-Approach
- 3.2 Nutzungsmotive
- 3.3 Herleitung eigener Nutzungsmotive
- 4. Die Untersuchung
- 4.1 Methode
- 4.1.1 Phase 1
- 4.1.2 Phase 2
- 4.1.3 Phase 3
- 4.2 Hypothese
- 4.3 Auswertung
- 4.4 Kritik
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Frage, welche Faktoren die Wahl der Perspektive in Computerspielen beeinflussen. Die Arbeit zielt darauf ab, empirische Erkenntnisse über die Präferenzen von Spielern in Bezug auf First-Person und Third-Person Perspektiven zu gewinnen. Die Analyse der Einflussfaktoren auf die Perspektivenwahl soll zu einem besseren Verständnis der Spielerbedürfnisse und -präferenzen beitragen.
- Analyse der Präferenzen von Spielern in Bezug auf First-Person und Third-Person Perspektiven
- Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Perspektivenwahl
- Bedeutung der Perspektivenwahl für die Gestaltung von Computerspielen
- Nutzungsmotivationen von Spielern und deren Einfluss auf die Perspektivenwahl
- Entwicklung eines Modells zur Erklärung der Perspektivenwahl
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik und stellt die Problemstellung der Perspektivenwahl in Computerspielen dar. Es wird auf die zunehmenden Ressourcenaufwendungen bei der Entwicklung von AAA-Titeln hingewiesen und die Notwendigkeit empirisch belegter Erkenntnisse für Designentscheidungen betont.
Kapitel zwei beleuchtet verschiedene Perspektiven im Computerspiel, wobei First-Person und Third-Person Perspektiven im Detail betrachtet werden. Es werden die Vor- und Nachteile beider Perspektiven diskutiert sowie die Bedeutung für das Spielerlebnis beleuchtet.
In Kapitel drei wird die Nutzungsmotivation von Spielern anhand des Uses-and-Gratifications-Approach erforscht. Es werden verschiedene Motivgruppen vorgestellt und deren Relevanz für die Perspektivenwahl untersucht.
Kapitel vier beschreibt die durchgeführte Untersuchung, die in drei Phasen unterteilt ist. Es werden die Methodik, die Hypothesenbildung sowie die Auswertung der Ergebnisse dargestellt. Darüber hinaus werden kritische Aspekte der Untersuchung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Computerspiele, Perspektivenwahl, First-Person Perspektive, Third-Person Perspektive, Uses-and-Gratifications-Approach, Nutzungsmotivation, empirische Forschung, Spielerpräferenzen, Designentscheidungen, AAA-Titel.
Häufig gestellte Fragen
Welche Spielperspektiven werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Vergleich zwischen der First-Person-Perspektive (Ich-Perspektive) und der Third-Person-Perspektive (Draufsicht/Verfolgerperspektive).
Welchen Einfluss haben Nutzungsmotive auf die Perspektivenwahl?
Es wird die Hypothese untersucht, dass Spieler je nach ihrem dominanten Motiv (z.B. Wettbewerb oder Immersion) eine bestimmte Kameraperspektive bevorzugen.
Was ist der „Uses-and-Gratifications-Approach“?
Ein theoretischer Ansatz, der fragt, warum Menschen bestimmte Medien nutzen und welche Bedürfnisse oder Belohnungen (Gratifikationen) sie daraus ziehen.
Welches Spiel wurde für den empirischen Versuch genutzt?
Für die Untersuchung wurde das Rennspiel „Nascar ‘14“ verwendet.
Wie wurde das Spielerverhalten in der Studie beobachtet?
Die Forscher nahmen sowohl das Spielgeschehen als auch die Mimik der Spieler auf und kombinierten dies mit Fragebögen und qualitativen Interviews.
Warum passen Wettbewerbs-Spieler oft ihre Grafikeinstellungen an?
Um eine schnellere Bildberechnung zu erzielen, was ihnen einen zeitlichen Vorteil gegenüber Gegnern verschaffen kann.
- Citation du texte
- Daniel Zimmermann (Auteur), Annika Liedtke (Auteur), 2015, Der Einfluss der Nutzungsmotive auf die präferierte Perspektive im Computerspiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375102