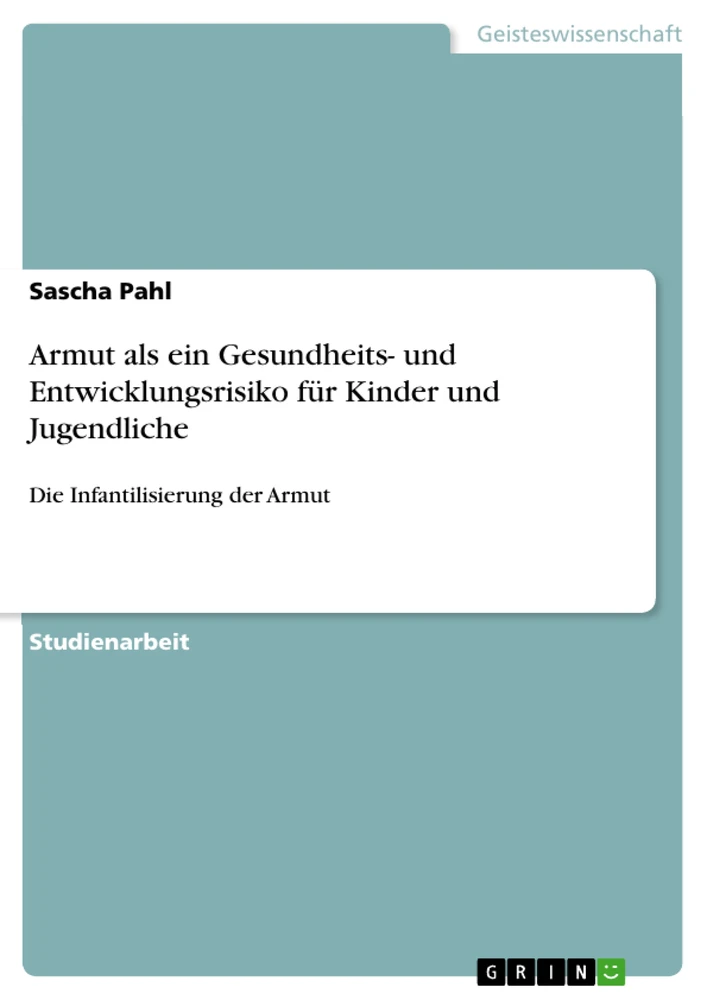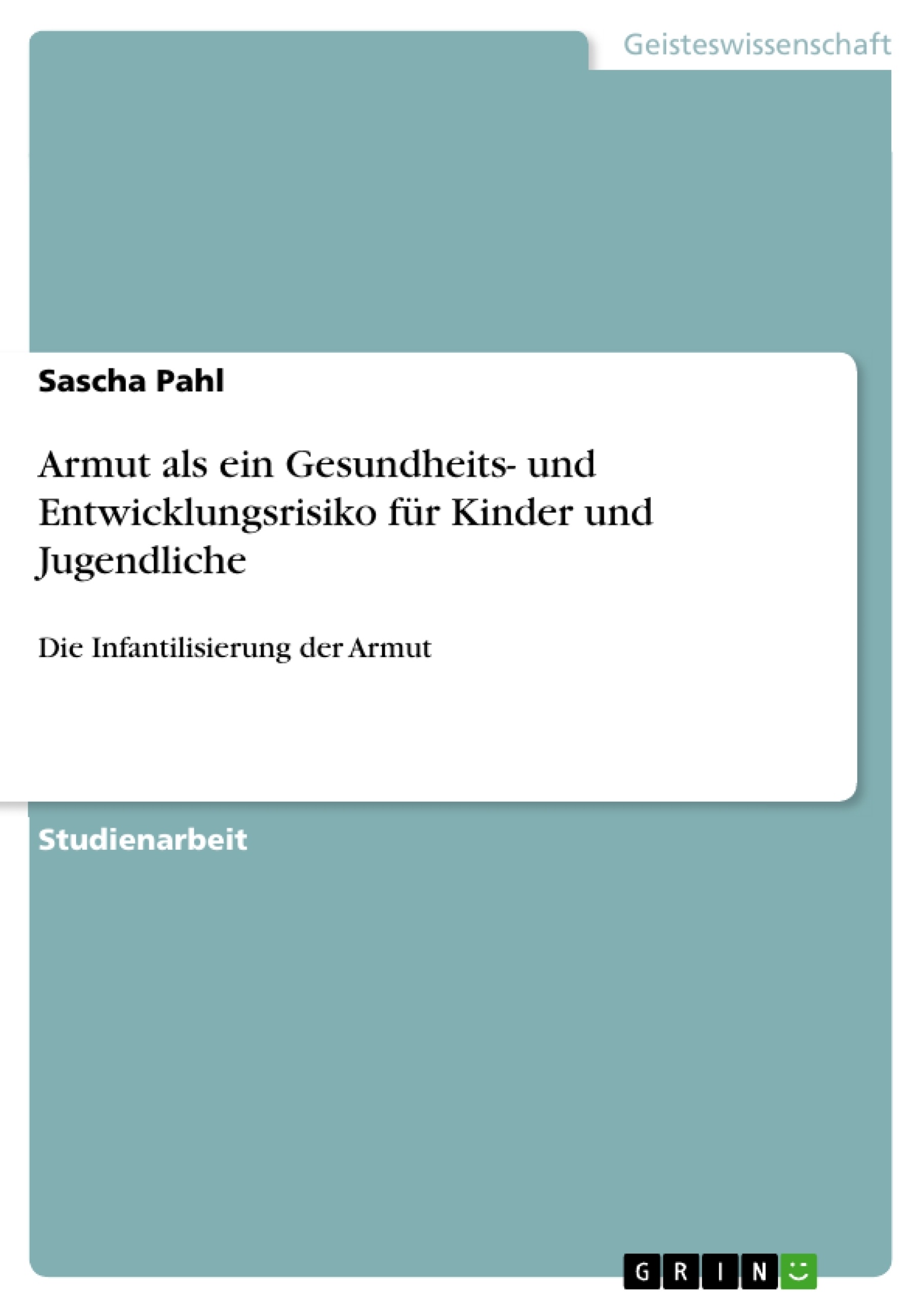Die vorliegende Hausarbeit soll der Fragestellung nachgehen, was Armut bedeutet, welche Auswirkung sie auf die Gesundheit und die Entwicklung von Kindern hat und welche Präventions- bzw. Interventionsmöglichkeiten sich für die Soziale Arbeit ergeben. Zunächst erfolgt eine Definition des Armutsbegriffs im Sinne der Armutsforschung. Daraufhin werden verschiedene Armutskonzepte vorgestellt. Im Anschluss wird der Zusammenhang zwischen Armut und deren Auswirkung auf die Gesundheit und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beschrieben. Hierbei wird besonders auf die Aspekte der Ernährung und Bewegung eingegangen, sowie auf Folgen für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Danach werden die Möglichkeiten für die Soziale Arbeit skizziert, präventiv und intervenierend tätig zu sein. Dies wird anhand des Beispiels des Dormagener Modells veranschaulicht.
Mit dem Rückgang der Nachkriegsarmut, nach Beendigung des zweiten Weltkrieges, ist das Thema der Armut in Deutschland von der Sozialwissenschaft längere Zeit nicht mehr mit Nachdruck diskutiert und erforscht. Armut verschwand zunehmend aus dem öffentlichen Diskurs. Eine intensivere Beschäftigung mit der sogenannten „neuen Armut“ begann erst in den 1980er Jahren. Es kam zunehmend zu einer Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. Zu dieser gesellschaftlichen Polarisierung trugen im wesentlichen Globalisierungsprozesse, die Deregulierung des Arbeitsmarktes sowie der Rückzug des Sozialstaates aus der Sicherung in besonderen Lebenslagen bei. Dies betraf nicht nur die ärmeren Entwicklungsländer sondern auch die vermeintlich reichen, westlichen Staaten. genannten Gruppen zugehörig sind. Kinder und Jugendliche sind überproportional häufig von Armut betroffen. Man spricht hier von einer „Infantilisierung von Armut“. Ihre Armut ist eng mit der ihrer Eltern verbunden. Es entsteht ein Mangel an Teilhabe- und Verwirklichungschancen. Die damit einhergehenden Marginalisierung- und Exklusionsprozesse wirken sich in besonderem Maße auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen aus. Arm zu sein bedeutet von daher mehr als kein Geld zu haben. Es hat erheblichen Einfluss auf die Alltagsgestaltung in den Bereichen der materiellen Grundversorgung, Freizeit und Kultur, Bildung, soziale Integration und vor allem der Gesundheit. Hieraus lässt sich ableiten, dass sich bei Kinder und Jugendlichen zusätzlich Entwicklungsdefizite und soziale Benachteiligungen zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärungen/Definitionen
- 2.1 Armut im Sinne der Armutsforschung
- 2.2 Armutsbegriffe
- 2.2.1 Armut gemäß dem Lebenslagenkonzept
- 2.2.2 Das Konzept der Verwirklichungschancen
- 2.2.3 Armut gemäß dem Deprivationsansatz
- 2.2.4 Das „kindgerechte“ Armutskonzept
- 3. Die Bedeutung von Armut für Kinder und Jugendliche
- 4. Der Zusammenhang von Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
- 4.1 Auswirkung von Kinderarmut auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten
- 4.2 Die Auswirkung von Armut auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- 5. Prävention und Intervention durch soziale Arbeit
- 5.1 Sozialraumorientierte Gemeinwesenarbeit
- 5.2 Das Dormagener Modell der Armutsprävention
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Sie beleuchtet den Begriff der Armut aus unterschiedlichen Perspektiven der Armutsforschung und analysiert den Zusammenhang zwischen Armut und den beschriebenen Auswirkungen. Die Arbeit skizziert zudem präventive und intervenierende Möglichkeiten der Sozialen Arbeit.
- Definition und Konzepte von Armut
- Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Einfluss von Armut auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Präventive und intervenierende Strategien der Sozialen Arbeit
- Analyse des Dormagener Modells der Armutsprävention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Armutsdebatte in Deutschland dar und hebt den zunehmenden Fokus auf die "neue Armut" in den 1980er Jahren hervor. Sie führt die gesellschaftliche Polarisierung und die damit verbundenen Risikogruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche, ein. Die Arbeit formuliert die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung von Armut, ihren Auswirkungen auf Kinder und die Möglichkeiten der Sozialen Arbeit im Umgang damit.
2. Begriffsklärungen/Definitionen: Dieses Kapitel definiert den Armutsbegriff anhand der Definition der Europäischen Kommission, wobei materielle, kulturelle und soziale Ressourcen betrachtet werden. Es differenziert zwischen relativer und absoluter Armut, sowie primärer, sekundärer und tertiärer Armut, und betont die Bedeutung der Unterscheidung zwischen objektiv und subjektiv empfundener Armut. Das Kapitel erläutert verschiedene Armutskonzepte und die damit verbundenen Messmethoden.
3. Die Bedeutung von Armut für Kinder und Jugendliche: Dieses Kapitel beleuchtet die überproportionale Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen durch Armut ("Infantilisierung der Armut"). Es wird hervorgehoben, dass Armut weit über den Mangel an Geld hinausgeht und gravierende Auswirkungen auf die Teilhabemöglichkeiten und die Entwicklung von Kindern hat. Die fehlende Integration in verschiedene Lebensbereiche wird als zentrale Problematik dargestellt.
4. Der Zusammenhang von Armut und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen: Dieses Kapitel untersucht den direkten Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit. Es konzentriert sich auf die Auswirkungen von Kinderarmut auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten sowie auf die allgemeine Entwicklung. Es wird deutlich gemacht, dass Kinder aus benachteiligten Familien verstärkt unter Übergewicht leiden und Schwierigkeiten in sozialen Kontexten haben.
5. Prävention und Intervention durch soziale Arbeit: Dieses Kapitel präsentiert Möglichkeiten für die Soziale Arbeit, präventiv und intervenierend gegen Kinderarmut vorzugehen. Es wird das Beispiel der sozialraumorientierten Gemeinwesenarbeit und des Dormagener Modells der Armutsprävention als konkrete Beispiele für erfolgreiche Strategien zur Armutsbekämpfung eingeführt und deren Ansatz erläutert.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Armutsforschung, Armutskonzepte, soziale Ungleichheit, Gesundheit, Entwicklung, Soziale Arbeit, Prävention, Intervention, Dormagener Modell, soziale Exklusion, Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Auswirkungen von Armut auf Kinder und Jugendliche
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Sie beleuchtet den Armutsbegriff aus verschiedenen Perspektiven der Armutsforschung, analysiert den Zusammenhang zwischen Armut und ihren Auswirkungen und skizziert präventive und intervenierende Möglichkeiten der Sozialen Arbeit. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Begriffsklärungen, der Bedeutung von Armut für Kinder und Jugendliche, dem Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit, Prävention und Intervention durch Soziale Arbeit sowie ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Armutsbegriffe und -konzepte werden behandelt?
Die Arbeit definiert Armut anhand der Definition der Europäischen Kommission, betrachtet materielle, kulturelle und soziale Ressourcen und differenziert zwischen relativer und absoluter Armut sowie primärer, sekundärer und tertiärer Armut. Sie erläutert verschiedene Armutskonzepte wie das Lebenslagenkonzept, das Konzept der Verwirklichungschancen, den Deprivationsansatz und ein „kindgerechtes“ Armutskonzept. Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen objektiv und subjektiv empfundener Armut wird betont.
Wie wirkt sich Armut auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus?
Die Hausarbeit zeigt die überproportionale Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen durch Armut auf und betont, dass Armut weit über den Mangel an Geld hinausgeht. Sie beschreibt gravierende Auswirkungen auf die Teilhabemöglichkeiten und die Entwicklung von Kindern, insbesondere die Auswirkungen auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten, und die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Übergewicht und Schwierigkeiten in sozialen Kontexten bei Kindern aus benachteiligten Familien.
Welche präventiven und intervenierenden Strategien der Sozialen Arbeit werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Möglichkeiten für die Soziale Arbeit, präventiv und intervenierend gegen Kinderarmut vorzugehen. Sie beschreibt die sozialraumorientierte Gemeinwesenarbeit und das Dormagener Modell der Armutsprävention als konkrete Beispiele für erfolgreiche Strategien zur Armutsbekämpfung und erläutert deren Ansatz.
Was ist das Dormagener Modell der Armutsprävention?
Das Dormagener Modell wird als ein konkretes Beispiel für eine erfolgreiche Strategie zur Armutsbekämpfung vorgestellt. Die Hausarbeit erläutert den Ansatz dieses Modells, jedoch werden die genauen Details nicht im Detail beschrieben. Weitere Informationen müssten aus anderen Quellen bezogen werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Kinderarmut, Armutsforschung, Armutskonzepte, soziale Ungleichheit, Gesundheit, Entwicklung, Soziale Arbeit, Prävention, Intervention, Dormagener Modell, soziale Exklusion, Teilhabe.
- Citar trabajo
- Sascha Pahl (Autor), 2014, Armut als ein Gesundheits- und Entwicklungsrisiko für Kinder und Jugendliche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375127