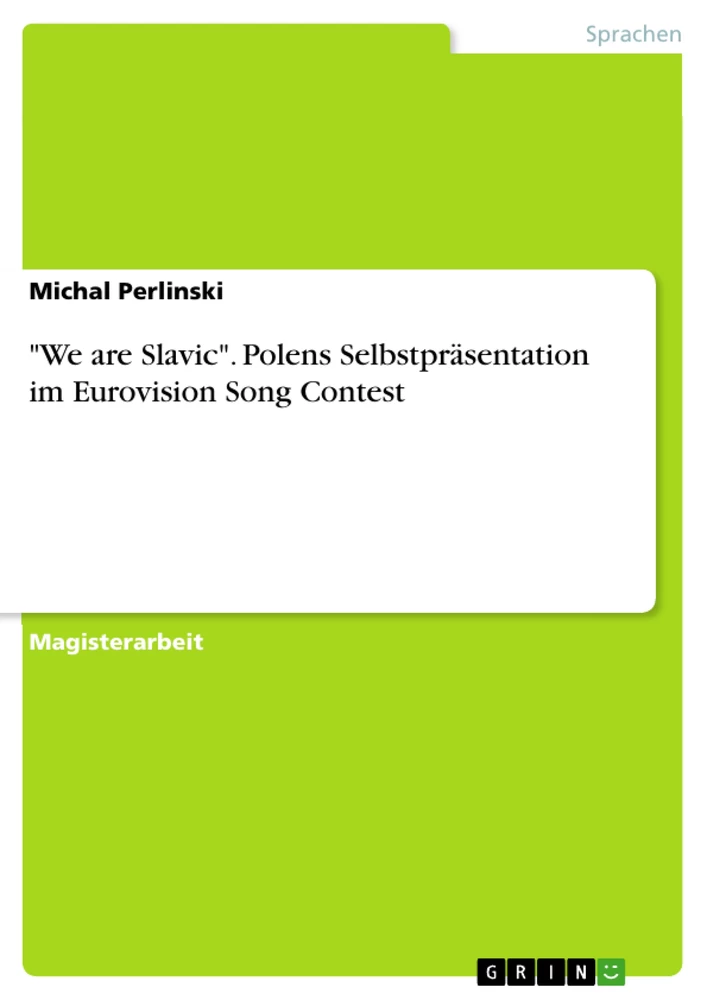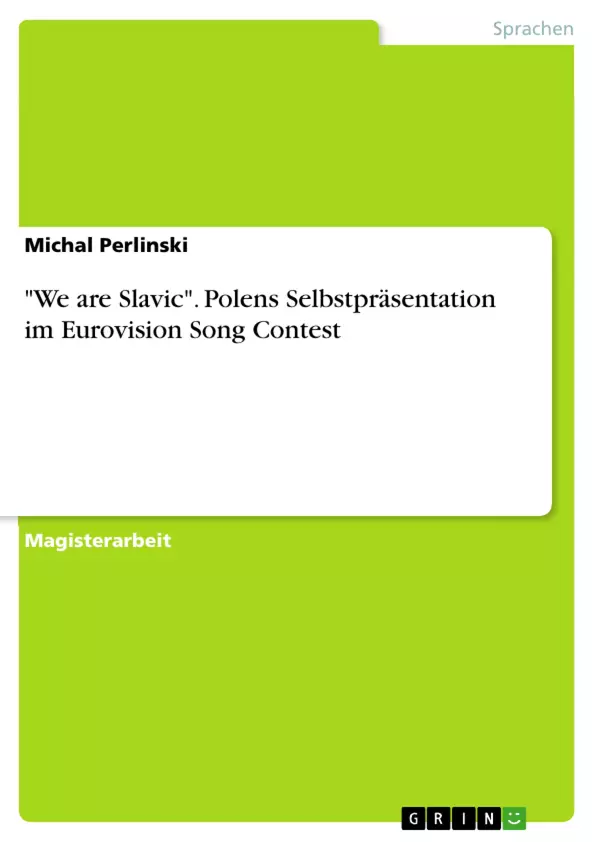Da die vorliegende Arbeit im Rahmen der slavischen Philologie verfasst worden ist, liegt die kultur- und medienwissenschaftliche Auseinandersetzung im Mittelpunkt. Genauer gesagt soll es um Polens Selbstpräsentation im ESC gehen. Welche Mittel der Selbstpräsentation werden im Wettbewerbsvortrag verwendet? Welche Themen werden im Liedtext angesprochen und in welcher Sprache ist dieser verfasst? Findet etwa eine musikalische Angleichung an das restliche Europa oder doch eher eine Abgrenzung statt? Was lässt sich in Bezug auf die Geschlechterrollen der polnischen Bühnenauftritte feststellen? Lassen sich die analysierten Wettbewerbsbeiträge Polens in bestimmte Gruppen einteilen und nach welchen Erkennungsmerkmalen ist dies möglich? Wie verhält es sich mit dem Selbst- und Fremdbild Polens, das auf der Bühne transportiert wird? Dies sind meine wissenschaftlichen Kernfragen, die ich in der vorliegenden Arbeit erforschen möchte.
Die meisten Videoclips und Bühnenauftritte sind über Youtube oder andere digitale Plattformen im Internet abrufbar. Nach einer ganz kurzen historischen Gesamtdarstellung des ESC, die als Basiswissen für die weiteren Kapitel dienen soll, beleuchte ich näher das Wesen der Nation, bevor ihre Rolle im Kontext des ESC weiter erörtert wird. Hierbei habe ich auf Standardwerke wie Imagined Communities von Benedict Anderson oder The Invention of Traditions und Nation and Nationalism since 1780 von Eric J. Hobsbawm zurückgegriffen. Anschließend analysiere ich einige von mir persönlich ausgewählte Auftritte Polens beim ESC, um auf deren Basis zu einem Ergebnis der oben aufgeführten Leitfragen zu kommen. Im letzten Kapitel gehe ich auch auf die mediale Berichterstattung und Wahrnehmung der polnischen Auftritte und ihrer Platzierungen ein. Zitate aus der medialen Berichterstattung sowie Kommentare von Zuschauern nach dem Wettbewerb runden die Arbeit schließlich ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Bisheriger Forschungsstand
- 3 Der Eurovision Song Contest
- 3.1 Die Entstehung des Eurovision Song Contest
- 3.1.1 Die EBU (European Broadcasting Union)
- 3.1.2 Das San-Remo-Festival als Vorbild
- 3.2 Historischer Überblick
- 3.2.1 Auftritte: Orchester vs. Playback
- 3.2.2 Sprachenwahl: Englisch vs. Landessprache
- 3.2.3 Abstimmung: Jury vs. Televoting
- 3.3 Der ESC als Mittel nationaler und kultureller Selbstpräsentation
- 3.1 Die Entstehung des Eurovision Song Contest
- 4 Der Einzug Osteuropas in den ESC
- 4.1 Auswirkungen auf den ESC
- 4.1.1 Veränderungen im Regelwerk der EBU
- 4.1.2 Abstimmungsverhalten
- 4.2 Der ESC als Chance und Prestige für die osteuropäischen Teilnehmerländer
- 4.1 Auswirkungen auf den ESC
- 5 Polnische Auftritte beim ESC
- 5.1 Vorstellung der analytischen Methode
- 5.2 Analyse einiger Auftritte
- 5.2.1 Edyta Górniak (1994)
- 5.2.2 Justyna Steczkowska (1995)
- 5.2.3 Ich Troje (2003)
- 5.2.4 Iwan & Delfin (2005)
- 5.2.5 Marcin Mroziński (2010)
- 5.2.6 Cleo & Donatan (2014)
- 5.2.7 Monika Kuszyńska (2015)
- 5.3 Ergebnisse
- 5.3.1 Das Genderbild Polens im Wandel
- 5.3.2 Das Bild Polens als Nation - Selbstpräsentation und Wahrnehmung
- 6 Die mediale Berichterstattung
- 6.1 Die 1990er Jahre - Euphorie und Begeisterung der Polen
- 6.2 Das neue Jahrtausend – Schwindendes Interesse und negative Schlagzeilen
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Polens Selbstpräsentation im Eurovision Song Contest (ESC). Ziel ist es, die verwendeten Mittel der Selbstinszenierung, die im Liedtext behandelten Themen und die Wahl der Sprache zu analysieren. Es wird untersucht, ob eine Angleichung an oder Abgrenzung von Europa stattfindet und welche Geschlechterrollen in den polnischen Auftritten dargestellt werden. Die Arbeit sucht nach Gruppen von Beiträgen mit gemeinsamen Erkennungsmerkmalen und analysiert das Selbst- und Fremdbild Polens, das auf der Bühne transportiert wird.
- Polens Selbstinszenierung im ESC
- Analyse der Liedtexte und der Wahl der Sprache
- Angleichung an oder Abgrenzung von Europa
- Darstellung von Geschlechterrollen in polnischen ESC-Beiträgen
- Das Selbst- und Fremdbild Polens im ESC
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der polnischen Selbstpräsentation im Eurovision Song Contest ein und stellt die zentralen Forschungsfragen vor. Sie erläutert den kulturwissenschaftlichen Ansatz der Arbeit und skizziert den Aufbau, der die historische Entwicklung des ESC, die nationale Identität Polens, die Analyse ausgewählter polnischer ESC-Beiträge und die mediale Berichterstattung umfasst. Die Forschungsfragen fokussieren auf die Mittel der Selbstpräsentation in den Auftritten, die im Liedtext behandelten Themen, die Sprachenwahl, musikalische Angleichung oder Abgrenzung, die Darstellung von Geschlechterrollen, die Einordnung der Beiträge in Gruppen und das Selbst- und Fremdbild Polens, das auf der Bühne vermittelt wird.
2 Bisheriger Forschungsstand: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den bisherigen Forschungsstand zum Eurovision Song Contest. Es zeigt, dass der ESC erst in jüngster Zeit verstärkt Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung geworden ist und hebt wichtige Werke hervor, die sich mit verschiedenen Aspekten des Wettbewerbs befassen, von der Fankultur bis hin zur nationalen Repräsentation. Besonderes Augenmerk wird auf die wenigen Arbeiten gelegt, die sich mit osteuropäischen Ländern und insbesondere mit Polen im ESC auseinandersetzen. Die Kapitel zeigt die Lücke der Forschung zum Thema Polen im ESC und begründet damit die Notwendigkeit dieser Arbeit.
3 Der Eurovision Song Contest: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die Entstehung und die Entwicklung des Eurovision Song Contest. Es skizziert die Rolle der European Broadcasting Union (EBU) und die Inspiration durch das San Remo Festival. Der historische Überblick umfasst Veränderungen im Regelwerk, in der Musikdarbietung (Orchester vs. Playback) und in der Abstimmungsmethode (Jury vs. Televoting). Der Fokus liegt auf der Funktion des ESC als Mittel nationaler und kultureller Selbstpräsentation.
4 Der Einzug Osteuropas in den ESC: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Auswirkungen des Einzugs osteuropäischer Länder in den ESC. Es beleuchtet Veränderungen im Regelwerk der EBU, das Abstimmungsverhalten und die Bedeutung des Wettbewerbs als Chance und Prestige für die teilnehmenden Länder Osteuropas. Die Veränderungen, die mit dem Eintritt der osteuropäischen Länder einhergingen, werden im Kontext der nationalen und kulturellen Repräsentation analysiert. Die Kapitel verdeutlicht den Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen für die Teilnehmer.
5 Polnische Auftritte beim ESC: Dieses Kapitel beschreibt die angewandte Methode zur Analyse polnischer ESC-Beiträge. Es folgt eine detaillierte Analyse ausgewählter Auftritte, die die Entwicklung des polnischen Selbstbildes und der Darstellung nationaler Identität im Laufe der Zeit illustriert. Dabei werden die Beiträge im Kontext der jeweiligen Zeitumstände interpretiert. Die Ergebnisse beziehen sich auf das Genderbild Polens und die Selbst- und Fremdwahrnehmung des Landes. Dieses Kapitel bildet das Kernstück der Arbeit.
6 Die mediale Berichterstattung: In diesem Kapitel wird die mediale Berichterstattung über polnische ESC-Teilnahmen in den 1990er Jahren und im neuen Jahrtausend analysiert. Es werden die unterschiedlichen Reaktionen und die Entwicklung des öffentlichen Interesses und der medialen Wahrnehmung im Laufe der Zeit aufgezeigt, wobei sowohl positive als auch negative Berichterstattungen berücksichtigt werden. Das Kapitel beleuchtet den Einfluss der Medien auf die nationale Identität und die Wahrnehmung des Landes im europäischen Kontext.
Schlüsselwörter
Eurovision Song Contest, Polen, nationale Identität, Selbstpräsentation, kulturelle Repräsentation, Geschlechterrollen, Medienberichterstattung, Osteuropa, Musikwettbewerb, nationale Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der polnischen Selbstpräsentation im Eurovision Song Contest
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die polnische Selbstpräsentation im Eurovision Song Contest (ESC) und untersucht die verwendeten Mittel der Selbstinszenierung, die im Liedtext behandelten Themen, die Sprachenwahl und die Darstellung von Geschlechterrollen in den polnischen Beiträgen. Es wird geprüft, ob eine Angleichung an oder Abgrenzung von Europa stattfindet und welches Selbst- und Fremdbild Polens auf der Bühne transportiert wird.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Bisheriger Forschungsstand, Der Eurovision Song Contest, Der Einzug Osteuropas in den ESC, Polnische Auftritte beim ESC, Die mediale Berichterstattung und Fazit. Jedes Kapitel beleuchtet einen spezifischen Aspekt der polnischen Teilnahme am ESC und trägt zur Gesamtinterpretation bei.
Wie wird die polnische Selbstpräsentation im ESC untersucht?
Die Analyse der polnischen Selbstpräsentation erfolgt durch eine detaillierte Untersuchung ausgewählter polnischer ESC-Beiträge. Hierbei werden die Liedtexte, die Bühneninszenierung, die Sprachenwahl und die mediale Berichterstattung analysiert, um die Strategien der Selbstinszenierung und die damit verbundene Botschaftsvermittlung zu verstehen. Die Analyse berücksichtigt den historischen Kontext und die Entwicklung des Selbstbildes Polens im Laufe der Zeit.
Welche konkreten Aspekte der polnischen Auftritte werden analysiert?
Die Analyse umfasst die verwendeten Mittel der Selbstinszenierung, die im Liedtext behandelten Themen, die Wahl der Sprache (Englisch vs. Polnisch), die Darstellung von Geschlechterrollen, die musikalische Angleichung an oder Abgrenzung von europäischen Trends und die Einordnung der Beiträge in Gruppen mit gemeinsamen Erkennungsmerkmalen.
Welche konkreten polnischen ESC-Beiträge werden analysiert?
Die Arbeit analysiert ausgewählte polnische ESC-Beiträge, darunter Auftritte von Edyta Górniak (1994), Justyna Steczkowska (1995), Ich Troje (2003), Iwan & Delfin (2005), Marcin Mroziński (2010), Cleo & Donatan (2014) und Monika Kuszyńska (2015). Diese Auswahl dient der Illustration der Entwicklung der polnischen Selbstpräsentation im Laufe der Zeit.
Welche Rolle spielt die mediale Berichterstattung in der Analyse?
Die mediale Berichterstattung über die polnischen ESC-Teilnahmen wird ebenfalls analysiert, um die öffentliche Wahrnehmung der Beiträge und den Einfluss der Medien auf die nationale Identität und das Selbstbild Polens zu beleuchten. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Berichterstattung in den 1990er Jahren und im neuen Jahrtausend.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert Ergebnisse zum Genderbild Polens im Wandel, zum Bild Polens als Nation – sowohl Selbstpräsentation als auch Wahrnehmung – und zur Entwicklung des öffentlichen Interesses und der medialen Wahrnehmung der polnischen ESC-Teilnahmen im Laufe der Zeit. Die Analyse identifiziert Gruppen von Beiträgen mit gemeinsamen Erkennungsmerkmalen und analysiert das Selbst- und Fremdbild Polens, das auf der Bühne transportiert wird.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit schließt eine Forschungslücke, indem sie sich detailliert mit der polnischen Selbstpräsentation im Eurovision Song Contest auseinandersetzt. Es gibt nur wenige Arbeiten, die sich explizit mit der Darstellung nationaler Identität und kultureller Repräsentation Polens im ESC befassen.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine kulturwissenschaftliche Methode, die eine detaillierte Analyse der Liedtexte, der Bühneninszenierung, der Sprachenwahl und der medialen Berichterstattung kombiniert. Der interpretative Ansatz berücksichtigt den historischen Kontext und die jeweilige Situation der polnischen Beiträge im Wettbewerb.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt dieser Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Eurovision Song Contest, Polen, nationale Identität, Selbstpräsentation, kulturelle Repräsentation, Geschlechterrollen, Medienberichterstattung, Osteuropa, Musikwettbewerb, nationale Wahrnehmung.
- Quote paper
- Michal Perlinski (Author), 2016, "We are Slavic". Polens Selbstpräsentation im Eurovision Song Contest, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375230