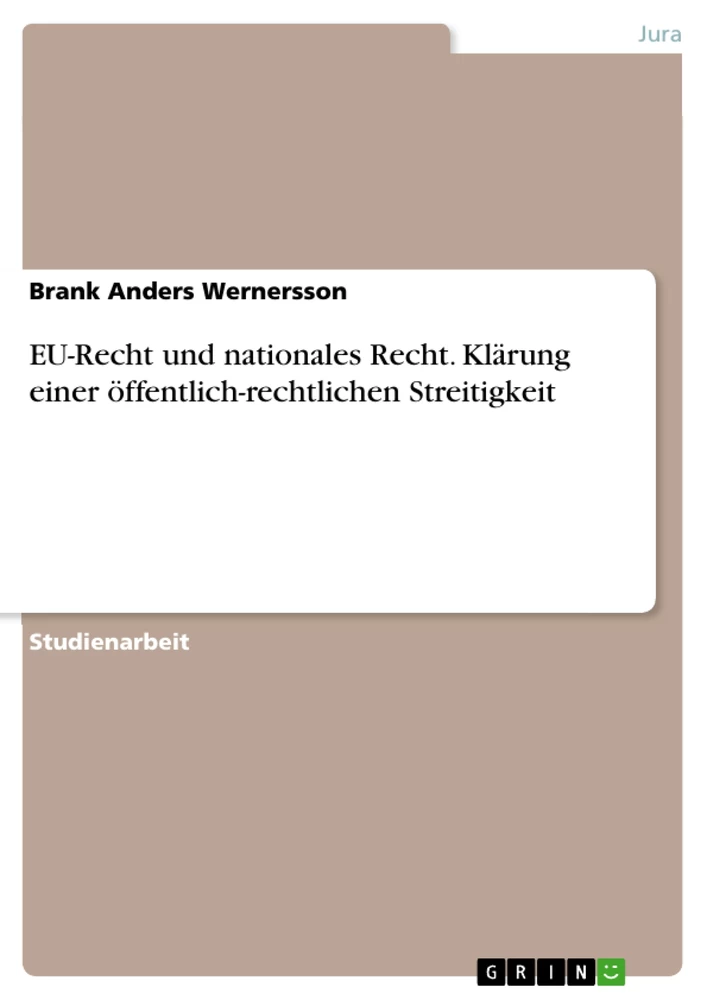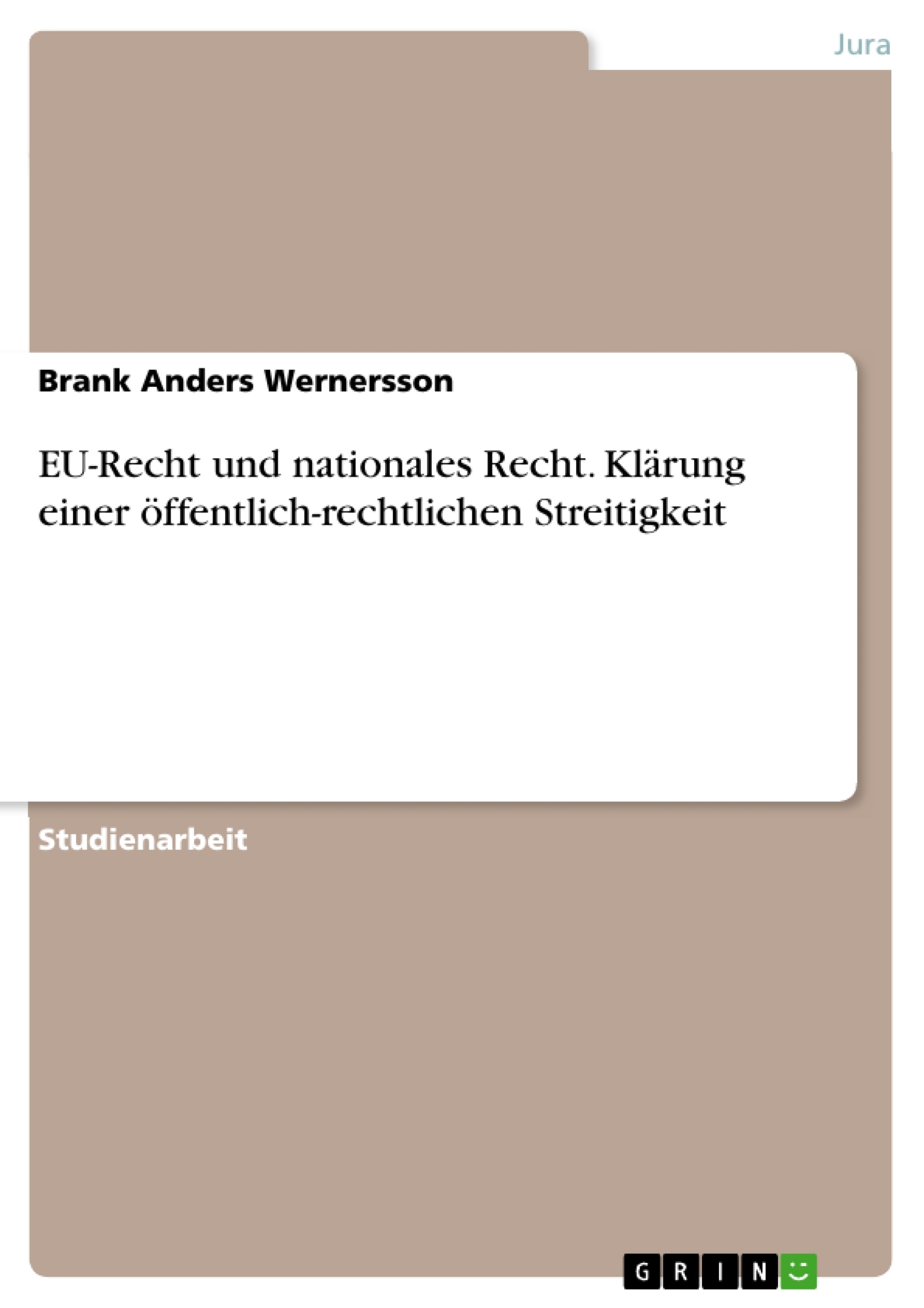Im Rahmen dieser Arbeit sollen folgende rechtliche Sachverhalte und Fragen geklärt werden:
- Erläutern Sie das Verhältnis von EU-Recht zum nationalen Recht, geben Sie Beispiele
- Sie glauben als Verwaltungsmitarbeiter, eine EU-Verordnung verstoße gegen nationales Recht. Können Sie die Verordnung mit dieser Begründung außer Acht lassen?
- A fühlt sich durch lärmende Kinder eines städtischen Kindergartens in seiner Mittagsruhe gestört und möchte die Stadt auf Einhaltung von Ruhezeiten verklagen. Handelt es sich hierbei um eine privatrechtliche oder um eine öffentlich rechtliche Streitigkeit?
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabe 1a: Verhältnis EU-Recht - nationales Recht
- Aufgabe 1b: Umgang mit vermeintlich rechtswidrigen EU-Verordnungen
- Aufgabe 2: Öffentlich-rechtliche Streitigkeit durch Kindergartenlärm
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Verhältnis zwischen EU-Recht und nationalem Recht in Deutschland und analysiert eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Die Arbeit klärt den Vorrang und die unmittelbare Anwendbarkeit von EU-Recht und zeigt anhand von Beispielen die praktischen Auswirkungen auf. Weiterhin wird die Abgrenzung zwischen öffentlich- und privatrechtlichen Streitigkeiten erörtert.
- Vorrang und unmittelbare Anwendbarkeit von EU-Recht
- Konfliktlösung zwischen EU-Recht und nationalem Recht
- Auswirkungen von EU-Verordnungen auf nationales Recht
- Abgrenzung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Streitigkeiten
- Anwendung der Subordinationstheorie im Kontext einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Aufgabe 1a: Verhältnis EU-Recht - nationales Recht: Dieses Kapitel erläutert den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht. Es betont die unmittelbare Anwendbarkeit des EU-Rechts in den Mitgliedsstaaten und die daraus resultierenden subjektiven öffentlichen Rechte für Einzelpersonen. Anhand von Beispielsfällen wie Van Gend & Loos, Costa gegen ENEL, Tanja Kreil und Sari Kiiski wird der Vorrang des EU-Rechts sowohl für Primär- als auch Sekundärrecht verdeutlicht. Die Beispiele illustrieren, wie nationales Recht im Konfliktfall durch EU-Recht außer Kraft gesetzt wird, selbst wenn es sich um grundlegende nationale Gesetze handelt. Die unmittelbare Wirkung des EU-Rechts wird anhand des Beispiels des BMI-Rundschreibens verdeutlicht, welches einen Verstoß deutschen Rechts gegen Unionsrecht feststellte. Ein weiteres Beispiel veranschaulicht die Unmöglichkeit, nationale Regelungen zu erlassen, die EU-Verordnungen (z.B. zu Flug- und Bahnverspätungen) unterbieten.
Aufgabe 1b: Umgang mit vermeintlich rechtswidrigen EU-Verordnungen: Dieses Kapitel behandelt den Fall, dass ein Verwaltungsmitarbeiter eine EU-Verordnung für rechtswidrig hält. Es wird klargestellt, dass eine EU-Verordnung aufgrund eines vermeintlichen Verstoßes gegen nationales Recht nicht ignoriert werden darf, sondern Anwendung finden muss. Das widersprechende nationale Recht wird verdrängt. Der Verwaltungsmitarbeiter hat die Möglichkeit, die Verordnung unter Vorbehalt anzuwenden und eine Nichtigkeitsklage beim EuGH einzureichen. Nur wenn der EuGH die Nichtigkeit der Verordnung feststellt, kann das nationale Recht wieder angewandt werden. Bis zu diesem Urteil muss die EU-Verordnung weiterhin Anwendung finden.
Aufgabe 2: Öffentlich-rechtliche Streitigkeit durch Kindergartenlärm: Dieses Kapitel befasst sich mit einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit. Herr A fühlt sich durch den Lärm eines städtischen Kindergartens gestört und möchte die Stadt verklagen. Die Arbeit erläutert verschiedene Theorien zur Abgrenzung zwischen öffentlich- und privatrechtlichen Streitigkeiten, insbesondere die modifizierte Subjektstheorie. Es wird festgestellt, dass im vorliegenden Fall eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegt, wenn die Stadt durch eine Verordnung zur Einhaltung von Ruhezeiten verpflichtet ist. Da eine solche Verordnung möglicherweise existiert, liegt eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor, obwohl der Erfolg der Klage fraglich ist aufgrund der seltenen Anwendung solcher Verordnungen.
Schlüsselwörter
EU-Recht, nationales Recht, Vorrang, unmittelbare Anwendbarkeit, EU-Verordnungen, öffentlich-rechtliche Streitigkeit, privatrechtliche Streitigkeit, Subordinationstheorie, modifizierte Subjektstheorie, hoheitliche Gewalt, Rechtsnormen, Rechtsanwendung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: EU-Recht, nationales Recht und öffentlich-rechtliche Streitigkeiten
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Verhältnis zwischen EU-Recht und nationalem Recht in Deutschland und analysiert eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit am Beispiel von Kindergartenlärm. Sie beleuchtet den Vorrang und die unmittelbare Anwendbarkeit von EU-Recht und die Abgrenzung zwischen öffentlich- und privatrechtlichen Streitigkeiten.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie den Vorrang und die unmittelbare Anwendbarkeit von EU-Recht, die Konfliktlösung zwischen EU-Recht und nationalem Recht, die Auswirkungen von EU-Verordnungen auf nationales Recht, die Abgrenzung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Streitigkeiten sowie die Anwendung der Subordinationstheorie im Kontext einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit. Konkrete Beispiele wie die Rechtsfälle Van Gend & Loos, Costa gegen ENEL, Tanja Kreil und Sari Kiiski sowie ein Beispiel zum Umgang mit vermeintlich rechtswidrigen EU-Verordnungen werden analysiert.
Wie wird der Vorrang des EU-Rechts behandelt?
Die Hausarbeit erläutert den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht und dessen unmittelbare Anwendbarkeit in den Mitgliedsstaaten. Sie zeigt anhand von Beispielsfällen, wie nationales Recht im Konfliktfall durch EU-Recht außer Kraft gesetzt wird, und verdeutlicht die daraus resultierenden subjektiven öffentlichen Rechte für Einzelpersonen. Das Beispiel des BMI-Rundschreibens wird herangezogen, um die unmittelbare Wirkung des EU-Rechts zu illustrieren.
Wie wird mit vermeintlich rechtswidrigen EU-Verordnungen umgegangen?
Die Arbeit beschreibt den Umgang mit EU-Verordnungen, die ein Verwaltungsmitarbeiter für rechtswidrig hält. Es wird betont, dass diese Verordnungen trotz vermeintlicher Verstöße gegen nationales Recht angewendet werden müssen. Der Verwaltungsmitarbeiter kann die Verordnung unter Vorbehalt anwenden und eine Nichtigkeitsklage beim EuGH einreichen. Bis zum Urteil des EuGH muss die EU-Verordnung Anwendung finden.
Wie wird die öffentlich-rechtliche Streitigkeit des Kindergartenlärms analysiert?
Die Hausarbeit analysiert eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, in der Herr A sich durch den Lärm eines städtischen Kindergartens gestört fühlt und die Stadt verklagen möchte. Verschiedene Theorien zur Abgrenzung zwischen öffentlich- und privatrechtlichen Streitigkeiten, insbesondere die modifizierte Subjektstheorie, werden erläutert. Es wird untersucht, ob im vorliegenden Fall aufgrund möglicher Ruhezeitverordnungen eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegt, obwohl der Erfolg der Klage aufgrund der seltenen Anwendung solcher Verordnungen fraglich ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: EU-Recht, nationales Recht, Vorrang, unmittelbare Anwendbarkeit, EU-Verordnungen, öffentlich-rechtliche Streitigkeit, privatrechtliche Streitigkeit, Subordinationstheorie, modifizierte Subjektstheorie, hoheitliche Gewalt, Rechtsnormen, Rechtsanwendung.
- Quote paper
- Brank Anders Wernersson (Author), 2013, EU-Recht und nationales Recht. Klärung einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375239