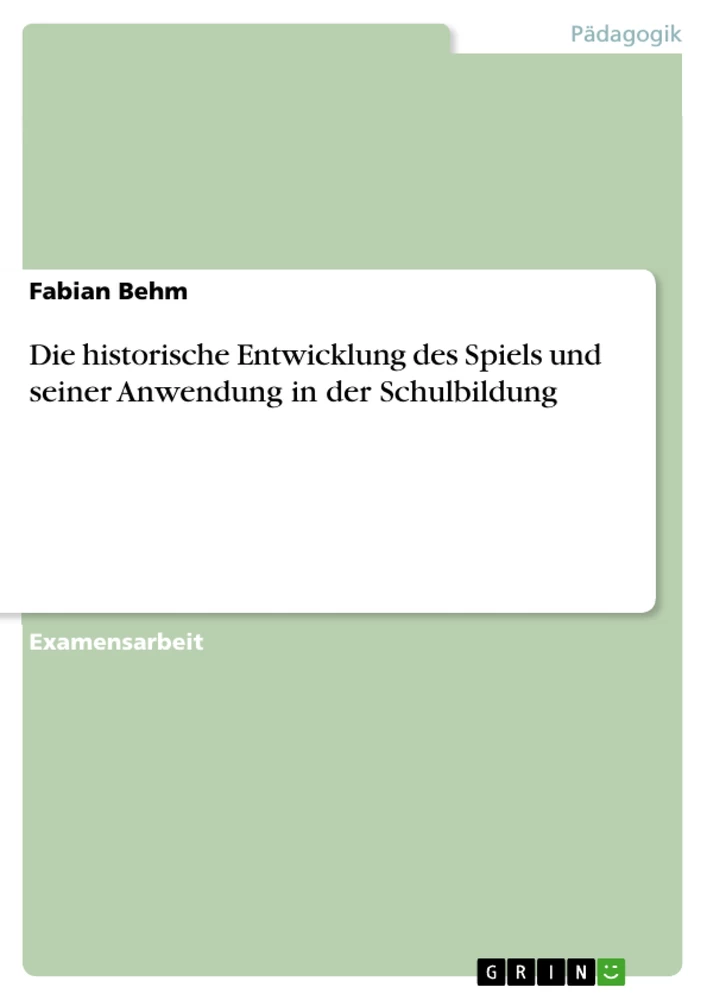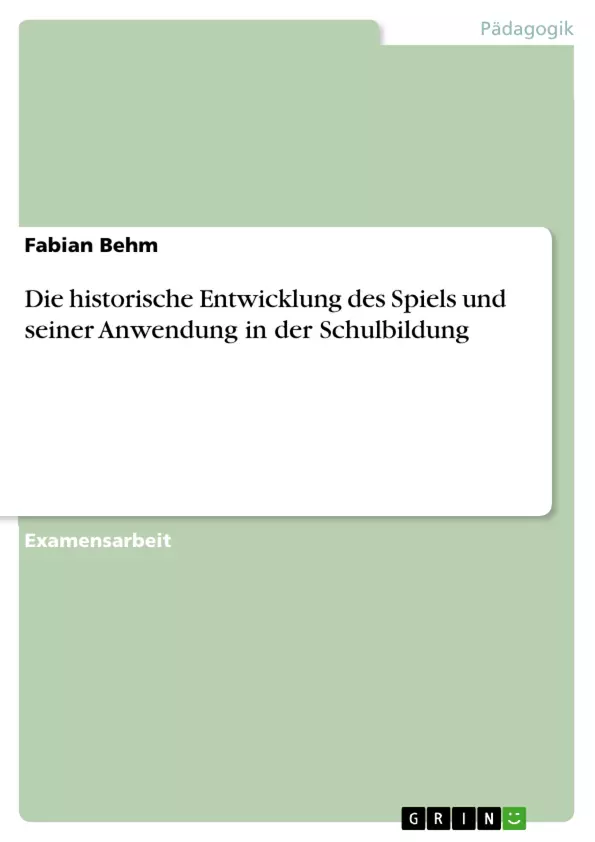Diese Arbeit wird sich dem Thema des (digitalen) Spiels widmen und es unter verschiedensten Gesichtspunkten beleuchten. Es soll die Frage beantwortet werden, ob und in welcher Art und Weise eine Verbindung von (digitalem) Spiel und Lernen sinnvoll ist, welche Gefahren sie birgt und welcher Nutzen aus ihr gezogen werden kann. Die Arbeit ist dabei als Einstieg mit möglichst vielseitiger Betrachtung der Thematik zu sehen. Es wird ein Überblick über die verschiedenen Facetten des Spiels und seiner Untersuchung vorgestellt, der zunächst ein klares und allgemein verständliches Bild der Aktivität des Spielens zeichnen soll und außerdem Möglichkeiten zur weiteren und spezifischeren Beschäftigung mit Teilen der vorgestellten Untersuchungen anbieten wird.
Bei der Erarbeitung des Themas wird nur vereinzelt auf Primärquellen und in großen Teilen auf Sekundärliteratur zurückgegriffen, da das Ziel vor allem eine Darstellung der Forschungsstände und eine Übersicht über das jeweilige Thema ist. Inhaltlich ist die Arbeit in zwei Komplexe unterteilt, die sich vor allem durch die Art der Betrachtung des Spiels voneinander abgrenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die historische Entwicklung des Spiels
- Das Spiel Eine Begriffserklärung
- Das Spiel im Wandel der Zeit
- Frühzeit und Antike
- Mittelalter
- Frühe Neuzeit und Moderne
- Fazit
- Von analog zu digital – Eine neue Form des Spiels?
- Das Spiel in der Schule
- Das kindliche Spiel und die Spielpädagogik
- Die historische Entwicklung des Spiels in der Schule
- Antike, Mittelalter und Renaissance
- Von der Aufklärung bis zur Moderne
- Das digitale Spiel in der Schule
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik des (digitalen) Spiels und untersucht dessen Bedeutung im Kontext von Kultur, Gesellschaft, Geschichte und Bildung. Sie analysiert die historische Entwicklung des Spiels, seine Bedeutung für die kindliche Entwicklung und seine potentiellen Einsatzmöglichkeiten im schulischen Kontext. Ziel ist es, ein umfassendes Bild des Spiels als kulturelles Phänomen und pädagogisches Werkzeug zu zeichnen und zu erörtern, wie es sinnvoll in den Schulalltag integriert werden kann.
- Die historische Entwicklung des Spiels
- Der Wert des Spiels für die kindliche Entwicklung
- Die Herausforderungen und Chancen der digitalen Spiele im Bildungsbereich
- Die Integration des Spiels in den Unterricht
- Die Bedeutung der Medienpädagogik im Umgang mit digitalen Spielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des digitalen Spiels ein und stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar. Sie basiert auf einer Projektarbeit in einer Greifswalder Gesamtschule, die die Nutzung von Videospielen durch Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse untersuchte. Die Ergebnisse der Umfrage und Gespräche mit Schülern und Lehrern zeigten den zunehmenden Einfluss digitaler Spiele auf die Freizeitgestaltung von Jugendlichen und mögliche negative Auswirkungen auf die schulische Leistung.
- Kapitel 2.1. - Das Spiel Eine Begriffserklärung: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die Analyse des Spiels und seiner Bedeutung. Es beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs „Spiel“ und greift dabei auf die Werke Johan Huizingas zurück, insbesondere auf „Homo Ludens“.
- Kapitel 2.2. - Das Spiel im Wandel der Zeit: In diesem Kapitel wird die historische Entwicklung des Spiels von der Frühzeit bis zur Moderne beleuchtet. Es werden die Spielgewohnheiten der jeweiligen Epochen vorgestellt und der gesellschaftliche Wert des Spiels analysiert. Ziel ist es, generelle Entwicklungen des Spiels zu identifizieren und Rückschlüsse auf das heutige Spiel zu ziehen.
- Kapitel 2.3. - Von analog zu digital – Eine neue Form des Spiels?: Dieses Kapitel widmet sich dem Phänomen des digitalen Spiels. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Videospielforschung und stellt die wichtigsten Persönlichkeiten und Entwicklungen vor. Anschließend wird die Geschichte des Videospiels selbst behandelt, um den rasanten Aufstieg dieser Spielform zu erfassen.
- Kapitel 3.1. - Das kindliche Spiel und die Spielpädagogik: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung. Es stellt grundlegende Theorien des kindlichen Spiels bezüglich Motivation, Wirkung und Ausprägungen vor und führt in das wissenschaftliche Feld der Spielpädagogik ein.
- Kapitel 3.2. - Die historische Entwicklung des Spiels in der Schule: In diesem Kapitel wird die historische Entwicklung der Spielpädagogik von der Antike bis zur Moderne skizziert. Es werden verschiedene Theorien bezüglich des Spiels in der Schule vorgestellt und deren Einfluss auf die moderne Spielpädagogik untersucht.
- Kapitel 3.3. - Das digitale Spiel in der Schule: Dieses Kapitel befasst sich mit den Einflüssen des digitalen Spiels auf das Spiel in der Schule. Es analysiert den Einfluss des digitalen Spiels auf die Spielpädagogik, stellt die Risiken des Videospielkonsums dar und hebt mögliche positive Wirkungsweisen des Games in der Schule und Erziehung hervor. Zudem werden didaktische Anwendungsmöglichkeiten des digitalen Spiels und die Anforderungen an das schulische Umfeld herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit widmet sich der historischen Entwicklung des Spiels und dessen Bedeutung für die Schulbildung. Dabei werden die Begriffe Spiel, Spielpädagogik, digitales Spiel, Videospiel, Homo Ludens, Medienpädagogik und die Einbindung von Spielen in den Unterricht thematisiert.
- Citation du texte
- Fabian Behm (Auteur), 2016, Die historische Entwicklung des Spiels und seiner Anwendung in der Schulbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375253