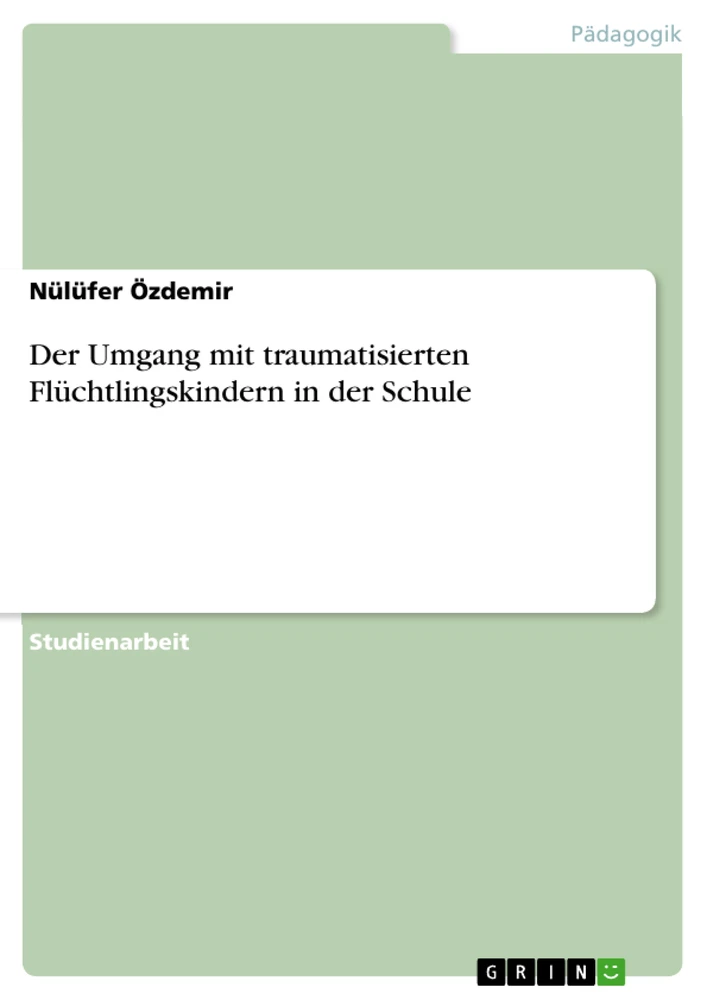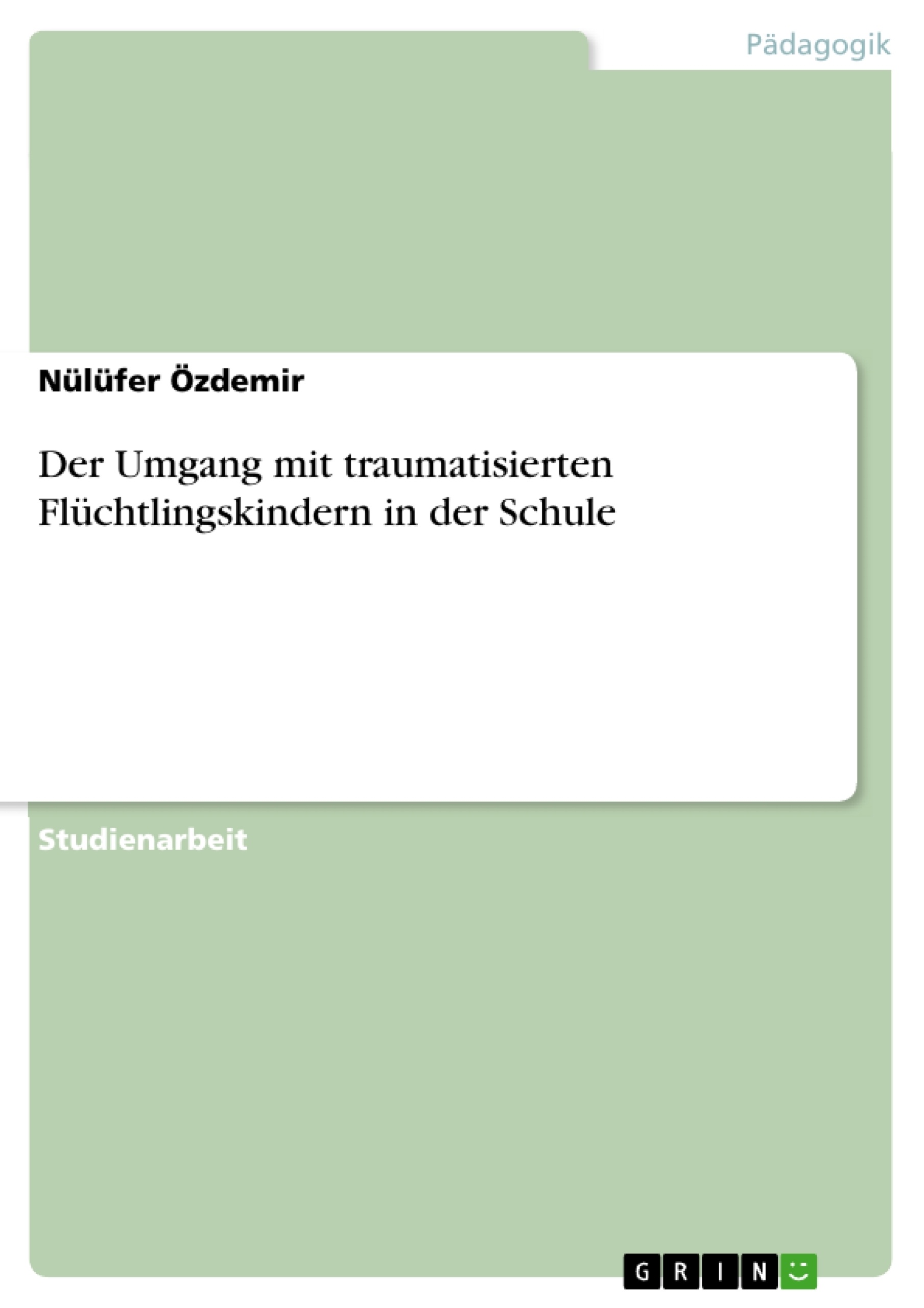Kinder und Jugendliche, die nach ihrer langwierigen Flucht in Deutschland angekommen sind, sind in vielfältiger Weise besonders belastet. Fast alle von ihnen sind schwer traumatisiert. Neben Hunger und Armut mussten viele von ihnen den Zusammenbruch ihrer familiären Systeme erleben und haben sogar enge Bezugspersonen verloren. Insbesondere Lehrkräfte sollten über ein Grundwissen zu den Hintergründen ihrer belasteten Schüler und den Folgen von Trauma und Flucht verfügen, um dazu eine professionelle Haltung entwickeln zu können. Es wird den Lehrkräften nicht erspart bleiben, mindestens einen Schüler in der Klasse mit traumatischen Belastungen sitzen zu haben. Demzufolge stellt sich die Frage, wie der Umgang mit traumatisierten Kindern im schulpädagogischen Arbeitsfeld gestaltet werden kann und inwiefern die Lehrkräfte auf traumatische Erscheinungen in ihrem Klassenzimmer reagieren sowie eine professionelle Unterstützung und Stabilisierung bieten können, um für jeden einzelnen Schüler einen geregelten Schulalltag zu gewährleisten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Flucht und Trauma
- 3. Sequentielle Traumatisierung der Flüchtlingskinder
- 4. Flucht und Trauma im schulischen Kontext
- 4.1 Herausforderungen
- 4.2 Umgang mit traumabedingten Reaktionen
- 5. Professionelle Unterstützung und Stabilisation der Kinder
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen, die der Umgang mit traumatisierten Flüchtlingskindern im schulischen Kontext mit sich bringt. Sie analysiert die spezifischen Bedürfnisse dieser Kinder und die Folgen von Trauma und Flucht. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die psychologischen Belastungen von Flüchtlingskindern zu entwickeln und Handlungsmöglichkeiten für die Lehrkräfte aufzuzeigen, um ein stabiles Lernumfeld zu schaffen.
- Definition von Flucht und Trauma
- Sequentielle Traumatisierung von Flüchtlingskindern
- Herausforderungen im schulischen Kontext
- Umgang mit traumabedingten Reaktionen
- Professionelle Unterstützung und Stabilisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Situation von Flüchtlingskindern in Deutschland dar und erläutert die Notwendigkeit, sich mit den Folgen von Trauma und Flucht auseinanderzusetzen. Kapitel 2 definiert die Begriffe „Flucht“ und „Trauma“ und erläutert die vielschichtigen Ursachen, die zur Flucht von Kindern führen. Kapitel 3 beleuchtet die sequentielle Traumatisierung von Flüchtlingskindern, die in den Phasen der Vorflucht, Flucht und Nachflucht stattfindet. Kapitel 4 betrachtet den schulischen Kontext und die Herausforderungen, denen Lehrkräfte im Umgang mit traumatisierten Flüchtlingskindern gegenüberstehen. Kapitel 4.1 beschreibt die spezifischen Probleme, die sich aus traumabedingten Reaktionen ergeben, und Kapitel 4.2 geht auf die Notwendigkeit eines professionellen Umgangs mit diesen Reaktionen ein. Schließlich beleuchtet Kapitel 5 die Möglichkeiten der professionellen Unterstützung und Stabilisierung von traumatisierten Flüchtlingskindern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Flucht, Trauma, sequentielle Traumatisierung, Flüchtlingskinder, schulischer Kontext, traumabedingte Reaktionen, professionelle Unterstützung, Stabilisierung.
- Citar trabajo
- Nülüfer Özdemir (Autor), 2017, Der Umgang mit traumatisierten Flüchtlingskindern in der Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375333