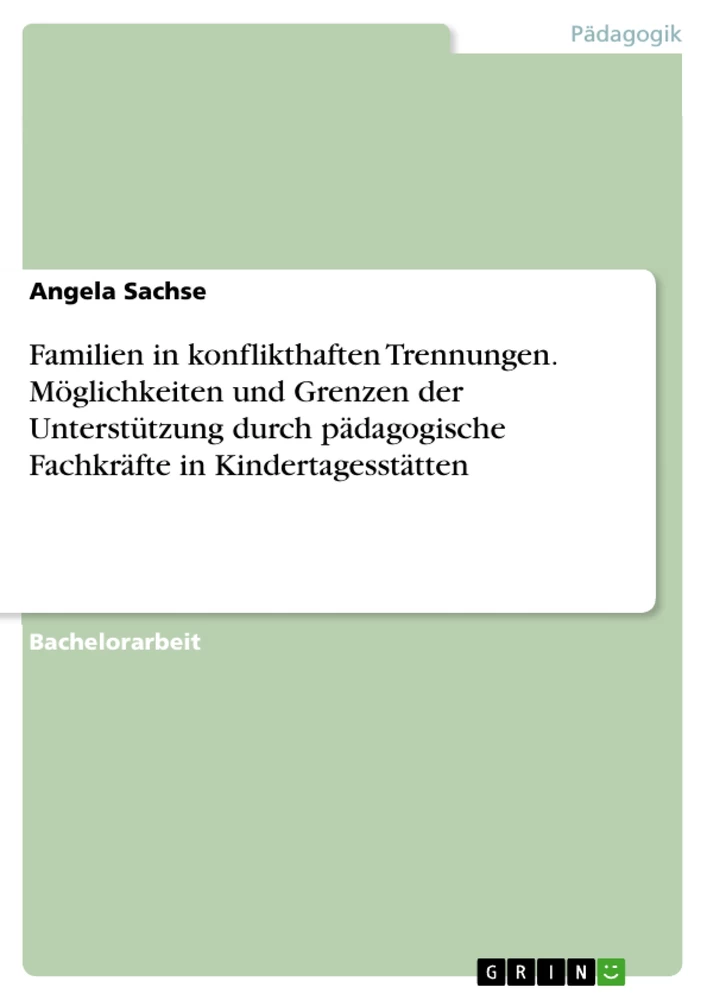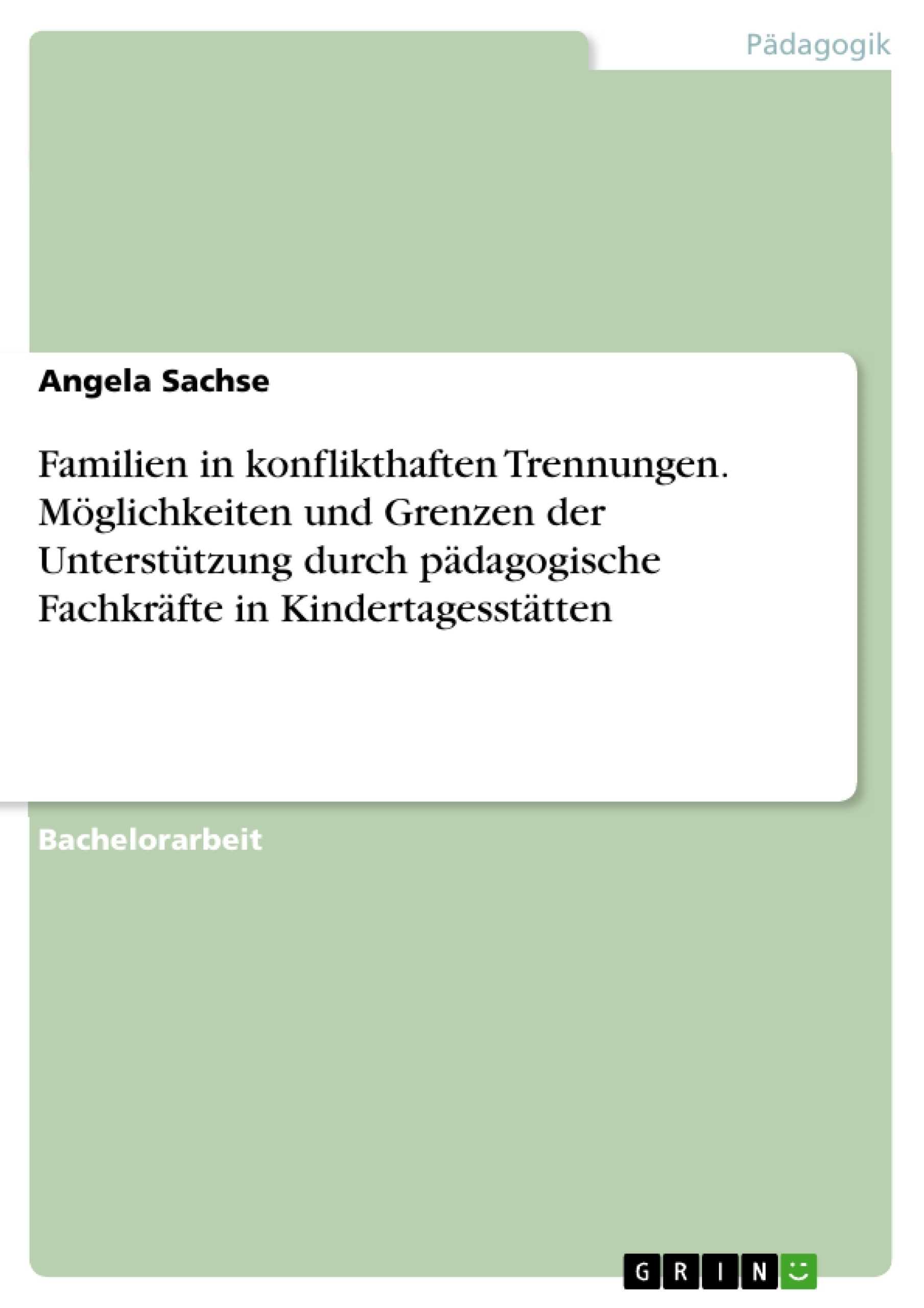Ziel dieser Arbeit soll es sein, herauszuarbeiten, wie Fachkräfte in Kindertagesstätten Kinder und Eltern unterstützen können, dieses krisenhafte Ereignis zu bewältigen. Dazu wird neben einem sozialwissenschaftlichen Blick Trennungen als gesellschaftlicher Realität auch die psychologische Bedeutung der Trennung für Eltern und Kind und die phasenspezifische Verarbeitung herausgearbeitet.
Eine Trennung ist von tiefen Verunsicherungen in der Eltern-Kind-Beziehung und schwer zu verarbeitenden Emotionen der Trauer, Verlustangst, Wut und Schuld verbunden. Bei konfliktbeladenen Trennungen kommen hier noch Loyalitäts- und Identitätskonflikte für Kinder hinzu. Zusätzlich stellt diese Trennungsform den größten Risikofaktor kindlicher Trennungsbewältigung dar. Somit erhält bei einer Unterstützung der Kinder in Kindertagesstätten auch der Bereich der Psychoedukation der Eltern einen hohen Stellenwert. Daneben ist die Aufarbeitung der kindlichen Emotionen und ein verlässliches, zugewandtes Beziehungsangebot zu dem Kind von zentraler Bedeutung. Grenzen sind dann gegeben, wenn elterliche Probleme oder kindliche Auffälligkeiten derart massiv sind, dass eine Unterstützung durch die Fachkräfte nicht ausreicht. Hier haben Kindertagesstätten den im SGB VIII festgeschriebenen Auftrag, betroffene Eltern an Beratungsstellen und weitere psychosoziale Dienste zu verweisen. Eine Problematik ist darin zu sehen, dass diese Hilfsangebote von manchen Familien nicht aufgesucht werden. Weitere Grenze stellen fehlende Qualifikationen und ungenügende strukturelle Gegebenheiten der Fachkräfte dar. Gerade Kinder, welche die elterliche Belastung internalisierend verarbeiten, werden nur selten wahrgenommen. Somit wäre es ratsam, diesen Missständen entgegenzuwirken, indem bessere Rahmenbedingungen, eine engere Kooperation zwischen Kindertagesstätte und Beratungsstellen und qualitativ verbesserte Ausbildungen geschaffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Problemstellung
- Trennung und Scheidung aus sozialwissenschaftlicher Perspektive
- Pluralität familialer Formen
- Ursachen für den Anstieg von Trennungen und Scheidungen
- Scheidungsquoten in Deutschland
- Ökonomische Umbrüche bei Ein-Eltern-Familien
- Veränderungen der Eltern-Kind-Beziehungen nach konflikthaften Trennungen und deren Auswirkung auf Kinder
- Die Bedeutung stabiler Eltern-Kind-Beziehungen für das Kind
- Trennungsphasen der Eltern
- Irritation der Eltern-Kind-Beziehung durch elterliche Trennung
- Trennungserleben der Kinder
- Die Problematik konflikthafter Trennungen
- kindliche Reaktionen auf konflikthafte Trennungen
- soziale und psychosomatische Auffälligkeiten
- Verschlechterung der Eltern-Kind-Beziehung
- Ablehnung eines Elternteils
- Besuchsrechtsyndrom
- Langfristige Auswirkungen
- Kindliche Bewältigungsmöglichkeiten der elterlichen Trennung
- Staatlicher Bildungs- und Erziehungsauftrag an Kindertagesstätten und gesetzlich verankerte Hilfsleistungen im Hinblick auf Familien in Trennungen
- SGB VIII als Grundlage staatlicher Unterstützungsmöglichkeiten
- Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Forderungen von Bildungs- und Erziehungsplänen
- Praktische Unterstützungsmöglichkeiten pädagogischer Fachkräfte für Familien in konflikthaften Trennungen
- Verhaltensänderungen der Kinder wahrnehmen
- Erzieherinnen-Kind-Bindung stärken
- Trennungshintergründe mit dem Kind thematisieren
- Ausdrucksmöglichkeiten von Gefühlen unterstützen
- Stärkung des Selbstbewusstseins
- Neutrale Haltung der Fachkraft
- Pädagogische Unterstützung und Hilfe für Eltern
- Weitervermittlung an Beratungsstellen
- Grenzen der Unterstützung durch Fachkräfte
- Problematiken bezüglich der Weitervermittlung an Beratungsstellen
- komplexe, vielschichtige Aufgaben bei ungenügenden strukturellen Bedingungen
- ungenügende fachliche Qualifikationen
- fehlende männliche Rollenvorbilder bezüglich der Identifikationsarbeit
- Handlungsempfehlungen
- Verbesserung der Rahmenbedingungen
- Intensivierung der Kooperation mit psychosozialen Diensten
- Verbesserung der fachlichen Qualifikation
- Handreichungen für die pädagogische Arbeit mit (konflikthaften) Trennungsfamilien
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Unterstützung von Kindern und Eltern in konflikthaften Trennungssituationen durch Fachkräfte in Kindertagesstätten. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen dieser Unterstützung herauszuarbeiten. Neben dem gesellschaftlichen Hintergrund von Trennungen wird die psychologische Bedeutung für Eltern und Kind und die Phasen der Trennungserfahrung beleuchtet. Die Arbeit verdeutlicht, wie Fachkräfte Kinder in ihrer emotionalen Verarbeitung unterstützen und Eltern psychoedukativ begleiten können.
- Die Auswirkungen konflikthafter Trennungen auf Kinder und Eltern
- Die Rolle von Kindertagesstätten bei der Unterstützung von Familien in Trennungssituationen
- Die Grenzen pädagogischer Unterstützungsmöglichkeiten
- Die Notwendigkeit von interdisziplinärer Zusammenarbeit und qualifizierten Fachkräften
- Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Unterstützung für Familien in konflikthaften Trennungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik von Trennungen und Scheidungen für Kinder, insbesondere bei konflikthaften Verläufen, aufzeigt. Im ersten Kapitel wird der soziologische Aspekt von Trennung und Scheidung beleuchtet, wobei die Pluralität familialer Formen, Ursachen für den Anstieg der Trennungsraten und die Auswirkungen auf Ein-Eltern-Familien untersucht werden. Das zweite Kapitel widmet sich der psychologischen Perspektive von Trennungen und fokussiert die Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung und die Reaktion der Kinder. Es werden verschiedene Phasen der Trennung, die Problematik konflikthafter Verläufe und die möglichen kindlichen Reaktionen wie soziale Auffälligkeiten und Verschlechterung der Beziehung zu den Eltern beschrieben. Im dritten Kapitel werden die Möglichkeiten pädagogischer Fachkräfte in Kindertagesstätten aufgezeigt, um Familien in Trennungssituationen zu unterstützen. Dazu zählen die Wahrnehmung von Veränderungen bei den Kindern, die Stärkung der Bindung zwischen Erzieher und Kind, die Thematisierung von Trennungshintergründen, die Unterstützung des emotionalen Ausdrucks und die Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder. Außerdem werden Maßnahmen zur Unterstützung der Eltern und die Weitervermittlung an Beratungsstellen erläutert. Das Kapitel schließt mit einer Analyse der Grenzen der Unterstützung durch Fachkräfte, die durch ungenügende Strukturen, fehlende Qualifikationen und mangelnde Kooperation mit anderen Institutionen entstehen können. Abschließend werden Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der Rahmenbedingungen, die Intensivierung der Zusammenarbeit mit psychosozialen Diensten, die Verbesserung der fachlichen Qualifikation von Fachkräften und die Erstellung von Handreichungen für die pädagogische Arbeit mit Trennungsfamilien gegeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Konflikthafte Trennungen, Familien in Trennungssituationen, pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten, Unterstützungsmöglichkeiten, psychologische Auswirkungen, emotionale Verarbeitung, Eltern-Kind-Beziehung, psychoedukative Begleitung, Grenzen der Unterstützung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie können Erzieher Kinder bei einer Trennung unterstützen?
Durch ein verlässliches Beziehungsangebot, die Wahrnehmung von Verhaltensänderungen, die Thematisierung der Gefühle des Kindes und die Stärkung seines Selbstbewusstseins.
Was sind Anzeichen für Belastung bei Kindern?
Kinder können mit sozialen oder psychosomatischen Auffälligkeiten reagieren. Manche verarbeiten die Belastung „internalisierend“, also nach innen gekehrt, was oft schwerer zu erkennen ist.
Was ist Psychoedukation für Eltern?
Dabei werden Eltern über die Auswirkungen der Trennung auf die kindliche Entwicklung aufgeklärt, um sie für die Bedürfnisse ihrer Kinder in der Krisensituation zu sensibilisieren.
Wo liegen die Grenzen der Kita-Fachkräfte?
Grenzen sind erreicht bei massiven elterlichen Problemen oder kindlichen Störungen, die eine spezialisierte Therapie oder Beratung erfordern. In diesen Fällen greift der Verweisungsauftrag nach SGB VIII.
Welchen Auftrag hat die Kita laut SGB VIII?
Die Kita hat einen staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag und muss Familien in Krisen unterstützen sowie bei Bedarf an Beratungsstellen und psychosoziale Dienste weitervermitteln.
- Quote paper
- Angela Sachse (Author), 2016, Familien in konflikthaften Trennungen. Möglichkeiten und Grenzen der Unterstützung durch pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375397