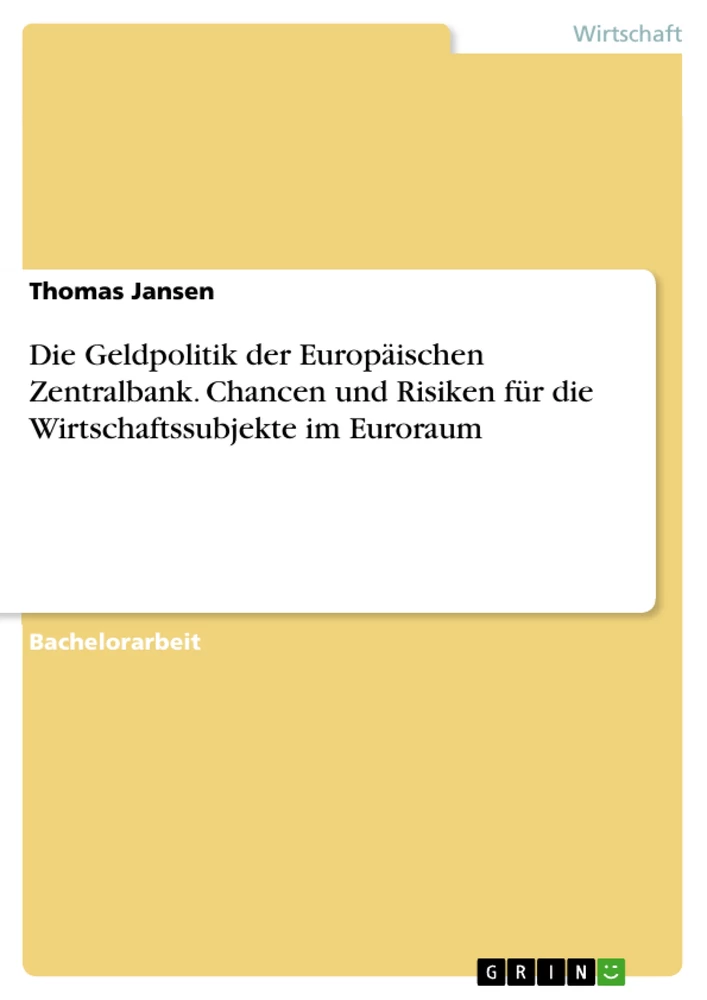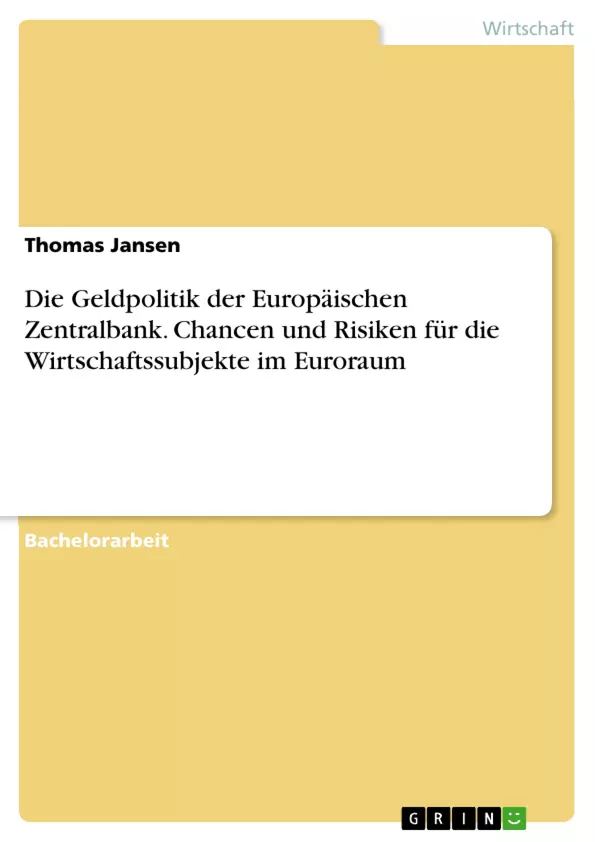Diese Arbeit befasst sich mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, welche seit der Finanzkrise im Jahr 2007 und der Offenlegung der Schuldenkrise Griechenlands im Jahr 2008 aufgrund ihrer unkonventionellen Maßnahmen erheblichen Spannungen ausgesetzt ist.
Das Ziel dieser Ausarbeitung ist es, diese Maßnahmen bezüglich Ihrer Eignung zu bewerten sowie Chancen und Risiken der einzelnen Wirtschaftssubjekte im Euroraum zu bestimmen. Hierzu wird die Ableitung einer Ursache-/Wirkungskette auf Basis der Absichten der Europäischen Zentralbank vorgenommen, welche anschließend hinsichtlich Ihrer Validität untersucht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Europäische Zentralbank als Institution
- Historischer Werdegang
- Zusammensetzung der Institution
- Geldpolitik
- Ziele und Aufgabenbereiche
- Notwendigkeit eines stabilen Preisniveaus
- Zusammensetzung der Geldmenge im Euroraum
- Analyse der ökonomischen Beschaffenheit des Euroraums
- Motive und Einflussfelder der Europäischen Zentralbank
- Unkonventionelle Maßnahmen der Geldpolitik
- Änderung des Zinstender-Verfahrens
- Änderung der Fristen für Refinanzierungsgeschäfte
- Erweiterung des Sicherheitsrahmens
- Emergency Liquidity Assistance
- Erwerb von Pfandbriefen
- Erwerb von Staatsanleihen
- Entwicklung der Inflationsraten
- Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
- Entwicklung der Bruttoinlandprodukte
- Entwicklung der Staatsverschuldungen
- Zusammenhang zwischen der Verschuldung von Banken und Staaten
- Konvergenzkriterien des Vertrags von Maastricht
- Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt
- Der Europäische Stabilitätsmechanismus
- Entwicklung der Zentralbankgeldmenge
- Auswirkungen auf die Wirtschaftssubjekte im Euroraum
- Private Haushalte
- Zusammenhang zwischen Sparen und Konsum
- Änderung des Spar- und Konsumverhaltens im Euroraum
- Änderung des Spar- und Konsumverhaltens in Deutschland
- Änderung des Spar- und Konsumverhaltens in Griechenland
- Öffentliche Haushalte
- Private Unternehmen
- Faktoren zur Beeinflussung der Liquidität
- Investitionsverhalten
- Implikationen auf den Arbeitsmarkt
- Öffentliche Unternehmen
- Private Haushalte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank seit der Finanzkrise und befasst sich insbesondere mit den unkonventionellen Maßnahmen der EZB. Ziel ist es, die Eignung dieser Maßnahmen zu bewerten und die Chancen und Risiken für die Wirtschaftssubjekte im Euroraum zu bestimmen.
- Bewertung der unkonventionellen Maßnahmen der EZB
- Analyse der Auswirkungen der Geldpolitik auf die einzelnen Wirtschaftssubjekte
- Identifizierung der Chancen und Risiken der EZB-Politik für die Wirtschaftssubjekte
- Untersuchung der Auswirkungen der EZB-Politik auf die Staatsverschuldung im Euroraum
- Analyse der Auswirkungen der EZB-Politik auf die Inflationsraten im Euroraum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Gegenstand der Untersuchung sowie die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel wird die Europäische Zentralbank als Institution vorgestellt. Es werden der historische Werdegang, die Zusammensetzung der Institution, die Ziele der Geldpolitik sowie die Aufgabenbereiche der EZB behandelt. Des Weiteren wird die Zusammensetzung der Geldmenge im Euroraum beleuchtet.
Im dritten Kapitel wird die ökonomische Beschaffenheit des Euroraums analysiert. Es werden die Motive und Einflussfelder der Europäischen Zentralbank untersucht. Außerdem werden die unkonventionellen Maßnahmen der Geldpolitik der EZB seit der Finanzkrise behandelt, wobei die Auswirkungen auf die Inflationsraten, die Arbeitslosenzahlen, die Bruttoinlandprodukte und die Staatsverschuldungen im Euroraum betrachtet werden. Der Zusammenhang zwischen der Verschuldung von Banken und Staaten sowie der Europäische Stabilitätsmechanismus werden ebenfalls beleuchtet.
Im vierten Kapitel werden die Auswirkungen der Geldpolitik der EZB auf die Wirtschaftssubjekte im Euroraum untersucht. Es werden die Auswirkungen auf private Haushalte, öffentliche Haushalte, private Unternehmen und öffentliche Unternehmen betrachtet. Dabei werden die Auswirkungen der EZB-Politik auf das Spar- und Konsumverhalten, das Investitionsverhalten und den Arbeitsmarkt analysiert.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank, Geldpolitik, unkonventionelle Maßnahmen, Euroraum, Wirtschaftssubjekte, Chancen, Risiken, Staatsverschuldung, Inflation, Arbeitslosigkeit, Bruttoinlandsprodukt, Finanzkrise, Konvergenzkriterien, Europäischer Stabilitätsmechanismus
Häufig gestellte Fragen
Was sind unkonventionelle Maßnahmen der EZB?
Dazu gehören der Erwerb von Staatsanleihen und Pfandbriefen, die Änderung des Zinstender-Verfahrens sowie die Notfall-Liquiditätshilfe (ELA).
Welche Ziele verfolgt die Europäische Zentralbank primär?
Das vorrangige Ziel ist die Gewährleistung der Preisstabilität im Euroraum, um ein stabiles wirtschaftliches Umfeld zu sichern.
Wie beeinflusst die EZB-Politik die privaten Haushalte?
Die Geldpolitik beeinflusst das Spar- und Konsumverhalten; niedrige Zinsen können den Konsum fördern, reduzieren aber gleichzeitig die Renditen für Ersparnisse.
Was ist der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM)?
Der ESM ist ein Rettungsschirm, der Euro-Staaten bei Finanzierungsproblemen unterstützt, um die Stabilität der Währungsunion insgesamt zu wahren.
Welche Risiken birgt die aktuelle Geldpolitik?
Risiken sind u.a. eine steigende Inflation, Blasenbildung an den Finanzmärkten und eine zunehmende Abhängigkeit der Staaten von billigem Zentralbankgeld.
- Quote paper
- Thomas Jansen (Author), 2017, Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Chancen und Risiken für die Wirtschaftssubjekte im Euroraum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375468