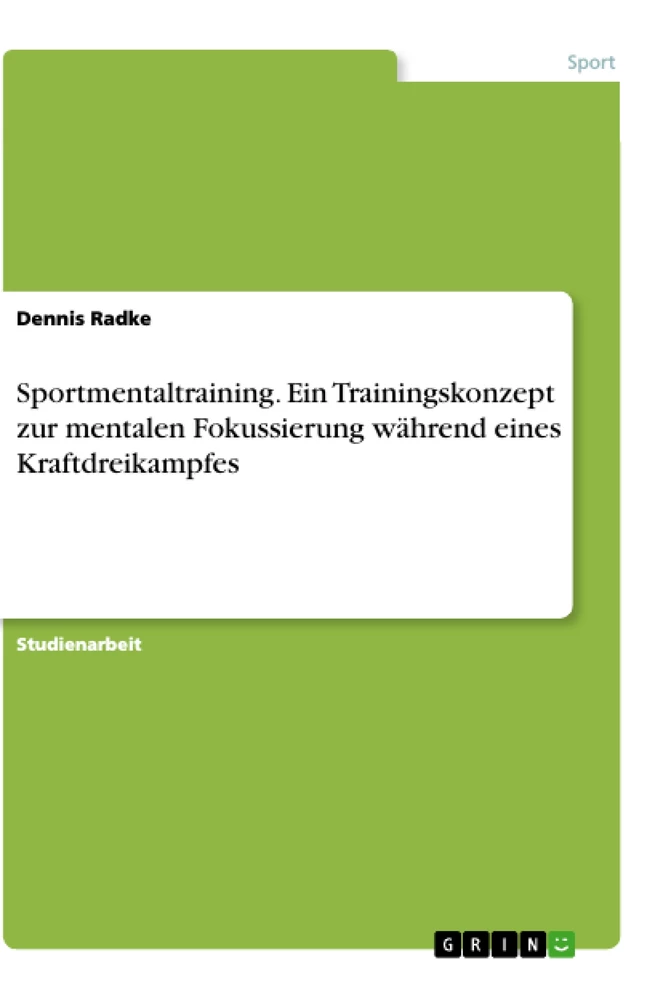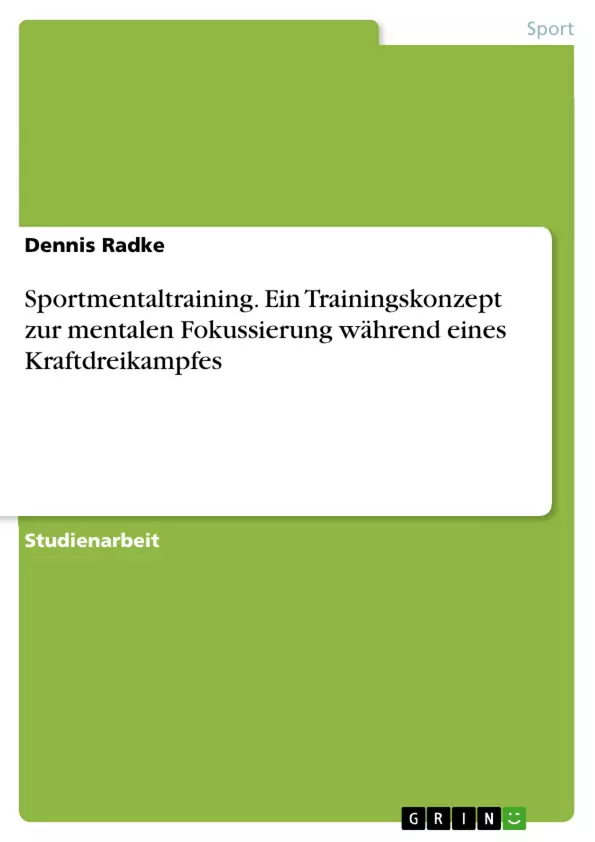Mentale Stärke ist in der heutigen Gesellschaft eine der erfolgversprechendsten Eigenschaften, welche man haben oder sich aneignen kann und sollte. Ohne sie ist die physikalische Stärke, also die Muskelkraft, und das Leistungsniveau des zentralen Nervensystems oder des Herz-Kreislaufsystems nur halb so viel wert. Trainingsmethoden sind vorrangig diese, die dem Kunden die Angst nehmen, ihn motivieren und ihm auf beruflichen oder privaten Ebenen Selbstvertrauen verleihen kann.
Strukturgebend ist das 5-Stufen-Modell von der Anamnese über die Planung bis zur Evaluation. Hierbei wird detailliert erläutert, wie die Vorgehensweise zur Erreichung von Bestleistungen, also der Leistungssteigerung, aussehen kann. Dabei stehen verschiedene Methoden und Techniken zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Trainingskonzept
- Diagnose
- Die Kundin
- Das persönliche Gespräch
- Die Auftragserklärung
- Die Exploration
- Selbstbeobachtung
- Zielsetzung
- Trainingsplanung
- Trainingsdurchführung
- Evaluation
- Diagnose
- Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit entwickelt ein individuelles Trainingskonzept zur mentalen Fokussierung während eines Kraftdreikampfes. Ziel ist es, die Nervosität der Kundin vor Wettkämpfen zu reduzieren und ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Das Konzept basiert auf dem Fünf-Stufen-Modell der Trainingssteuerung und beinhaltet eine umfassende Diagnose, Zielsetzung, Trainingsplanung, Durchführung und Evaluation.
- Mentale Stärke und ihre Bedeutung im Sport
- Diagnose der individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen
- Entwicklung eines gezielten Trainingsplans zur Steigerung der mentalen Fokussierung
- Anwendung von mentalen Techniken und Übungen zur Bewältigung von Wettkampfstress
- Evaluation des Trainingserfolgs und Anpassung des Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von mentaler Stärke im Sport und erläutert den Kontext des Mentaltrainings in der Sportpsychologie. Sie führt das Fünf-Stufen-Modell der Trainingssteuerung als Grundlage für das Konzept ein.
- Diagnose: Dieses Kapitel beschreibt den Prozess der Diagnose, der eine detaillierte Analyse der Kundin, ihrer persönlichen Situation und ihrer Ziele beinhaltet. Der Fokus liegt auf dem persönlichen Gespräch und der Erhebung von Informationen durch Anamnese und Exploration.
Schlüsselwörter
Mentales Training, Kraftdreikampf, Wettkampfstress, Nervosität, Fokussierung, Fünf-Stufen-Modell, Trainingssteuerung, Diagnose, Anamnese, Exploration, Zielsetzung, Trainingsplanung, Trainingsdurchführung, Evaluation.
- Citar trabajo
- Dennis Radke (Autor), 2017, Sportmentaltraining. Ein Trainingskonzept zur mentalen Fokussierung während eines Kraftdreikampfes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375535