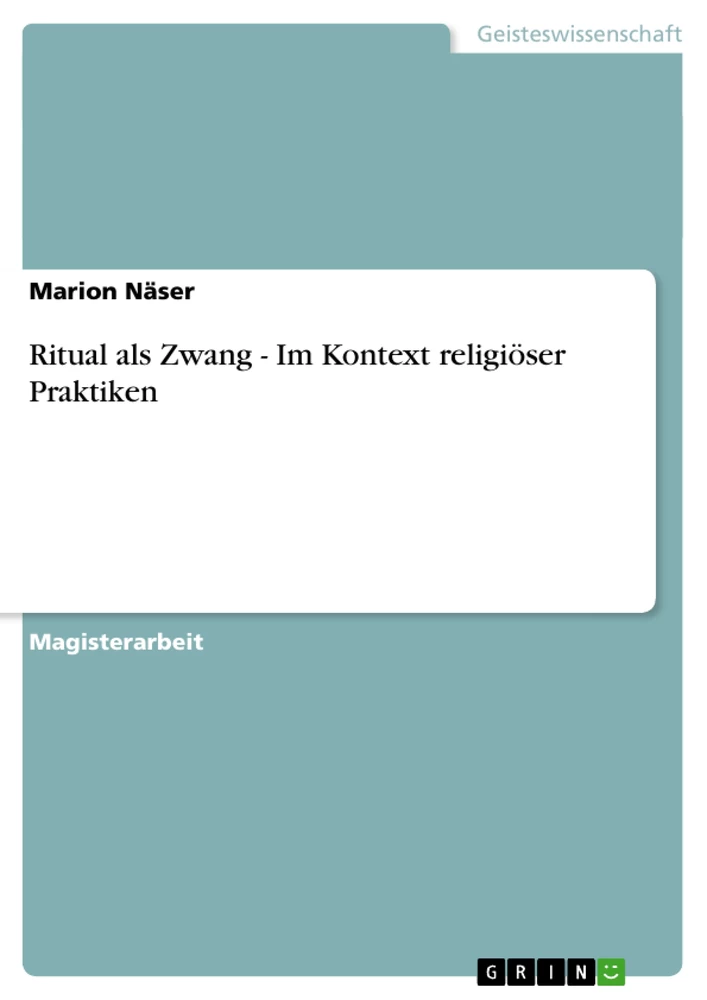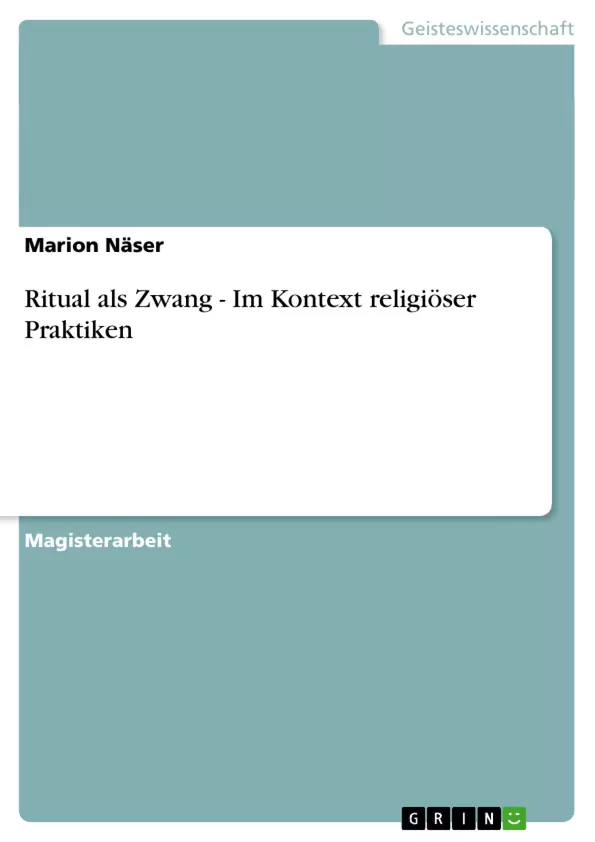Begründung, Intention und Abgrenzung
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, unter welchen individuellen, systematischen, gesellschaftlichen und religiösen Voraussetzungen und aus welchen Gründen religiöse Rituale zu Zwängen werden können.
Zahlreiche Theoretiker betonen die positive – strukturierende, sinngebende – Bedeutung und Notwendigkeit von Ritualen – einer der bekanntesten ist Arnold Gehlen, der die Auffassung vom Ritual als ‚heilsamem’ Zwang vertritt, ohne den der genetisch nur wenig festgelegte Mensch nicht überleben könnte (Entlastungsfunktion).1 In ethnologischen Abhandlungen wird oft der Harmonie durch Rituale geprägter Stammesgesellschaften in exotistischer Manier eine entritualisierte und individualisierte, dem Werteverfall ausgelieferte Moderne gegenübergestellt.2
Kollektive wie individuelle religiöse Rituale können jedoch zu pathologischem Zwangsverhalten werden, wie bereits Sigmund Freud festgestellt hat,3 bzw. unter Zwang ausgeübt werden. Auch der Volkskundler Paul Sartori hat dies in seinem Werk „Sitte und Brauch“ festgestellt: Er bezeichnet Rituale zwar als glücklich machende „erhaltenden Mächte im Volksleben“, stellt auf der anderen Seite jedoch fest:
Aber sie haben auch Tausende in quälende Fesseln geschmiedet, geknechtet und zu Märtyrern gemacht. Sie sind nur allzuoft für das Handeln das geworden, was für das Reden die leere Phrase ist. Sie wollen doch nun einmal allem Tun die typische Form aufdrängen.4
Phänomene dieser Art, die von der Gewohnheit bis zur Zwangsstörung und von der einfachen Konvention bis zum Zwang unter Androhung physischer Sanktionen reichen, finden wir überall auf der Welt, der Problemkomplex betrifft die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung. Dramatische Beispiele sind Massenselbstmorde (v.a. in den als ‚Sekten’5 umschreibbaren neueren Religionen), Folter (z.B. im Rahmen von Hexenprozessen, ritualhaft im „Hexenhammer“ festgelegt) oder Witwenverbrennungen (Indien). Es gibt jedoch auch im ‚normalen’ Alltag unserer Gesellschaft leicht übersehene harmlos wirkende, aber ebenso in das Leben eingreifende rituelle Zwänge, sei es im christlichen Bereich der weihnachtliche Gang zur Kirche, um dem kontrollierenden Blick der Nachbarn Genüge zu tun, die Mechanismen von Beichte und Buße oder die Regeln des Priesterlebens, im jüdischen Bereich die zahlreichen Alltagsbestimmungen oder im Islam Betrituale, Ramadan und Schleiertragen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Begründung, Intention und Abgrenzung
- Methoden und Aufbau der Arbeit
- Das Forschungsfeld
- Europäische Ethnologie/Volkskunde
- Ethnologie/Völkerkunde
- Soziologie
- Psychologie
- Forschungsschwierigkeiten
- Das Ritual. Begriffsbestimmungen und Genese
- Definitionen: Religion und Ritual
- Voraussetzungen
- Religion
- Ritual
- Kernbedingungen
- Randbedingungen
- Arbeitsdefinition
- Genese von Ritualen
- Situative Ritualentstehung
- Perpetuierung
- Ritualgenetisch relevante Situationen
- Thema und Form von Ritualen
- Ritualgenese und Angst
- Innere Bedürfnisse und äußere Erfordernisse: Zur Attraktivität religiöser Rituale
- Das Ritual als Zwang – Phänomenologie
- Rituale und Zwang
- Zwänge im Ritualgeschehen
- Zwang zum Ritualvollzug
- Zwang innerhalb von Ritualen
- Zwang in Bezug auf Art und Weise der Ausführung
- Zwang durch die Dynamik des Rituals
- Zwang durch Rituale
- Promissorische Rituale
- Veränderung der Wirklichkeit
- Innere und äußere Zwangsformen
- Kategorisierung
- Differenzierung innerer – äußerer Zwang
- Zwangsmechanismen
- Innere Zwänge
- Suchtpotential von Ritualen
- Die religiöse Zwangsstörung
- Definition
- Abgrenzung der individuellen Ritualausführung zum Pathologischen
- Phänomenologie
- Haltung der Religionen
- Äußere Zwänge
- Mechanismen
- Erzwungene Zustimmung (forced compliance)
- Kognitive Beeinflussung
- Autoritärer Gehorsam
- Extremform des äußeren Zwanges: ritueller Mißbrauch
- Vom äußeren zum inneren Zwang
- Vorbemerkung
- Mechanismen der Indoktrination
- Sozialisation
- Soziale Überzeugung (coercive persuasion)
- Die Rolle des Körpers
- Die Rolle der Sprache
- Sinnliche Wirkung von Ritualkomponenten und die Veränderung des Bewußtseinszustandes
- Zwang in komprimierter Form: Die Sekte als totale Institution
- Der Zwangscharakter von Sekten
- Mechanismen
- Milieukontrolle
- Forcierte Indoktrination
- Das ‚Lego-Prinzip’
- Die Rolle von Ritualen
- Folgen
- Rahmenbedingungen
- Einflüsse auf die Intensität des Zwanges
- Rituelles Geschehen
- Individuelle Faktoren
- Charakteristika des Rituals
- Rolle
- Soziale und individuelle Relevanz des Rituals
- Ebene der Partizipation
- Reihenfolge der Ausführung
- Häufigkeit der Ausführung
- Prädispositionen
- Allgemeine Vulnerabilität
- Innere Zwänge
- Äußere Zwänge
- Determinanten des Zwangsempfindens
- Individualitätskonzepte
- Denkbarkeit von Alternativen
- Individuelle Voraussetzungen
- Gesellschaftliche Bedingungen von Zwängen
- Allgemeines
- Hintergründe
- Soziale Fortifikationsfunktion ritueller Verpflichtungen
- Herrschaftsaspekte ritueller Gewalt
- Rituale und Wirtschaft
- Gesellschaftsformen und Zwänge
- Mary Douglas: Klassifikationsmuster, Gruppendruck und religiöses System
- Catherine Bell: Ritualstile und Gesellschaft
- Soziale Determinanten von Zwängen (Anwendung der Theorien)
- Gesellschaftliche Stellung und Ritual
- Gender und Ritual
- Gesellschaftlicher Verflechtungsgrad und Zwangspotential
- Heutige Gesellschaft
- Religionsinterne Faktoren
- Ausmaß und Rigidität von Bestimmungen
- Zentrale Thematiken der Religion
- Gottesbild (Charakter)
- Religiöse Autorität
- Religionstypen
- Ausrichtung und Organisationsform
- Die Rolle der Volksfrömmigkeit
- Zwangspotential einzelner Religionen
- Kriterien der Untersuchung
- Nichtchristliche Religionen
- Buddhismus
- Hinduismus
- Islam
- Judentum
- Christliche Religion
- Allgemeines
- Katholizismus
- Protestantismus
- Christliche Religionsgemeinschaften in Deutschland
- Vorschläge für eine empirische Untersuchung
- Schluß
- Fazit
- Offene Fragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Entstehung und Wirkung von Zwang im Kontext religiöser Rituale. Sie versucht, ein theoretisches Modell zu entwickeln, das die verschiedenen Aspekte individueller, sozialer, kultureller und religiöser Bedingungen analysiert, die zum Auftreten und zur Wahrnehmung von Zwang führen können. Die Arbeit strebt nicht die Pathologisierung aller religiösen Rituale an, sondern zielt auf die Isolierung von spezifischen Umständen, unter denen Rituale zum Zwang werden können.
- Ritual als Phänomen sui generis
- Die Genese von Ritualen als Problemlöseattribution
- Internalisierung von Ritualen und die Entstehung von inneren Zwängen
- Mechanismen des äußeren Zwangs und ihre Instrumentalisierung im religiösen Kontext
- Die Rolle von gesellschaftlichen und religiösen Faktoren in der Entstehung von rituellem Zwang
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den Forschungsstand des Themas „Ritual als Zwang“ einführt. Sie definiert die Begriffe Religion und Ritual, analysiert die Entstehung von Ritualen und untersucht deren Attraktivität, die zu Sucht und Zwang führen kann. Kapitel 3 beleuchtet die Phänomenologie von rituellen Zwängen und unterscheidet zwischen Zwängen zum Ritualvollzug, Zwang innerhalb von Ritualen und Zwang durch Rituale. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den verschiedenen Mechanismen der Internalisierung von Ritualen und der Entstehung von inneren (z.B. Sucht) und äußeren (z.B. soziale Kontrolle) Zwängen. Es wird auch der Sonderfall von Sekten als totale Institutionen analysiert. Kapitel 5 untersucht verschiedene Rahmenbedingungen, die das Auftreten und die Intensität von rituellen Zwängen beeinflussen, wie z.B. gesellschaftliche Struktur, individuelle Faktoren und religionsinterne Faktoren. Kapitel 6 analysiert das Zwangspotential verschiedener Religionen (Buddhismus, Hinduismus, Islam, Judentum und Christentum) und beleuchtet dabei die verschiedenen Formen von rituellen Zwängen innerhalb dieser Religionen. Schließlich werden im Kapitel 7 Vorschläge für eine empirische Untersuchung des Themas „Ritual als Zwang“ unterbreitet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit behandelt zentrale Themen und Begriffe wie religiöse Rituale, ritueller Zwang, rituelle Zwangsstörung (scrupulosity), Sozialisation, Konformitätsdruck, Indoktrination, Milieukontrolle, Trance, forced compliance, kognitive Dissonanz, gesellschaftliche Bedingungen von Zwängen, Religionsinterne Faktoren, Volksfrömmigkeit, verschiedene Religionen und ihre Rituale, und Vorschläge für eine empirische Untersuchung.
- Quote paper
- M.A. Marion Näser (Author), 2004, Ritual als Zwang - Im Kontext religiöser Praktiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37564