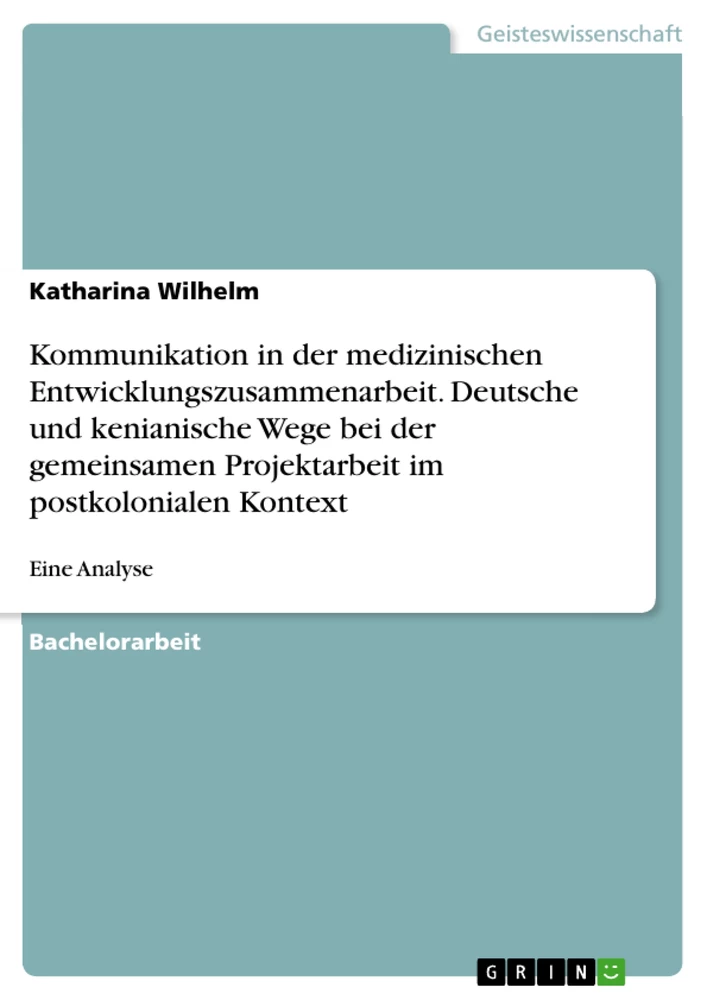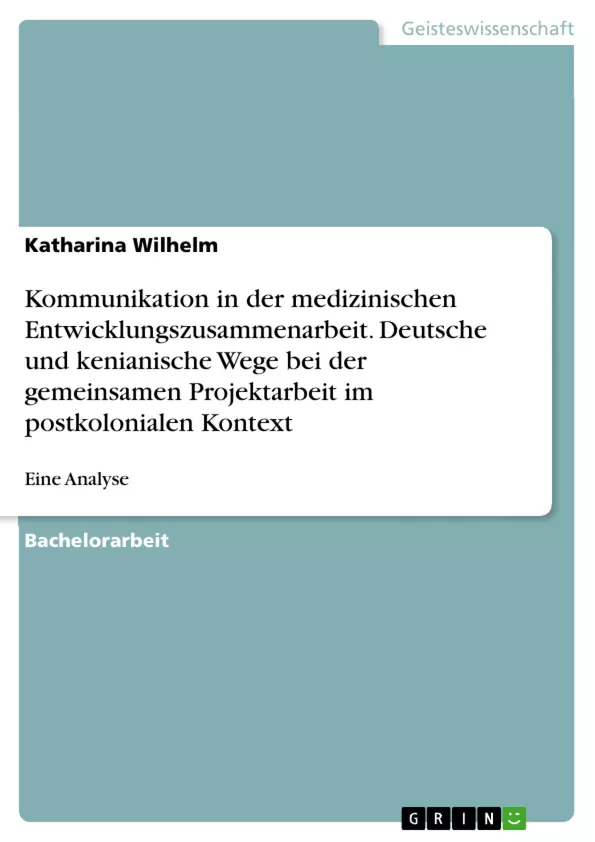Es gibt wenige Bereiche, in denen Medizinethnologen so praktisch gefordert und eingesetzt werden wie in der medizinischen Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Die Arbeit der Medizinethnologen in der jüngsten Ebola-Krise in Westafrika schaffte es sogar bis in die deutschen Leitmedien. Inhorn und Wentzell erklären die verstärkte Neigung der Ethnologen zu dieser Art des Feldeinsatzes durch „[...]the dire need for both compassion and humanitarian activism regarding global health inequalities and the numerous sources of disease and suffering around the globe.“ (2012).
Gleichzeitig gehören Entwicklungs- und humanitäre Zusammenarbeit bzw. der Umgang und die Arbeit mit ihnen nach wie vor zu den am meisten diskutierten Themenfeldern in der Ethnologie. So konstatiert etwa Calhoun: „Too often, the story seems to be: Moral white people come from the rich world to care for those in backward, remote places.“ (2010), während Lachenmann behauptet: „Die Medizin kann geradezu als Inbegriff oder Metapher für das in Kolonialismus und Neokolonialismus charakteristische patriarchalische System der systematischen Entmündigung der Eroberten oder Kolonisierten aufgefasst werden [...]“ (1982).
Diese und weitere Standpunkte, die die medizinethnologische Literatur liefern, werfen für mich einige Fragen auf. Kann man - angesichts der vielfach aufkommenden Vorwürfe post- und neokolonialistischer Strukturen - überhaupt wie einer meiner Informanten von Entwicklungszusammenarbeit zwischen ausländischem und einheimischem medizinischem Personal sprechen? Wieso gelingt es den an solchen Projekten beteiligten Seiten anscheinend nach wie vor nicht, ein produktives und gleichberechtigtes Verhältnis zueinander aufzubauen? Oder kann man diese Vorwürfe als nicht mehr zeitgemäße Thesen einstufen, die nur noch laut werden, weil es, so könnte man fast vermuten, schon zum „ethnologisch guten Ton“ gehört, der Entwicklungszusammenarbeit kritisch gegenüber zu stehen?
Um diese Fragen anhand des Verlaufs einer aktuellen, exemplarischen medizinischen Entwicklungszusammenarbeit im Jahr 2015 zu beantworten, untersuche ich ein Projekt in der kenianischen Hauptstadt Nairobi und beleuchtete dieses empirisch während einer zweiwöchigen Feldforschung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die medizinische Situation in Kenia
- 2.1. Die medizinische Situation in Kenia im (post-)kolonialen Kontext
- 3. Theoretischer Rahmen
- 3.1. Medizinische Entwicklungszusammenarbeit im Zeichen der Global Health - eine kritische Betrachtung
- 3.2. Being a Dactari - Identitätsbildung und Beziehungen von medizinischem Personal in Kenia und im allgemeinen biomedizinischen Kontext.
- 3.3. Kommunikation - eine systemtheoretische Perspektive
- 4. Das Projekt: Der Deutsch-Ostafrikanische Kulturklub Kaiserslautern Freunde Afrikas e. V. im SOS Medical Centre in Nairobi Buru-Buru
- 5. Forschung und Analysemethode
- 6. Exemplarische Analyse der deutsch-kenianischen Kommunikationswege in der gemeinsamen Projektarbeit
- 6.1. Grenzen und Konflikte
- 6.2. Positive Abläufe und Möglichkeiten
- 7. Zusammenfassung, Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Kommunikation in der medizinischen Entwicklungszusammenarbeit anhand eines Projekts in Kenia. Ziel ist es, die Kooperation des deutschen und kenianischen Pflegepersonals im Projekt zu analysieren und die Herausforderungen und Chancen in der interkulturellen Zusammenarbeit zu beleuchten.
- Postkoloniale Strukturen und ihre Auswirkungen auf die Zusammenarbeit
- Beziehungen und Identitätsbildung von medizinischem Personal in Kenia
- Kommunikation als Schlüssel zur erfolgreichen Zusammenarbeit
- Analyse von Grenzen und Konflikten in der deutsch-kenianischen Kooperation
- Identifizierung positiver Abläufe und Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Die medizinische Situation in Kenia
- Kapitel 3: Theoretischer Rahmen
- Kapitel 4: Das Projekt
- Kapitel 5: Forschung und Analysemethode
- Kapitel 6: Exemplarische Analyse der deutsch-kenianischen Kommunikationswege in der gemeinsamen Projektarbeit
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Kontext der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der medizinischen Entwicklungszusammenarbeit im postkolonialen Kontext und kritisiert die oft unkritische Herangehensweise an solche Projekte.
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die medizinische Situation in Kenia im (post-)kolonialen Kontext. Es analysiert die Durchsetzung der Biomedizin gegenüber der traditionellen Medizin und die Herausforderungen des Gesundheitssystems.
Kapitel 3 liefert den theoretischen Rahmen für die Analyse. Es geht auf die Bedeutung der Global Health für die medizinische Entwicklungszusammenarbeit ein, untersucht die Identitätsbildung von medizinischem Personal in Kenia und stellt die systemtheoretische Perspektive auf Kommunikation vor.
Dieses Kapitel beschreibt das Projekt „Der Deutsch-Ostafrikanische Kulturklub Kaiserslautern Freunde Afrikas e. V. im SOS Medical Centre in Nairobi Buru-Buru“ und stellt die Forschungsergebnisse und Methoden vor.
Kapitel 5 fokussiert auf die Methoden der Forschung und die Herangehensweise an die Analyse der deutsch-kenianischen Kommunikationswege im Projekt.
Kapitel 6 analysiert die deutsch-kenianische Kommunikation im Projekt anhand von exemplarischen Beispielen. Es beleuchtet sowohl Grenzen und Konflikte als auch positive Abläufe und Möglichkeiten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche medizinische Entwicklungszusammenarbeit, Kommunikation, interkulturelle Zusammenarbeit, Postkolonialismus, Biomedizin, traditionelle Medizin, Identitätsbildung und systemtheoretische Perspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Kommunikation in der medizinischen Entwicklungszusammenarbeit am Beispiel eines deutsch-kenianischen Projekts in Nairobi unter Berücksichtigung postkolonialer Kontexte.
Welche Rolle spielen postkoloniale Strukturen in der medizinischen Hilfe?
Die Arbeit analysiert, wie historische Machtstrukturen und das patriarchalische System des Kolonialismus die heutige Zusammenarbeit und die Identitätsbildung des medizinischen Personals beeinflussen.
Warum ist Kommunikation in diesen Projekten so wichtig?
Kommunikation wird als Schlüssel zur erfolgreichen Zusammenarbeit gesehen. Die Studie beleuchtet, wie Missverständnisse entstehen und wie ein gleichberechtigtes Verhältnis aufgebaut werden kann.
Welches konkrete Projekt wurde in Kenia untersucht?
Untersucht wurde das Projekt des Deutsch-Ostafrikanischen Kulturklubs Kaiserslautern Freunde Afrikas e. V. im SOS Medical Centre in Nairobi Buru-Buru.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse der exemplarischen Analyse?
Die Analyse identifiziert sowohl Grenzen und Konflikte in der deutsch-kenianischen Kooperation als auch positive Abläufe und Möglichkeiten zur Verbesserung der gemeinsamen Arbeit.
- Quote paper
- Katharina Wilhelm (Author), 2016, Kommunikation in der medizinischen Entwicklungszusammenarbeit. Deutsche und kenianische Wege bei der gemeinsamen Projektarbeit im postkolonialen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375790