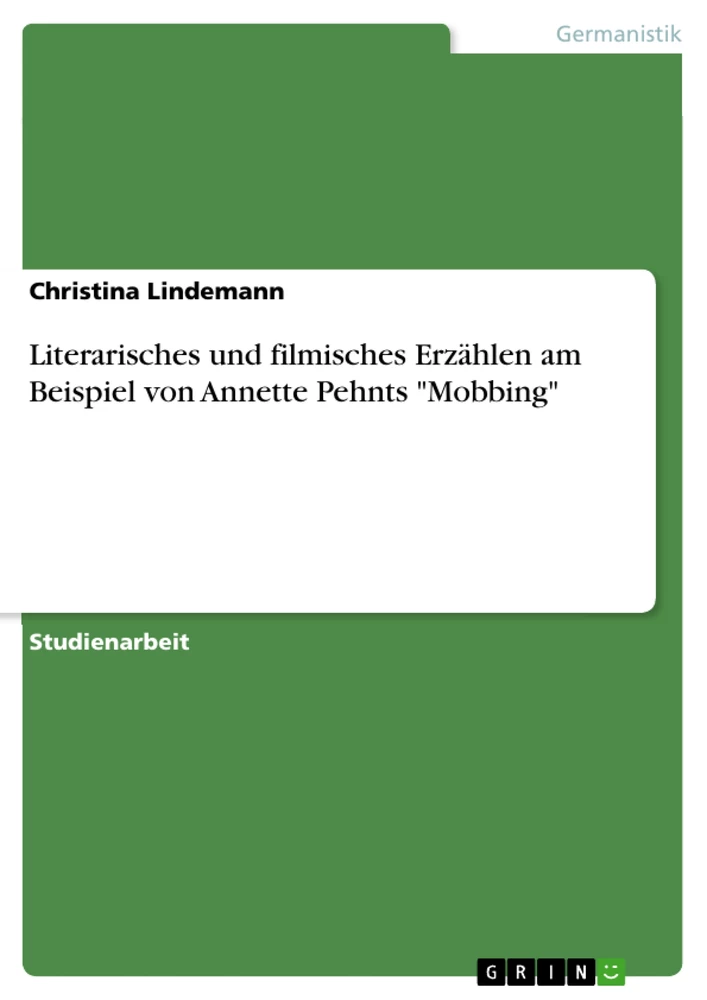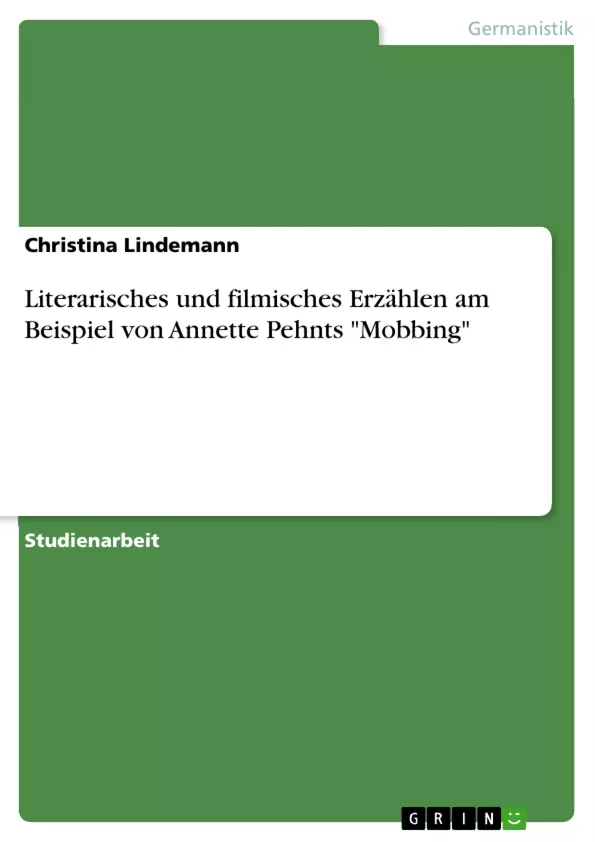In meiner Arbeit möchte ich mich mit dieser Problematik einer solchen Literaturverfilmung auseinandersetzen und diese mit dem literarischen Ausgangswerk vergleichen. Dazu habe ich mir Annette Pehnts Roman „Mobbing“ und die gleichnamige Verfilmung ausgesucht. Anhand dieses Beispiels möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, ob und inwiefern der Film den Roman umsetzt. Um eine filmische Adaption mit der zugehörigen Buchvorlage vergleichen zu können, muss man sich zwingend zuerst mit den theoretischen Grundlagen vom filmischen und literarischen Erzählen auseinandersetzen. Im folgenden Abschnitt werde ich zunächst den Begriff der Literaturverfilmung definieren und die Geschichte dieser kurz darlegen. Anschließend werde ich kurz auf die Probleme der Literaturverfilmung eingehen. Danach werde ich das Erzählen in Literatur und Film näher betrachten und mich dabei auf die Kategorien Zeit und Modus nach Gerard Genette konzentrieren. Auch die Rolle des Zuschauers wird in diesem Zusammenhang näher beleuchtet. In meiner anschließenden narratorischen Analyse fasse ich zunächst den Inhalt des Romans „Mobbing“ kurz zusammen und beschäftige mich darauf mit der Erzählsituation und der Symbolik im literarischen Werk und der Verfilmung und vergleiche diese anschließend, bevor ich meine Arbeit mit meinem Fazit abschließe.
Das Erzählen ist ein Teil der menschlichen Kultur, seit der Mensch die Sprache beherrscht. Jeder einzelne von uns kann zum Erzähler werden und von seinen Träumen, Gefühlen, Gedanken und Erlebnissen berichten. Während zu Beginn der Menschheitsgeschichte nahezu ausschließlich mündliches Erzählen betrieben wurde, änderte sich dieses mit der Erfindung des Buchdrucks. Bücher und die darin enthaltenen Geschichten waren ab dem Zeitpunkt für jeden zugänglich. Unzählige Geschichten wurden in Form von Büchern verewigt. Doch die Sprache ist nicht das einzige Medium der Narration. Auch mit Bildern werden Geschichten erzählt, seit einem Jahrhundert bewegen sich diese sogar. Der Film ist das neuzeitliche Medium des Erzählens und begeistert täglich Millionen von Menschen mit seinen Geschichten. Eine besondere Form des Erzählens tritt auf, wenn sich die schriftliche und die filmische Narration verbinden: Die Literaturverfilmung. Oftmals stößt diese aber vielerorts auf Kritik. Die Verfilmung sei nicht „werktreu“ und könne der Buchvorlage nicht gerecht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Die Literaturverfilmung: Definition und Geschichte
- Probleme der Literaturverfilmung
- Das Erzählen in Literatur und Film
- Die Zeit (nach Genette)
- Der Modus (nach Genette)
- Die Rolle des Zuschauers
- Narratorische Analyse
- Annette Pehnts Roman „Mobbing“
- Die Erzählsituation des literarischen Texts
- Symbolik im Roman
- Der Film Mobbing
- Die Erzählsituation der Verfilmung
- Symbolik im Film
- Vergleich zwischen Roman und Verfilmung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Problematik der Literaturverfilmung und analysiert die Umsetzung von Annette Pehnts Roman „Mobbing“ in die gleichnamige Verfilmung. Dabei soll untersucht werden, inwieweit der Film den Roman umsetzt und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich in Bezug auf die Erzählsituation, die Symbolik und die narrative Gestaltung beider Medien ergeben.
- Definition und Geschichte der Literaturverfilmung
- Probleme der Literaturverfilmung
- Vergleich der Erzählformen in Literatur und Film
- Analyse der Erzählsituation im Roman und der Verfilmung
- Untersuchung der Symbolik in beiden Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Literaturverfilmung ein und erläutert die Relevanz des Themas sowie die Fragestellung der Arbeit. Der Roman „Mobbing“ von Annette Pehnt und die gleichnamige Verfilmung werden als Grundlage der Analyse vorgestellt. Die Kapitelstruktur der Arbeit wird skizziert.
Theoretische Grundlagen
Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" liefert die notwendigen Begriffe und Konzepte für die Analyse. Die Literaturverfilmung wird definiert und ihre Geschichte anhand von Beispielen aus der Filmgeschichte dargestellt. Die spezifischen Probleme, die sich im Kontext der Literaturverfilmung ergeben, werden beleuchtet, zum Beispiel die Frage der „Treue“ gegenüber der Vorlage und die unterschiedlichen medienspezifischen Möglichkeiten von Literatur und Film.
Das Erzählen in Literatur und Film
Dieses Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Unterschieden und Gemeinsamkeiten des Erzählens in Literatur und Film. Die Kategorien "Zeit" und "Modus" nach Gerard Genette werden als analytisches Instrument eingeführt und ihre Anwendung im jeweiligen Medium erläutert. Die Bedeutung der Rolle des Zuschauers/Lesers für die Rezeption der Erzählung wird untersucht.
Narratorische Analyse
Der Fokus liegt auf der Analyse der Erzählsituation, der Symbolik und des narrativen Stils im Roman und in der Verfilmung von „Mobbing“. Der Roman wird kurz zusammengefasst und anschließend die Erzählsituation und die Symbolik des literarischen Textes untersucht. Der Film „Mobbing“ wird ebenfalls hinsichtlich seiner Erzählsituation und der Symbolik betrachtet. Die Analyse beider Medien wird dann miteinander verglichen, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Literaturverfilmung, Erzählformen, Narratologie, Romananalyse, Filmanalyse, Vergleichende Medienanalyse, Symbolismus, „Mobbing“ von Annette Pehnt, und die damit verbundenen Konzepte wie Zeit, Modus, Erzählsituation, und die Rolle des Zuschauers/Lesers.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Roman „Mobbing“ filmisch umgesetzt?
Die Arbeit analysiert, inwiefern der Film die Erzählsituation, Symbolik und narrative Struktur von Annette Pehnts Roman übernimmt oder verändert.
Was sind die Hauptprobleme bei Literaturverfilmungen?
Oft wird mangelnde „Werktreue“ kritisiert. Ein zentrales Problem ist, dass Film und Literatur unterschiedliche medienspezifische Erzählmöglichkeiten nutzen.
Welche Rolle spielen Zeit und Modus nach Genette?
Diese Kategorien dienen dazu, die Zeitstruktur (z. B. Rückblenden) und die Perspektive (Modus) in Buch und Film systematisch zu vergleichen.
Gibt es Unterschiede in der Symbolik zwischen Buch und Film?
Ja, die Analyse zeigt, wie literarische Symbole im Film visuell übersetzt werden und ob dabei neue Bedeutungsebenen entstehen.
Ist der Film „Mobbing“ dem Roman treu?
Die Arbeit kommt zu einem Fazit, das die Stärken und Schwächen der Adaption im Vergleich zur Vorlage bewertet.
- Quote paper
- Christina Lindemann (Author), 2016, Literarisches und filmisches Erzählen am Beispiel von Annette Pehnts "Mobbing", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375844