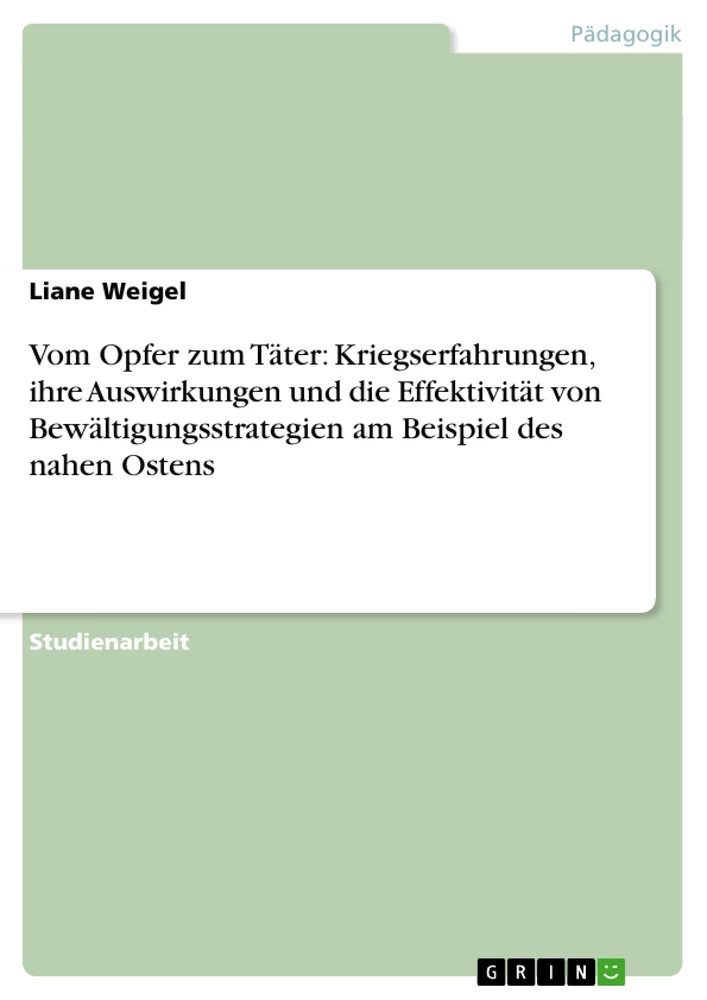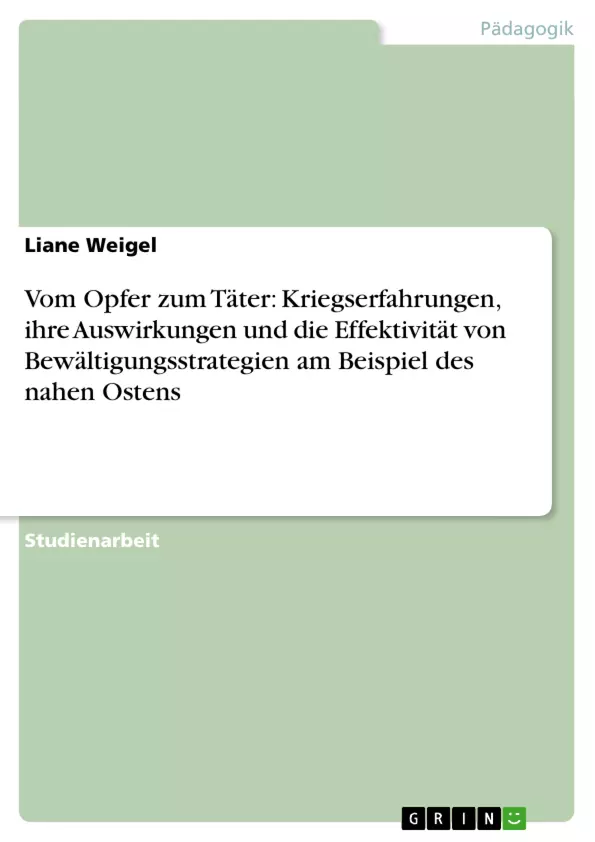Die folgende Arbeit widmet sich deshalb den Menschen, deren Verhalten und Entwicklung maßgeblich durch eine „Kriegsumwelt“ bestimmt ist: den Kindern, die im/durch Krieg sozialisiert werden. Ob als Zeugen der Verbrennung ihrer Häuser, der Vertreibung ihrer Familien oder Nachbarn, der Verhaftung von Müttern, Vätern oder Geschwistern oder als direkte Opfer politischer Gewalt durch Verletzung, Verstümmelung oder Missbrauch- alles Erlebnisse, die in ihrer psychosozialen Entwicklung zu ständigen Begleitern werden- sie scheinen immer die eigentlichen Verlierer im Krieg zu sein. Diese Arbeit kann nun aber nicht den Anspruch erheben, die Kriegssituation als solche verändern zu können. Sie soll vielmehr helfen, das Verhalten der Kinder und spezifische Tendenzen innerhalb ihrer Entwicklung, die häufig auch eine Entwicklung von Opfern zu Tätern ist, im Hinblick auf die Bewältigung/Effektivität der Bewältigungsstrategien in Kriegssituationen zu erklären bzw. zu verstehen. Sie wird so auf der Grundlage verschiedener Studien aufzeigen, wie Kinder im nahen Osten Krieg erfahren haben. Es soll dabei zunächst dargestellt werden, wie die Kriegssituation für Kinder im nahen Osten gekennzeichnet war, welche Erfahrungen mit Krieg gemacht wurden, wie Sozialisation im Krieg stattfand, in wieweit Familienverhältnisse verändert wurden und welche Bewältigungsstrategien im Umgang mit Krieg und seinen Auswirkungen entwickelt wurden, um dann allgemein Aussagen zur Effektivität bestimmter Bewältigungsstrategien in Situationen politischer Gewalt zu treffen sowie hier auch speziell die Rolle der Intifada innerhalb der Entwicklung vom Opfer zum Täter und im Bezug auf die lange Dauer des Krieges zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Krieg als „Alltagsphänomen“
- 3. Sozialisation im Krieg: Bewältigungsstrategien und ihre Effektivität
- 3.1. Identitätsfindung über den Konflikt: Ich- Identität vs. Wir- Identität
- 3.2. Ideologie als Schutzfaktor
- 3.3. Konstruktive Aggression statt Depression: Intifada als Therapie
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Kriegserfahrungen auf Kinder im Nahen Osten und analysiert die Effektivität verschiedener Bewältigungsstrategien. Das Ziel ist es, das Verhalten von Kindern in Kriegsumgebungen zu verstehen und die Entwicklung von Opfern zu Tätern zu erklären.
- Auswirkungen von Krieg auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern
- Bewältigungsstrategien von Kindern in Kriegsgebieten
- Die Rolle der Identität (Ich- vs. Wir-Identität) im Umgang mit Kriegserfahrungen
- Der Einfluss von Ideologie als Schutzfaktor
- Die Intifada als Bewältigungsstrategie und ihre Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Krieg und Gewalt im Kontext des Wohlstands der westlichen Welt dar und hebt den Fokus auf Kinder im Nahen Osten als Betroffene von Krieg und dessen Auswirkungen. Die Arbeit will das Verhalten der Kinder und deren Entwicklung vom Opfer zum Täter erklären und die Effektivität von Bewältigungsstrategien untersuchen. Sie basiert auf verschiedenen Studien und beleuchtet Kriegserfahrungen, Sozialisation im Krieg, Veränderungen der Familienverhältnisse und entwickelte Bewältigungsstrategien im Nahen Osten, um schließlich die Effektivität bestimmter Strategien in Situationen politischer Gewalt zu bewerten und die Rolle der Intifada zu verdeutlichen.
2. Krieg als „Alltagsphänomen“: Dieses Kapitel widerlegt die Annahme von Krieg als Naturereignis und definiert ihn als machtpolitisches, wirtschaftliches oder ideologisches Mittel organisierter bewaffneter Gewalt. Es hebt die Unterschiede zwischen klassischen Kriegen und modernen Konflikten hervor, wobei letztere oft langwierige, zermürbende Konflikte in Entwicklungsländern sind, die die Grenzen zwischen Kämpfern und Zivilisten verschwimmen lassen. Kinder werden oft gezwungen, sich am Kriegsgeschehen zu beteiligen. Das Kapitel betont die besondere Vulnerabilität von Kindern aufgrund ihres Entwicklungsprozesses und die langfristigen Folgen von Kriegserfahrungen wie Unterernährung, Krankheiten, Traumata, veränderte soziale Werte und Zwangsrekrutierung.
Schlüsselwörter
Krieg, Kinder, Naher Osten, Sozialisation, Bewältigungsstrategien, Identitätsfindung, Ideologie, Intifada, Opfer, Täter, psychosoziale Entwicklung, Trauma, Gewalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Auswirkungen von Kriegserfahrungen auf Kinder im Nahen Osten
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Kriegserfahrungen auf Kinder im Nahen Osten und analysiert die Effektivität verschiedener Bewältigungsstrategien. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung von Opfern zu Tätern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen von Krieg auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern, die Bewältigungsstrategien von Kindern in Kriegsgebieten, die Rolle der Identität (Ich- vs. Wir-Identität) im Umgang mit Kriegserfahrungen, den Einfluss von Ideologie als Schutzfaktor und die Intifada als Bewältigungsstrategie und deren Auswirkungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Krieg als „Alltagsphänomen“, ein Kapitel zur Sozialisation im Krieg mit Unterkapiteln zu Identitätsfindung, Ideologie als Schutzfaktor und der Intifada als Therapie, sowie ein Fazit.
Wie wird Krieg in der Arbeit definiert?
Krieg wird nicht als Naturereignis, sondern als machtpolitisches, wirtschaftliches oder ideologisches Mittel organisierter bewaffneter Gewalt definiert. Die Arbeit hebt die Unterschiede zwischen klassischen und modernen Konflikten hervor, wobei letztere oft langwierige Konflikte in Entwicklungsländern sind, die die Grenzen zwischen Kämpfern und Zivilisten verschwimmen lassen.
Welche Rolle spielen Kinder im Krieg?
Kinder werden oft gezwungen, sich am Kriegsgeschehen zu beteiligen und sind aufgrund ihres Entwicklungsprozesses besonders vulnerabel. Langfristige Folgen von Kriegserfahrungen für Kinder sind Unterernährung, Krankheiten, Traumata, veränderte soziale Werte und Zwangsrekrutierung.
Welche Bewältigungsstrategien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Identitätsfindung (Ich- vs. Wir-Identität) im Kontext des Krieges, die Rolle der Ideologie als Schutzfaktor und die Intifada als Bewältigungsstrategie. Die Effektivität dieser Strategien wird analysiert.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, das Verhalten von Kindern in Kriegsumgebungen zu verstehen und die Entwicklung von Opfern zu Tätern zu erklären, sowie die Effektivität verschiedener Bewältigungsstrategien zu untersuchen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Krieg, Kinder, Naher Osten, Sozialisation, Bewältigungsstrategien, Identitätsfindung, Ideologie, Intifada, Opfer, Täter, psychosoziale Entwicklung, Trauma, Gewalt.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf verschiedenen Studien und beleuchtet Kriegserfahrungen, Sozialisation im Krieg, Veränderungen der Familienverhältnisse und entwickelte Bewältigungsstrategien im Nahen Osten, um schließlich die Effektivität bestimmter Strategien in Situationen politischer Gewalt zu bewerten und die Rolle der Intifada zu verdeutlichen.
- Citation du texte
- Liane Weigel (Auteur), 2004, Vom Opfer zum Täter: Kriegserfahrungen, ihre Auswirkungen und die Effektivität von Bewältigungsstrategien am Beispiel des nahen Ostens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37594