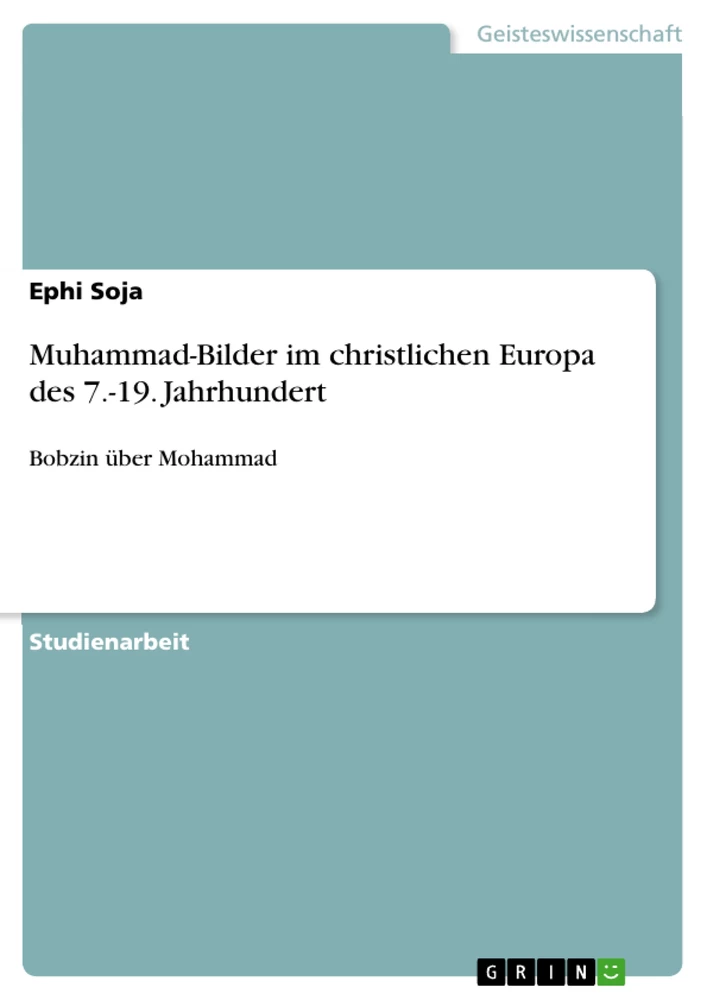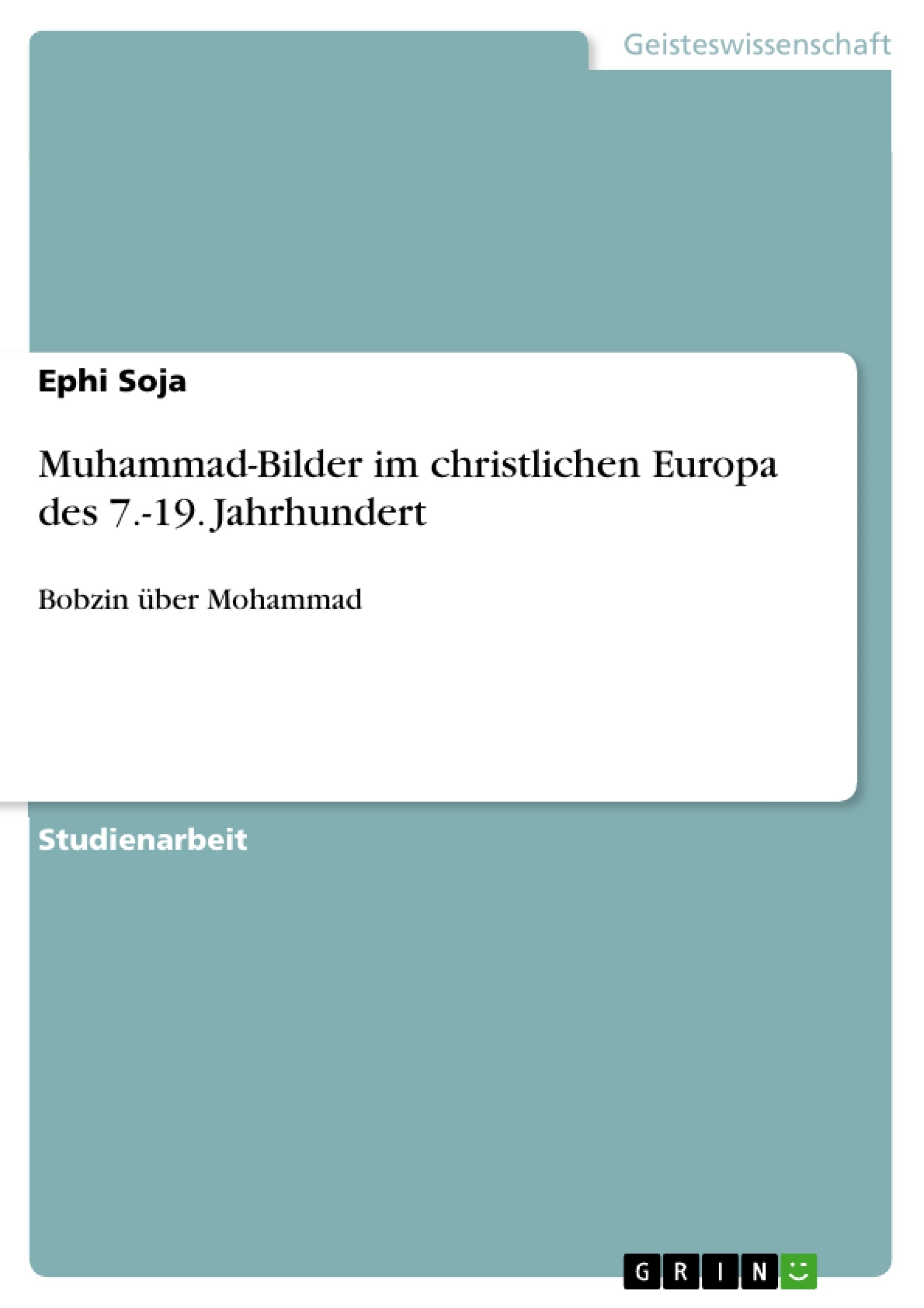In dieser vorliegenden Arbeit soll es im Wesentlichen darum gehen, ausgewählte Passagen aus Bobzins Kapitel über die christlich geprägten westlichen Muhammad-Bilder vom 7. bis 19. Jahrhundert zusammenzufassen, diese Stellen zu kommentieren und gegebenenfalls ergänzende Informationen zu geben. In einem Fazit geht es darum, aufzuzeigen, wie die Entwicklung der Muhammad-Bilder über die Jahrhunderte hinweg zu bewerten sind, und ebenso darum, weiteren Forschungsausblick zu geben. Hiermit sollen Aspekte genannt werden, die Bobzin in seinem oben genannten Kapitel unerwähnt lässt – um eine Anregung für die weitere Recherche zu diesem Thema zu geben.
Einer derjenigen, der Muhammad als „Pseudoprophet“ genannt hat, war beispielsweise Johannes von Damaskus. In seinem Werk „Quelle der Erkenntnis“ – „Pege gnoseos“ auf Griechisch, das auch als das sogenannte „Buch der Häresien“ gilt und aus etwa dem Anfang des 8 Jahrhunderts entstammt wird ebenso erkenntlich, dass Johannes von Damaskus den Islam noch nicht ganz als eigenständige Religion wahrnahm, sondern als eine christliche Irrlehre. Das Interessante dabei ist, dass sich das Prädikat „pseudoprohetes“ in sehr vielen Werken christlicher Polemik verbreitet hat und in den ersten Jahrhunderten des Islams zur Standardbezeichnung im christlichen Abendland wurde.3 Ebenso schreibt Johannes von Damaskus, der beruflich zunächst Hofbeamter bei einem omajjadischen Kalifen war, aber dann mit zunehmenden Ressintements gegenüber Christen entschied, sich dem Mönchtum zuzuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Muḥammad, der pseudoprophetes bis zum „,Antichrist”
- Muḥammad, der „,Häretiker\" genannt wird
- Muḥammad, der für einen „Betrüger“ gehalten wird
- Muḥammad, der als „Epileptiker\" dargestellt wird
- Muḥammad in der Literatur als „,'Gott' neben anderen Göttern”
- Eine Wendung in der Darstellung von Muḥammad-Bildern
- Muḥammad, der „Gesetzgeber”
- Muḥammad, der „Held”
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Darstellung des Propheten Muḥammad im christlichen Europa vom 7. bis 19. Jahrhundert, basierend auf dem Werk „Mohammed“ von Hartmut Bobzin. Ziel ist es, ausgewählte Passagen aus Bobzins Ausführungen zu den westlichen Muḥammad-Bildern zusammenzufassen, zu kommentieren und gegebenenfalls ergänzende Informationen zu liefern. Die Arbeit strebt zudem an, die Entwicklung dieser Bilder über die Jahrhunderte zu bewerten und einen Ausblick auf weitere Forschungsaspekte zu geben.
- Die Entwicklung der christlichen Wahrnehmung Muḥammads im Laufe der Geschichte.
- Die verschiedenen Bezeichnungen und Charakterisierungen, die Muḥammad in der christlichen Literatur und im Denken des Mittelalters und der frühen Neuzeit zugewiesen wurden.
- Die Ursachen für die negative und später positive Darstellung Muḥammads in der christlichen Welt.
- Die Bedeutung des Islam und der islamischen Religion im Kontext der europäischen Geschichte.
- Die Rolle der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse auf die Konstruktion von Muḥammad-Bildern.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der einleitende Abschnitt stellt das Werk von Hartmut Bobzin und seine zentrale These vor, dass Muḥammad im christlichen Abendland über lange Zeit negativ dargestellt wurde, bevor er später überschwenglich gelobt wurde. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der christlichen Muḥammad-Bilder vom 7. bis 19. Jahrhundert.
- Muḥammad, der pseudoprophetes bis zum „,Antichrist”: Dieses Kapitel beleuchtet die frühesten christlichen Darstellungen von Muḥammad als „Pseudoprophet“ und „Antichrist“. Dabei wird Johannes von Damaskus als ein wichtiger Vertreter dieser Sichtweise vorgestellt. Die Gründe für diese negative Bewertung werden in der Etablierung der hierarchischen Ordnung der Kirche und in den schlechten Erfahrungen mit verschiedenen christlichen prophetischen Bewegungen gesehen.
- Muḥammad, der „,Häretiker\" genannt wird: Das Kapitel analysiert die Bezeichnung Muḥammads als „Häretiker“, die besonders in Dantes „Göttlicher Komödie“ zum Ausdruck kommt. Es werden die Gründe für die christliche Sichtweise auf Muḥammad als Abweichler und Spalter des Christentums dargestellt.
- Muḥammad, der für einen „Betrüger“ gehalten wird: Dieses Kapitel behandelt die Darstellung Muḥammads als „Betrüger“, die beispielsweise in Jacobus de Voraignes „Goldener Legende“ aus dem 13. Jahrhundert zum Ausdruck kommt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der christlichen Wahrnehmung des Propheten Muḥammad und beleuchtet die damit verbundenen Bezeichnungen und Charakterisierungen wie „Pseudoprophet“, „Antichrist“, „Häretiker“ und „Betrüger“. Weitere wichtige Themen sind die Entwicklung der Muḥammad-Bilder im Laufe der Geschichte, die Gründe für die negative und später positive Darstellung und die Bedeutung des Islam im Kontext der europäischen Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde der Prophet Muhammad im mittelalterlichen Europa wahrgenommen?
Über Jahrhunderte dominierten negative Darstellungen. Muhammad wurde oft als "Pseudoprophet", "Antichrist", "Häretiker" oder "Betrüger" bezeichnet, um den Islam gegenüber dem Christentum abzuwerten.
Wer war Johannes von Damaskus und was schrieb er über den Islam?
Johannes von Damaskus war ein einflussreicher christlicher Theologe des 8. Jahrhunderts. Er betrachtete den Islam nicht als eigenständige Religion, sondern als eine christliche Irrlehre (Häresie).
Warum wurde Muhammad oft als "Häretiker" bezeichnet?
Aus christlicher Sicht galt er als jemand, der Teile der christlichen Lehre übernommen, aber verfälscht hatte, was ihn in der polemischen Literatur als "Abweichler" erscheinen ließ.
Wann änderte sich das Bild von Muhammad in Europa?
Eine Wendung trat verstärkt ab der Zeit der Aufklärung und Romantik ein, als Muhammad zunehmend auch als bedeutender "Gesetzgeber" oder "Held" der Weltgeschichte wahrgenommen wurde.
Welche Rolle spielt Hartmut Bobzins Werk für dieses Thema?
Bobzin analysiert umfassend die historische Entwicklung der westlichen Muhammad-Bilder und zeigt auf, wie politische und religiöse Konflikte die Konstruktion dieser Bilder beeinflusst haben.
- Citation du texte
- Ephi Soja (Auteur), 2017, Muhammad-Bilder im christlichen Europa des 7.-19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376226