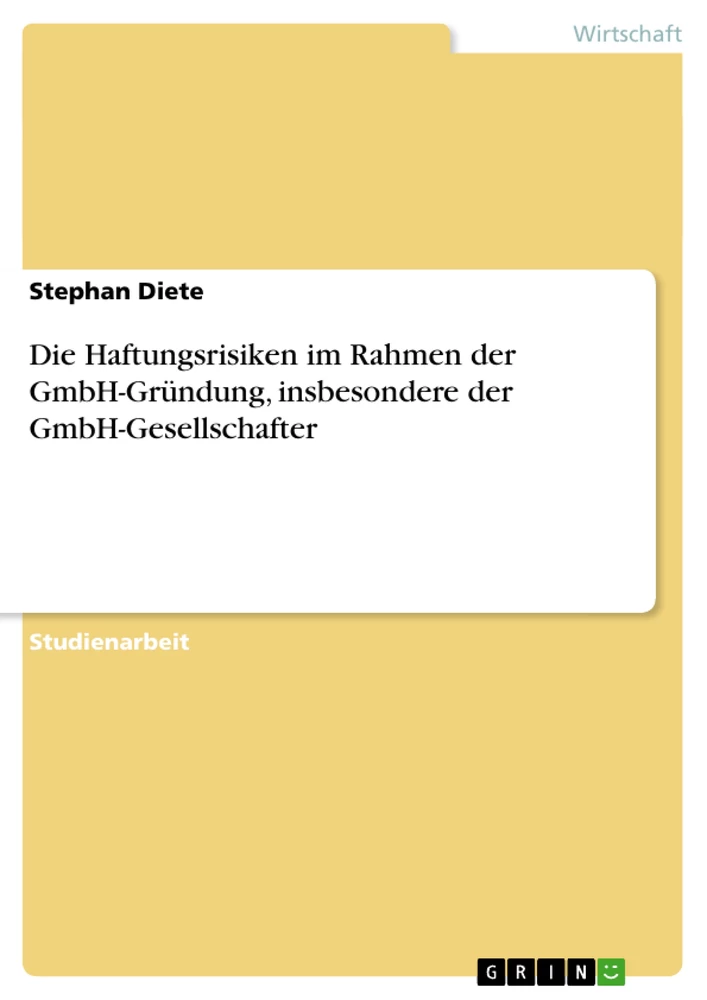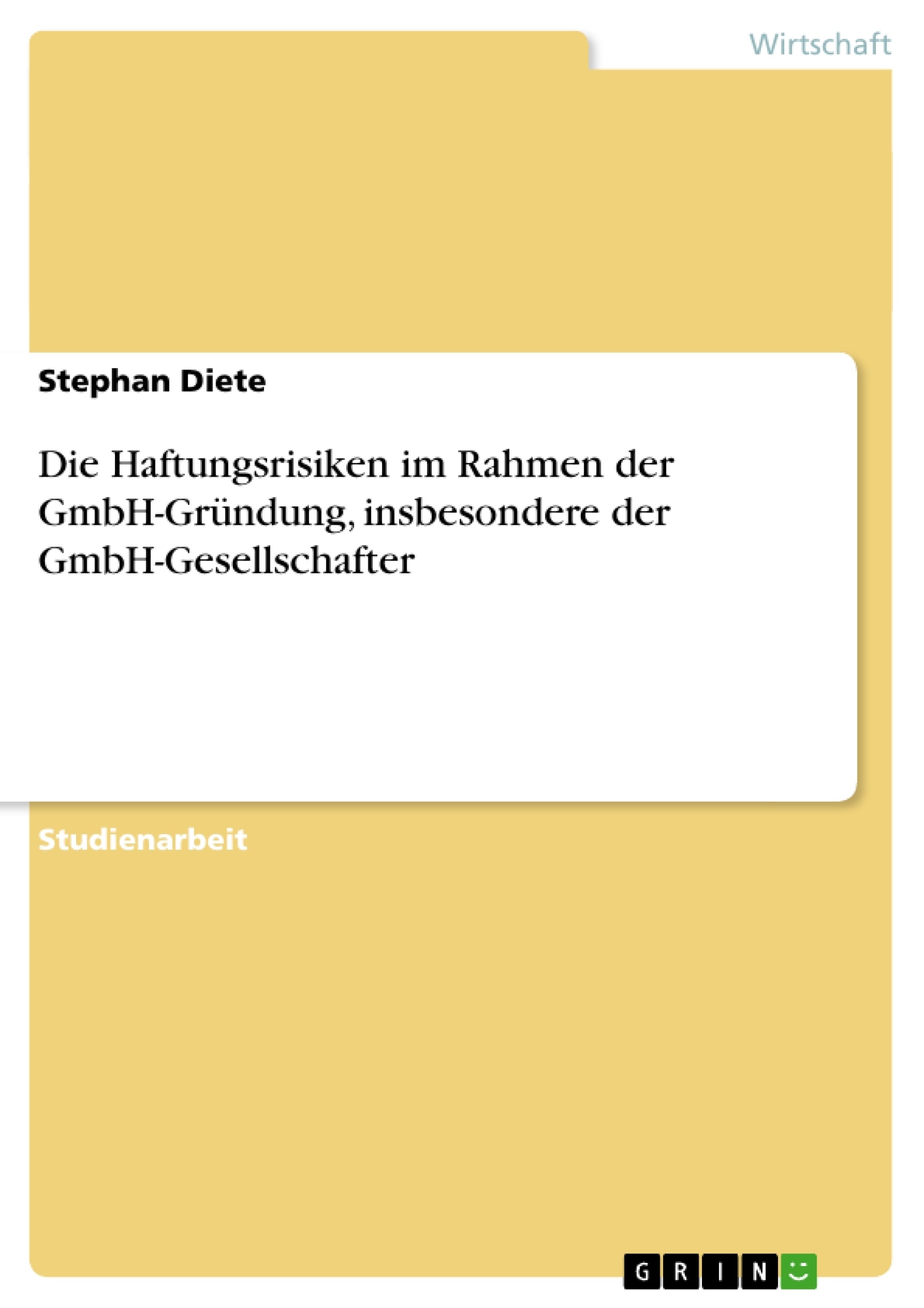Damit ein Zusammenschluss mehrerer Personen unternehmerisch tätig werden kann, benötigt er zwingend eine geeignete Rechtsform. Neben der Behandlung der einzelnen Rechtsformen im Steuerrecht und der damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen auf die Gesellschafter dieser Unternehmen, sowie Finanzierungsfragen was Grund- und Stammkapital angeht, Flexibilität und Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften und sonstiger Kriterien, hat die grundlegende Rechtsgestaltung der Gesellschaft, welche das Verhältnis zwischen den Gesellschaftern und dem Unternehmen einerseits sowie dem Unternehmen und Dritten andererseits bei der Wahl der Rechtsform immer wieder die zentrale Bedeutung1. Deshalb hat die Beschränkung der Haftung bei den Gründern der meisten mittelständischen Unternehmen aufgrund des unternehmerischen Risikos meist Vorrang vor anderen Kriterien hinsichtlich der Rechtsformwahl2. Das mag auch der Grund dafür sein, dass die GmbH die umsatzstärkste Rechtsformgruppe mit einem Anteil von rund einem Drittel am Gesamtumsatz aller in Deutschland tätigen Unternehmen bildet. Sie ist die gebräuchlichste rechtliche Organisationsform für mittelständige Unternehmen, weshalb der Rechtsform GmbH eine hohe praktische Relevanz zukommt.
Bei der Gründung der GmbH kommt es allerdings nicht selten vor, dass mit der Geschäftstätigkeit bereits nach Abschluss des Notarvertrags – aber noch vor dem Handelsregistereintrag – begonnen wird. In diesem Zeitraum, die sogenannte Phase der VorG3, werden bereits allerlei Verträge, so z.B. Mietverträge, Kaufverträge (Büroeinrichtung, EDV etc), Arbeitsverträge und dergleichen, für die entstehende Gesellschaft abgeschlossen. Hierin liegen dann auch die großen Risiken, denn die GmbH entsteht in rechtlicher Hinsicht erst mit dem Eintrag in das Handelsregister, bis dahin besteht sie „als solche nicht“ (§ 11 (1) GmbHG). Dies kann zu erheblichen Haftungsproblemen für die handelnden Personen führen, insbesondere für die Gesellschafter und Geschäftsführer. Hinzu kommt, dass sich Gesetzgebung und kritische Meinungen im dazu veröffentlichten Schrifttum bezüglich der Rechtsverhältnisse der genannten VorG, explizit betreffend die nach dem Urteil des BGH im Jahr 19974 unbeschränkte Haftung der Gesellschafter, auch nach langen Auseinandersetzungen nach wie vor uneins sind, und künftige Entscheidungen daher abzuwarten sind um eine Lösung für immer noch ungeklärte Strukturmerkmale der VorG zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Entstehungsprozess der GmbH als juristische Person im Überblick
- 3. Die Handelndenhaftung
- 4. Die Haftung der Gründer
- 4.1. Die Verlustdeckungshaftung
- 4.2. Das Dogma des Vorbelastungsverbotes
- 4.3. Die Vorbelastungshaftung
- 4.3.1. Die Differenzhaftung
- 4.3.2. Die Unterbilanzhaftung
- 4.3.3. Die Haftung der Gründer im Überblick
- 5. Gesellschafter-Fremdfinanzierung
- 6. Die Gründerhaftung wegen mangelnder Kapitalaufbringung
- 7. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Haftungsrisiken im Rahmen der GmbH-Gründung, insbesondere für die GmbH-Gesellschafter. Ziel ist eine komprimierte Darstellung des Gesamtbildes, die sowohl die Erfüllung der Gläubigersicherheiten vor Eintragung als auch das Verhältnis der Gesellschaft zur "fertigen" GmbH beleuchtet. Das Haftungskonzept wird auf seine Geschlossenheit geprüft.
- Entstehungsprozess der GmbH
- Handelnde Haftung vor Eintragung ins Handelsregister
- Haftung der Gründer (Verlustdeckung, Vorbelastungsverbot, Vorbelastungshaftung)
- Gesellschafter-Fremdfinanzierung
- Haftung wegen mangelnder Kapitalaufbringung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Haftungsrisiken bei der GmbH-Gründung ein. Sie betont die Bedeutung der Rechtsformwahl für mittelständische Unternehmen aufgrund des unternehmerischen Risikos und die hohe praktische Relevanz der GmbH. Besonderes Augenmerk liegt auf der Phase vor der Eintragung ins Handelsregister (VorG), in der bereits Geschäftstätigkeit aufgenommen wird und erhebliche Haftungsrisiken für die handelnden Personen entstehen können. Die Uneinigkeit in Gesetzgebung und Literatur bezüglich der Rechtsverhältnisse der VorG und der unbeschränkten Haftung der Gesellschafter wird hervorgehoben. Die Arbeit soll das Haftungskonzept für Gesellschafter einer GmbH in Gründung darlegen und die Erfüllung von Gläubigersicherheiten vor Eintragung sowie das Verhältnis zur "fertigen" GmbH untersuchen.
2. Der Entstehungsprozess der GmbH als juristische Person im Überblick: Dieses Kapitel skizziert den Gründungsprozess einer GmbH. Es betont, dass die GmbH nicht plötzlich entsteht, sondern einem gesetzlich kontrollierten Prozess unterliegt, der mit der Eintragung ins Handelsregister abschließt. Der Prozess wird kurz beschrieben, um ein besseres Verständnis für die Einordnung der Haftungsproblematik zu schaffen. Die Notwendigkeit der gesetzlichen Kontrolle durch das Registergericht wird hervorgehoben, um unberechtigtes Auftreten von juristischen Personen zu verhindern und den Geschäftsverkehr zu sichern.
3. Die Handelndenhaftung: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss anhand des vollständigen Textes erstellt werden.)
4. Die Haftung der Gründer: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Aspekte der Haftung der Gründer. Es differenziert zwischen Verlustdeckungshaftung, dem Dogma des Vorbelastungsverbotes und der Vorbelastungshaftung (inklusive Differenzhaftung und Unterbilanzhaftung). Der Überblick über die Haftung der Gründer fasst die verschiedenen Haftungsformen zusammen und verdeutlicht ihre Komplexität im Kontext der GmbH-Gründung. (Detaillierte Ausführungen zu den Unterkapiteln 4.1-4.3.3 fehlen im Ausgangstext und müssen anhand des vollständigen Textes erstellt werden.)
5. Gesellschafter-Fremdfinanzierung: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss anhand des vollständigen Textes erstellt werden.)
6. Die Gründerhaftung wegen mangelnder Kapitalaufbringung: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss anhand des vollständigen Textes erstellt werden.)
Schlüsselwörter
GmbH-Gründung, Haftungsrisiken, Gesellschafterhaftung, Vorgesellschaft (VorG), Handelsregistereintrag, Verlustdeckungshaftung, Vorbelastungshaftung, Differenzhaftung, Unterbilanzhaftung, Kapitalaufbringung, Gläubigersicherheiten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur GmbH-Gründungshaftung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Haftungsrisiken bei der Gründung einer GmbH, insbesondere für die Gesellschafter. Sie beleuchtet die Phase vor der Eintragung ins Handelsregister (VorG) und untersucht das Haftungskonzept hinsichtlich seiner Geschlossenheit. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erfüllung von Gläubigersicherheiten vor Eintragung und dem Verhältnis zur "fertigen" GmbH.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Entstehungsprozess der GmbH, die handelnde Haftung vor Eintragung, die Haftung der Gründer (inkl. Verlustdeckungshaftung, Vorbelastungsverbot und Vorbelastungshaftung mit Differenz- und Unterbilanzhaftung), Gesellschafter-Fremdfinanzierung und die Haftung wegen mangelnder Kapitalaufbringung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Entstehungsprozess der GmbH, Handelnde Haftung, Haftung der Gründer, Gesellschafter-Fremdfinanzierung, Gründerhaftung wegen mangelnder Kapitalaufbringung und Schlusswort. Die Kapitel 3, 5 und 6 enthalten im vorliegenden Auszug keine detaillierten Zusammenfassungen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel ist eine komprimierte Darstellung der Haftungsrisiken bei der GmbH-Gründung, die sowohl die Phase vor der Eintragung als auch das Verhältnis zur eingetragenen GmbH beleuchtet. Das Haftungskonzept wird auf seine Geschlossenheit geprüft.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: GmbH-Gründung, Haftungsrisiken, Gesellschafterhaftung, Vorgesellschaft (VorG), Handelsregistereintrag, Verlustdeckungshaftung, Vorbelastungshaftung, Differenzhaftung, Unterbilanzhaftung, Kapitalaufbringung und Gläubigersicherheiten.
Welche Haftungsformen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Haftungsformen für die Gründer: Verlustdeckungshaftung, Haftung aufgrund des Verstoßes gegen das Vorbelastungsverbot und Vorbelastungshaftung (mit Differenz- und Unterbilanzhaftung).
Was ist die Bedeutung der Phase vor der Eintragung ins Handelsregister (VorG)?
Die Phase vor der Eintragung ins Handelsregister ist von besonderer Bedeutung, da in dieser Zeit bereits Geschäftstätigkeit aufgenommen werden kann und erhebliche Haftungsrisiken für die handelnden Personen entstehen können. Die Rechtslage in dieser Phase ist in Gesetzgebung und Literatur umstritten.
Welche Aspekte der Gesellschafter-Fremdfinanzierung werden betrachtet?
Die Zusammenfassung zum Kapitel Gesellschafter-Fremdfinanzierung fehlt im vorliegenden Auszug. Details hierzu müssen dem vollständigen Text entnommen werden.
Wie wird die Haftung wegen mangelnder Kapitalaufbringung behandelt?
Die Zusammenfassung zum Kapitel Haftung wegen mangelnder Kapitalaufbringung fehlt im vorliegenden Auszug. Details hierzu müssen dem vollständigen Text entnommen werden.
Wie ist die Handelnde Haftung vor der Eintragung definiert?
Die Zusammenfassung zum Kapitel Handelnde Haftung fehlt im vorliegenden Auszug. Details hierzu müssen dem vollständigen Text entnommen werden.
- Quote paper
- Stephan Diete (Author), 2004, Die Haftungsrisiken im Rahmen der GmbH-Gründung, insbesondere der GmbH-Gesellschafter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37623