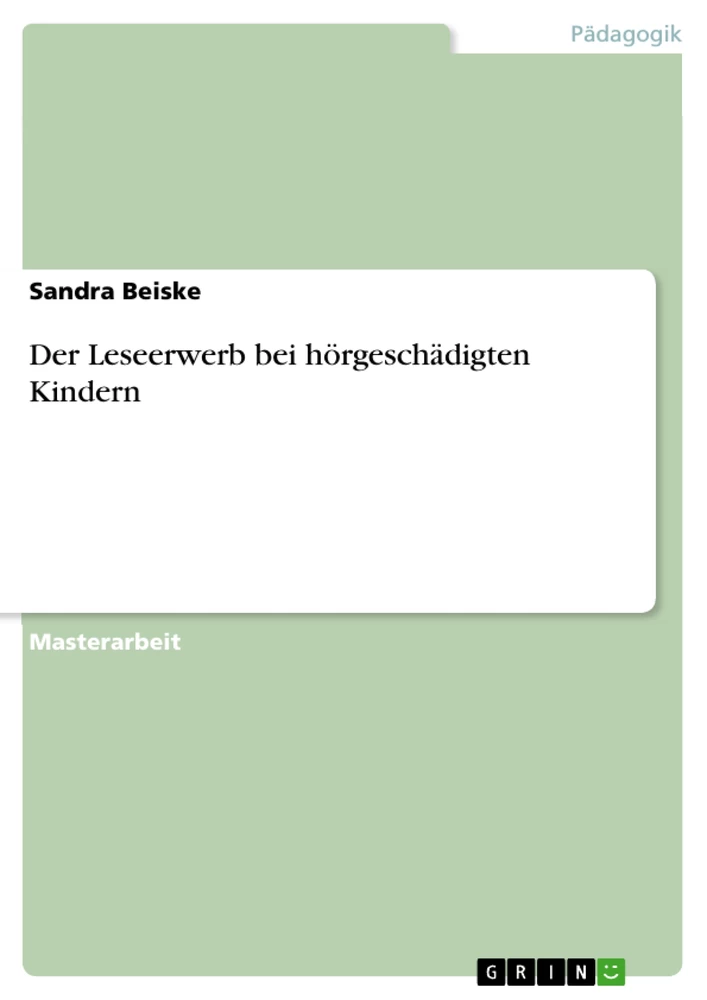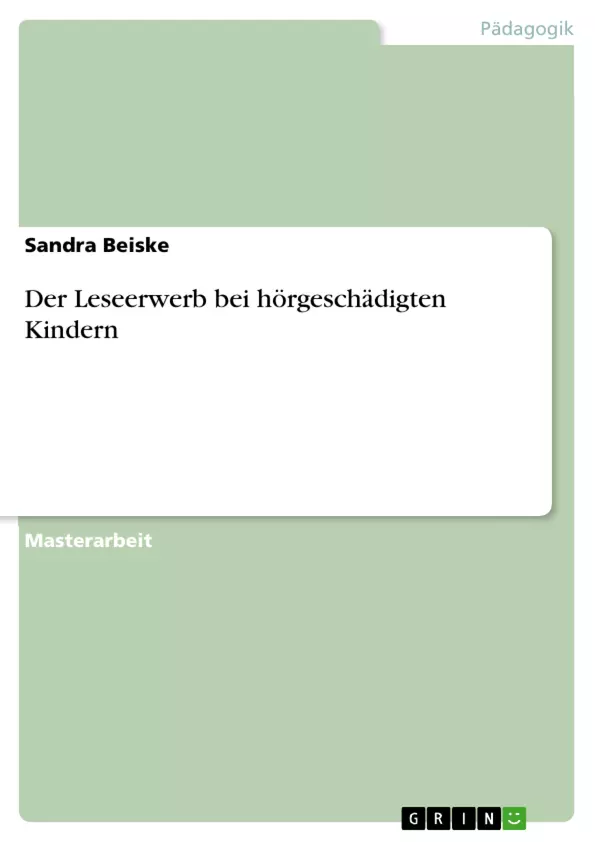Die vorliegende Ausarbeitung bietet dem Leser einen Überblick des nahezu unerforschten Themengebietes des Leseerwerbs bei hörgeschädigten Kindern. Die Relevanz scheint angesichts der bildungspolitischen Reformen von Inklusion und Abschaffung/Umwandlung der Förderschulen von aktueller Brisanz. Die Statistiken der Förderschulen in Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Schülerverteilung als auch Aufteilung der einzelnen Förderbereiche weist auf einen Bezug für andere Schulformen hin. Neben der Erläuterung didaktischer und theoretischer Konzepte zur Anbahnung einer Leseentwicklung, erfolgt auch eine eigene Darstellung einer möglichen Realisierung des Leseerwerbs unter den geschilderten Rahmenbedingungen.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Situation von hörgeschädigten Kindern bei der Entwicklung des Leseerwerbs
- Zentrale Begriffe im Themenkontext
- Die Komponenten des Schriftspracherwerbs
- Das Spektrum von Hörbeeinträchtigung und Hörbehinderung
- Bedeutung des Lesens für Menschen mit einer Hörschädigung
- Grenzen und Möglichkeiten für die Anbahnung einer Leseentwicklung bei hörbeeinträchtigten Lernenden
- Zusammenhang zwischen Gebärdensprache, geschriebener und gesprochener Sprache im Rahmen des Themenkontextes
- Relevanz der Thematik „Leseerwerb bei Hörschädigung“ am Förderschwerpunkt „Lernen“
- Feststellung einer Hörschädigung
- Existenz weiterer sonderpädagogisch festgestellter und förderungsbedürftiger Beeinträchtigungen
- Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“
- Bestandsaufnahme der Förderschullandschaft mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“
- Verteilung von hörgeschädigten Schülern im Schulsystem
- Plausibilität der Zuordnung zum Förderschwerpunkt „Lernen“
- Praktische Gestaltungsmöglichkeiten eines Leseentwicklungsprozesses
- Leseentwicklung mithilfe von Methoden mit Fokussierung auf die „Laut-Buchstaben-Relation“
- Erläuterung zur Methode der Anlauttabelle
- Einbindungsmöglichkeiten in eine Lesedidaktik für hörgeschädigte Kinder
- Gebärdensprachliche Konzeptionen zur Anbahnung einer Leseentwicklung
- Bilingualer Leseerwerbsansatz
- Lesen lernen mithilfe der LRS-Methode
- Modelle des Leseerwerbs im Vergleich
- Leseentwicklung bei hörenden Kindern
- Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien nach Günther
- Modell der Leseentwicklung nach Brüggelmann und Brinkmann
- Vergleich der Modelle von Günther und Brüggelmann / Brinkmann
- Leseentwicklung bei hörgeschädigten Kindern
- Umsetzbarkeit der Modelle nach Günther und Brüggelmann/ Brinkmann für hörgeschädigte Kinder
- Modell der Schriftsprachentwicklung für gehörlose Kinder nach Günther
- Vergleich der Erwerbsmodelle für Hörende mit dem Schriftmodell für Gehörlose nach Günter
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Leseerwerb bei hörgeschädigten Kindern und bietet einen Überblick über dieses weitgehend unerforschte Gebiet. Die Relevanz des Themas ist im Kontext der bildungspolitischen Reformen von Inklusion und der Umwandlung von Förderschulen von hoher Aktualität. Die Statistik der Förderschulen in Rheinland-Pfalz in Bezug auf die Schülerverteilung und die Aufteilung der einzelnen Förderbereiche zeigt einen Bezug zu anderen Schulformen.
- Entwicklung des Leseerwerbs bei hörgeschädigten Kindern
- Didaktische und theoretische Konzepte zur Anbahnung einer Leseentwicklung
- Realisierung des Leseerwerbs unter den besonderen Rahmenbedingungen von Hörgeschädigten
- Bedeutung von Gebärdensprache für den Leseerwerb
- Relevanz des Themas im Kontext der Inklusion und der Umwandlung von Förderschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik des Leseerwerbs bei hörgeschädigten Kindern und beleuchtet die zentrale Bedeutung dieses Themas im Kontext der Inklusion und der aktuellen Reformen im Bildungssystem. Das zweite Kapitel widmet sich den zentralen Begriffen und Komponenten des Schriftspracherwerbs, beschreibt das Spektrum von Hörbeeinträchtigung und Hörbehinderung und beleuchtet die Bedeutung des Lesens für Menschen mit einer Hörschädigung. Des Weiteren werden die Grenzen und Möglichkeiten für die Anbahnung einer Leseentwicklung bei hörbeeinträchtigten Lernenden sowie der Zusammenhang zwischen Gebärdensprache, geschriebener und gesprochener Sprache im Kontext des Themas beleuchtet. Das dritte Kapitel betrachtet die Relevanz des Themas „Leseerwerb bei Hörschädigung“ am Förderschwerpunkt „Lernen“. Hier werden Aspekte wie die Feststellung einer Hörschädigung, die Existenz weiterer sonderpädagogisch festgestellter und förderungsbedürftiger Beeinträchtigungen sowie die Förderschullandschaft mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“ behandelt. Das vierte Kapitel widmet sich der praktischen Gestaltung von Leseentwicklungsprozessen und stellt verschiedene Methoden zur Anbahnung einer Leseentwicklung vor, darunter Ansätze mit Fokussierung auf die „Laut-Buchstaben-Relation“ und gebärdensprachliche Konzeptionen wie der bilinguale Leseerwerbsansatz.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Hörschädigung, Leseerwerb, Gebärdenkonzipierte Didaktik, Leseentwicklungsprozess und Gehörlosendidaktik. Sie analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten des Leseerwerbs bei hörgeschädigten Kindern und erforscht die Rolle von Gebärdensprache und anderen didaktischen Ansätzen in diesem Prozess. Die Arbeit betrachtet die Relevanz des Themas im Kontext der Inklusion und der aktuellen Entwicklungen im Bildungssystem. Sie bietet einen Einblick in die besondere Situation von hörgeschädigten Kindern im Bildungssystem und beleuchtet die Notwendigkeit, ihre individuellen Bedürfnisse beim Leseerwerb zu berücksichtigen.
- Arbeit zitieren
- Sandra Beiske (Autor:in), 2017, Der Leseerwerb bei hörgeschädigten Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376238