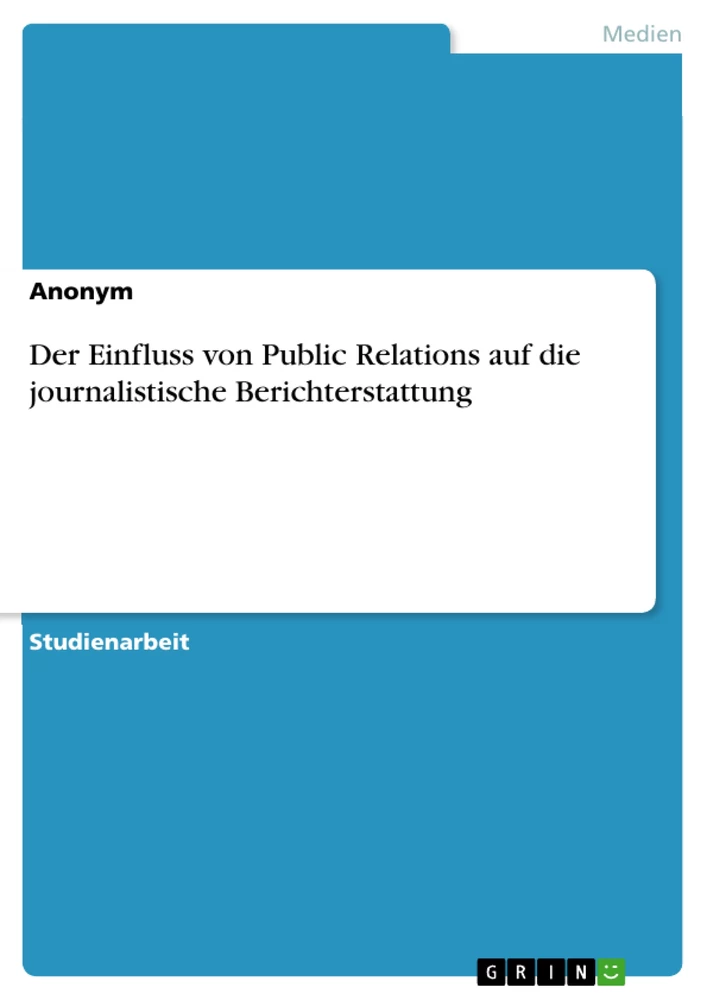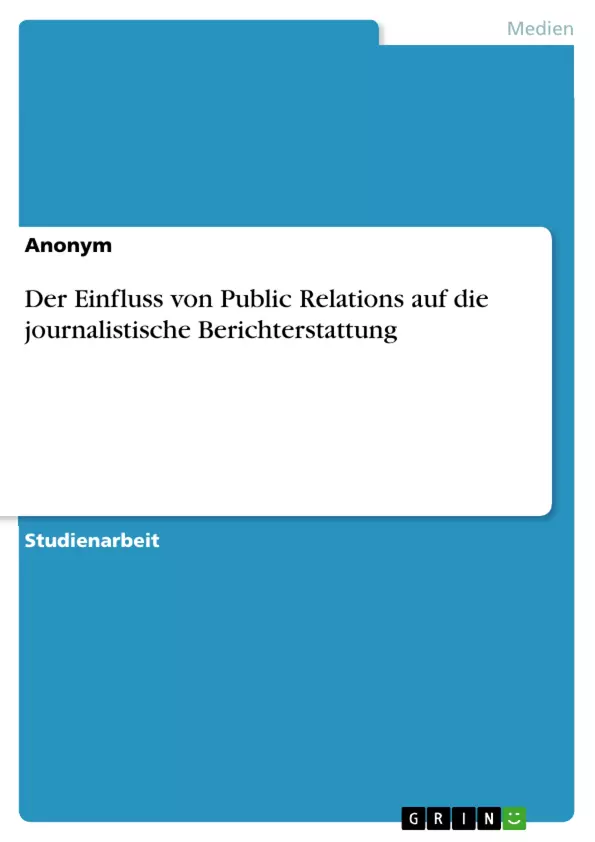Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Journalismus und PR mit Bezug auf die gängige Forschung sowie dem Einfluss der PR auf die journalistische Berichterstattung. Dargestellt werden hierfür die wichtigsten Ansätze und theoretischen Studien auf diesem Gebiet.
Der Widerspruch zwischen der Forderung nach einem unabhängigen Journalismus und dem dennoch engen Verhältnis von Journalismus zu Public Relations bedingt die Frage nach der journalistischen Arbeitsweise und der damit verbundenen Qualität. Kann so der Beitrag zur Meinungsbildung der Leser und Leserinnen als Ziel der journalistischen Arbeit gewährleistet werden? Leidet die Glaubwürdigkeit des Journalismus womöglich unter dieser Beziehung? Führt die Zusammenarbeit von Journalismus und Public Relations zu einer Nichteinhaltung des normativen Anspruchs an den Journalismus?
In der internationalen Forschung untersuchte man das Verhältnis zwischen Public Relations und den Medien zunächst empirisch, im deutschsprachigen Raum setzte man sich hauptsächlich mit den Theorien auseinander. Die bekannteste Untersuchung führte die Kommunikationswissenschaftlerin Barbara Baerns erstmals 1979 durch und kam zu dem Ergebnis, dass die Public Relations die Themen und das Timing der journalistischen Berichterstattung unter Kontrolle haben („Determinationsthese“). Journalisten werden zu Gehilfen der Public Relations, die Publizität gegen Information tauschen.
Die Determinationsthese rief eine Reihe von kritischen Auseinandersetzungen hervor, die sich im methodischen Ansatz unterschieden und weitere Einflussfaktoren berücksichtigten. Eine Weiterentwicklung der Determinationsthese stellt der Intereffikationsansatz dar, der von Einflüssen und Abhängigkeiten in beide Richtungen ausgeht. Neben den beschriebenen Ansätzen gibt es weitere systemtheoretische Untersuchungen. Und auch die Medialisierungsforschung beschäftigt sich mit der Bedeutung der Medien für Unternehmen, die wiederum das Verhältnis von Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet. Diese vier Ansätze bilden die wichtigsten Theorien zu der Beziehung zwischen PR und Journalismus und bestätigen den Verdacht eines Verhältnisses der gegenseitigen Anpassung, Orientierung und Beeinflussung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Public Relations
- Gegenstandsbeschreibung
- Aufgaben und Ziele
- Journalismus
- Gegenstandsbeschreibung
- Aufgaben und Ziele
- Informationsselektion im Journalismus
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede PR - Journalismus
- Theorien zum Verhältnis von Journalismus und PR
- Die Determinationsthese
- Kritik an der Determinationsthese
- Das Intereffikationsmodell
- Kritik am Intereffikationsmodell
- Die Determinationsthese
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Journalismus und Public Relations und analysiert den Einfluss der Public Relations auf die journalistische Berichterstattung. Sie betrachtet die wichtigsten Theorien und Studien auf diesem Gebiet und beleuchtet dabei den Wandel der Beziehung zwischen den beiden Disziplinen.
- Die Definition und Aufgaben von Public Relations und Journalismus
- Die Herausforderungen der Informationsselektion im Journalismus
- Theorien zum Verhältnis von Journalismus und PR, insbesondere die Determinationsthese und das Intereffikationsmodell
- Der Einfluss der Public Relations auf die journalistische Berichterstattung
- Die Bedeutung der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit des Journalismus im Kontext der PR-Einflüsse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und führt in das Spannungsfeld von Journalismus und Public Relations ein. Sie zeigt anhand eines Beispiels den allgegenwärtigen Einfluss von PR-Strategien auf die Medienlandschaft und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen für die journalistische Arbeitsweise.
Das Kapitel „Public Relations“ befasst sich mit der Definition und den Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit. Es werden verschiedene Perspektiven auf PR beleuchtet und die Schwierigkeiten bei der klaren Abgrenzung des Begriffs aufgezeigt.
Das Kapitel „Journalismus“ widmet sich der Definition und den Aufgaben des Journalismus. Es wird der Fokus auf die Informationsselektion im Journalismus gelegt und die Bedeutung der Unabhängigkeit und Objektivität für die journalistische Arbeit hervorgehoben.
Das Kapitel „Gemeinsamkeiten und Unterschiede PR - Journalismus“ analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Disziplinen und stellt die unterschiedlichen Zielsetzungen und Arbeitsweisen heraus.
Das Kapitel „Theorien zum Verhältnis von Journalismus und PR“ untersucht die wichtigsten Theorien zum Verhältnis von Journalismus und PR. Es werden die Determinationsthese und das Intereffikationsmodell sowie deren Kritikpunkte vorgestellt. Das Kapitel „Fazit und Ausblick“ befasst sich mit den Ergebnissen der Untersuchung und zieht Schlussfolgerungen für die zukünftige Beziehung zwischen Journalismus und Public Relations.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Journalismus, Public Relations, Medien, Informationsselektion, Unabhängigkeit, Objektivität, Glaubwürdigkeit, Determinationsthese, Intereffikationsmodell, Einfluss, Beziehung, Medienlandschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die „Determinationsthese“ von Barbara Baerns?
Die These besagt, dass Public Relations die Themen und das Timing der journalistischen Berichterstattung weitgehend kontrollieren und Journalisten zu Gehilfen der PR werden.
Was ist das „Intereffikationsmodell“?
Dieses Modell geht von einem Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit und Beeinflussung zwischen Journalismus und PR aus, anstatt einer einseitigen Steuerung.
Leidet die Glaubwürdigkeit des Journalismus unter dem Einfluss der PR?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die enge Zusammenarbeit dazu führt, dass der normative Anspruch an einen unabhängigen Journalismus und die Objektivität gefährdet werden.
Wie unterscheiden sich die Aufgaben von PR und Journalismus?
PR dient den Partikularinteressen von Organisationen (Imagepflege), während Journalismus dem Gemeinwohl und der objektiven Information der Öffentlichkeit verpflichtet ist.
Was bedeutet „Informationsselektion“ im Journalismus?
Es ist der Prozess, bei dem Journalisten aus der Flut an Informationen (einschließlich PR-Material) entscheiden, was für die Leser relevant und nachrichtengleich ist.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2014, Der Einfluss von Public Relations auf die journalistische Berichterstattung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376290