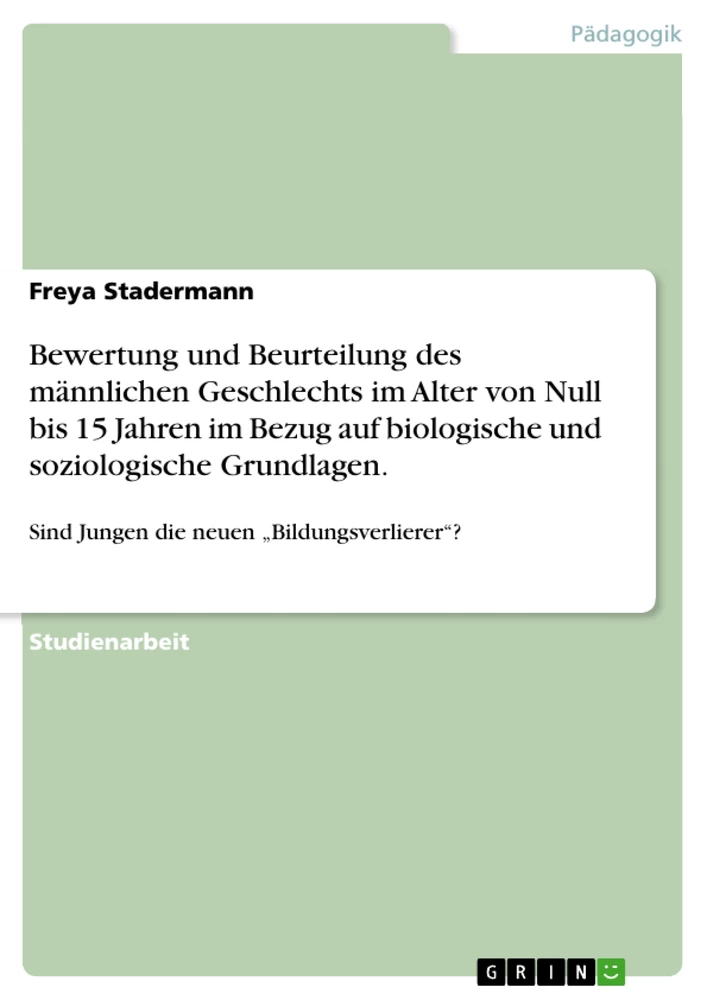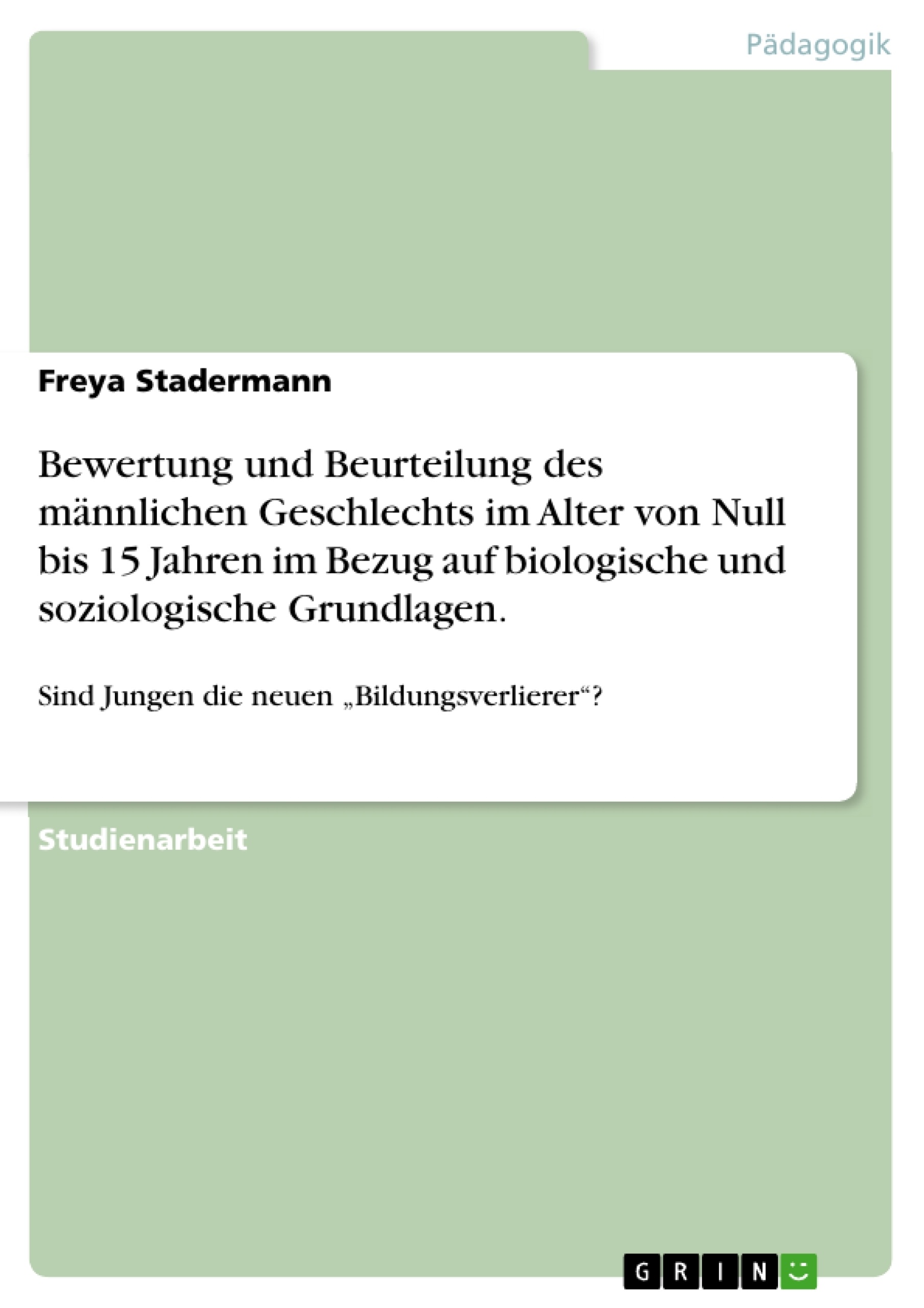In dem aktuell präsenten Thema in der Geschlechterdebatte stellt sich die Frage, inwieweit Jungen als „Bildungsverlierer“ gesehen werden können und dies in der Realität zutrifft. Besonders durch die Medien wird das Thema „Jungen“ inzwischen dramatisch inszeniert, sodass ein großer Informationsbedarf sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Pädagogik besteht. Um einen besseren Einblick in die Geschlechterfrage zu bekommen, werden zunächst biologische als auch soziologische Grundlagen des männlichen Geschlechts erarbeitet. Die Rolle der Erziehung spielt hierbei eine wichtige Rolle, da sie in jeglichem Umfeld der Jungen stattfindet. Sowohl innerhalb der Familie als auch in pädagogischen Einrichtungen beeinflusst sie den Werdegang und das Heranwachsen des Kindes. Inwiefern die Erziehung sich in pädagogischen Institutionen auf das Geschlechterfrage bezieht; wird im darauffolgenden Kapitel deutlich. Anschießend werden mögliche Indikatoren für das schlechtere Abschneiden von Jungen benannt und hinterfragt. Es muss jedoch beachtet werden, dass lediglich die Situation einer Minderheit beschrieben wird. Nicht alle Jungen sind hiervon betroffen. Allerdings steigt die Zahl der Jungen, auf die sich die folgende Arbeit bezieht, stetig, sodass die Thematik umso relevanter ist.
In den letzten Jahren hat sich das Bild der Jungen in der Geschlechterdebatte deutlich verändert. Sowohl in erziehungswissenschaftlicher Fachdiskussion als auch in den Medien rücken die Jungen verstärkt in den Vordergrund und nehmen das Prädikat „benachteiligt“ an, welches bis in die 1990er Jahre noch den Mädchen nachgesprochen wurde. Angesichts der verbesserten Schulleistungen und des Aufholens der Mädchen entwickelt sich das weibliche Geschlecht zunehmend positiv, obwohl es noch vor einigen Jahrzehnten als „das schwache Geschlecht“ eingestuft worden ist. Im Gegensatz dazu wird den Jungen heutzutage nachgesagt, sie würden ein oft auffälliges und sogar riskantes Verhalten aufzeigen. Die letzten PISA-Studien zeigen, dass auch die Schulleistungen davon beeinflusst sind und Jungen dabei deutlich ins Hintertreffen geraten sind. Entscheidend dabei ist unter anderem die „systematische Benachteiligung“ der Jungen in pädagogischen Instituten. „Die Schule hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Institution mit einer ‚mütterlichen Hegemonialkultur‘ entwickelt“, die besonders durch die intensive Mädchenförderung als auch durch Unterdrückung des jungentypischen Verhaltens zustande gekommen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition Jungenpädagogik
- Grundlagen der Jungenpädagogik
- Evolutionstheoretische Perspektive
- Der Anlagenfaktor in den ersten Lebensjahren
- Das männliche Rivalisieren
- Hormonelle Einflüsse
- Männliche Sozialisation bzw. sozialwissenschaftlicher Aspekt
- Die Rolle der Erziehung im Heranwachsen des männlichen Geschlechts
- Das Heranwachsen als Herausforderung für den Jungen
- Die Nutzung der Medien im Bezug auf das Geschlecht
- Evolutionstheoretische Perspektive
- Jungen in pädagogischen Institutionen
- Jungen im Kindergarten
- Die Bedeutung des Erziehers im Kindergarten
- Jungen in der Grundschule
- Ergebnisse der PISA-Studie im Geschlechtervergleich
- Jungen im Kindergarten
- Jungen als benachteiligtes Geschlecht?
- Schule als weibliches Biotop
- Unterdrückung jungentypischer Verhaltensweisen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Situation von Jungen in der heutigen Gesellschaft und analysiert, inwieweit sie als „Bildungsverlierer“ betrachtet werden können. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und den Besonderheiten der Jungenpädagogik, wobei sowohl biologische als auch soziologische Aspekte beleuchtet werden. Ziel ist es, einen umfassenden Einblick in die Geschlechterfrage zu gewinnen und die Rolle der Erziehung im Kontext des männlichen Heranwachsens zu untersuchen.
- Die Entwicklung der Jungenpädagogik als Reaktion auf die veränderte Geschlechterdebatte
- Biologische und soziologische Grundlagen des männlichen Geschlechts
- Die Bedeutung der Erziehung in unterschiedlichen Lebensbereichen für Jungen
- Mögliche Ursachen für die vermeintliche Benachteiligung von Jungen im Bildungssystem
- Die Relevanz der Geschlechterfrage im Kontext pädagogischer Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die aktuelle Debatte um die Situation von Jungen in der Geschlechterdebatte dar und beleuchtet die These, dass Jungen zunehmend als „benachteiligt“ betrachtet werden. Die Arbeit greift die Veränderung in der Geschlechterrolle auf und stellt die Relevanz der Jungenpädagogik in den Vordergrund.
- Definition Jungenpädagogik: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Jungenpädagogik“ und erläutert, wie sich diese Form der Pädagogik von anderen Ansätzen unterscheidet. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, die spezifischen Bedürfnisse von Jungen zu berücksichtigen und eine darauf zugeschnittene Pädagogik zu entwickeln.
- Grundlagen der Jungenpädagogik: Dieser Abschnitt befasst sich mit den biologischen und soziologischen Grundlagen der Jungenpädagogik. Es werden evolutionstheoretische Perspektiven und die Rolle der Sozialisation im Hinblick auf das männliche Geschlecht diskutiert.
- Jungen in pädagogischen Institutionen: Dieses Kapitel untersucht die Situation von Jungen in unterschiedlichen pädagogischen Institutionen, wie Kindergärten und Grundschulen. Es werden die Herausforderungen und Möglichkeiten im Kontext der Jungenpädagogik in diesen Einrichtungen beleuchtet.
- Jungen als benachteiligtes Geschlecht?: Der Abschnitt befasst sich mit der These, dass Jungen in der Schule benachteiligt werden könnten. Die Arbeit analysiert die Rolle der Schule als „weibliches Biotop“ und diskutiert, inwieweit die Unterdrückung jungentypischer Verhaltensweisen die Bildungschancen von Jungen beeinflussen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf zentrale Begriffe wie Jungenpädagogik, Geschlechterdebatte, biologische und soziologische Grundlagen, Erziehung, Sozialisation, pädagogische Institutionen, Benachteiligung, Bildung, Schulleistung, und jungentypische Verhaltensweisen. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich aus der veränderten Geschlechterrolle für die Pädagogik ergeben, und beleuchtet die Relevanz der Jungenpädagogik im Kontext der heutigen Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Sind Jungen heutzutage „Bildungsverlierer“?
Statistiken und PISA-Studien zeigen, dass Jungen im Vergleich zu Mädchen oft schlechtere Schulleistungen erbringen und häufiger Verhaltensauffälligkeiten zeigen.
Was ist das Ziel der Jungenpädagogik?
Sie möchte auf die spezifischen biologischen und soziologischen Bedürfnisse von Jungen eingehen, die in herkömmlichen Bildungseinrichtungen oft zu kurz kommen.
Warum wird die Schule oft als „weibliches Biotop“ bezeichnet?
Kritiker argumentieren, dass pädagogische Institutionen durch eine „mütterliche Hegemonialkultur“ und die Unterdrückung jungentypischer Verhaltensweisen geprägt sind.
Welchen Einfluss haben Hormone auf das Verhalten von Jungen?
Hormonelle Einflüsse (wie Testosteron) können Rivalisieren und einen höheren Bewegungsdrang fördern, was im Schulalltag oft als störend empfunden wird.
Wie wichtig sind männliche Erzieher im Kindergarten?
Männliche Bezugspersonen sind essenziell als Rollenvorbilder, um Jungen eine Identifikation jenseits rein weiblicher Erziehungsmuster zu ermöglichen.
- Citation du texte
- Freya Stadermann (Auteur), 2014, Bewertung und Beurteilung des männlichen Geschlechts im Alter von Null bis 15 Jahren im Bezug auf biologische und soziologische Grundlagen., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376360