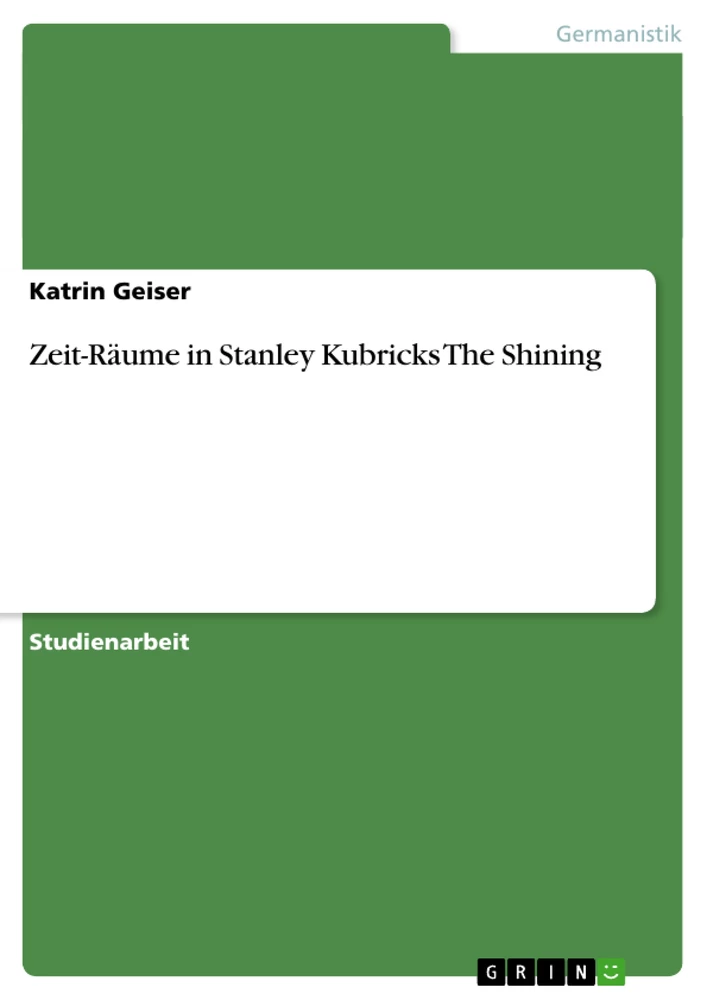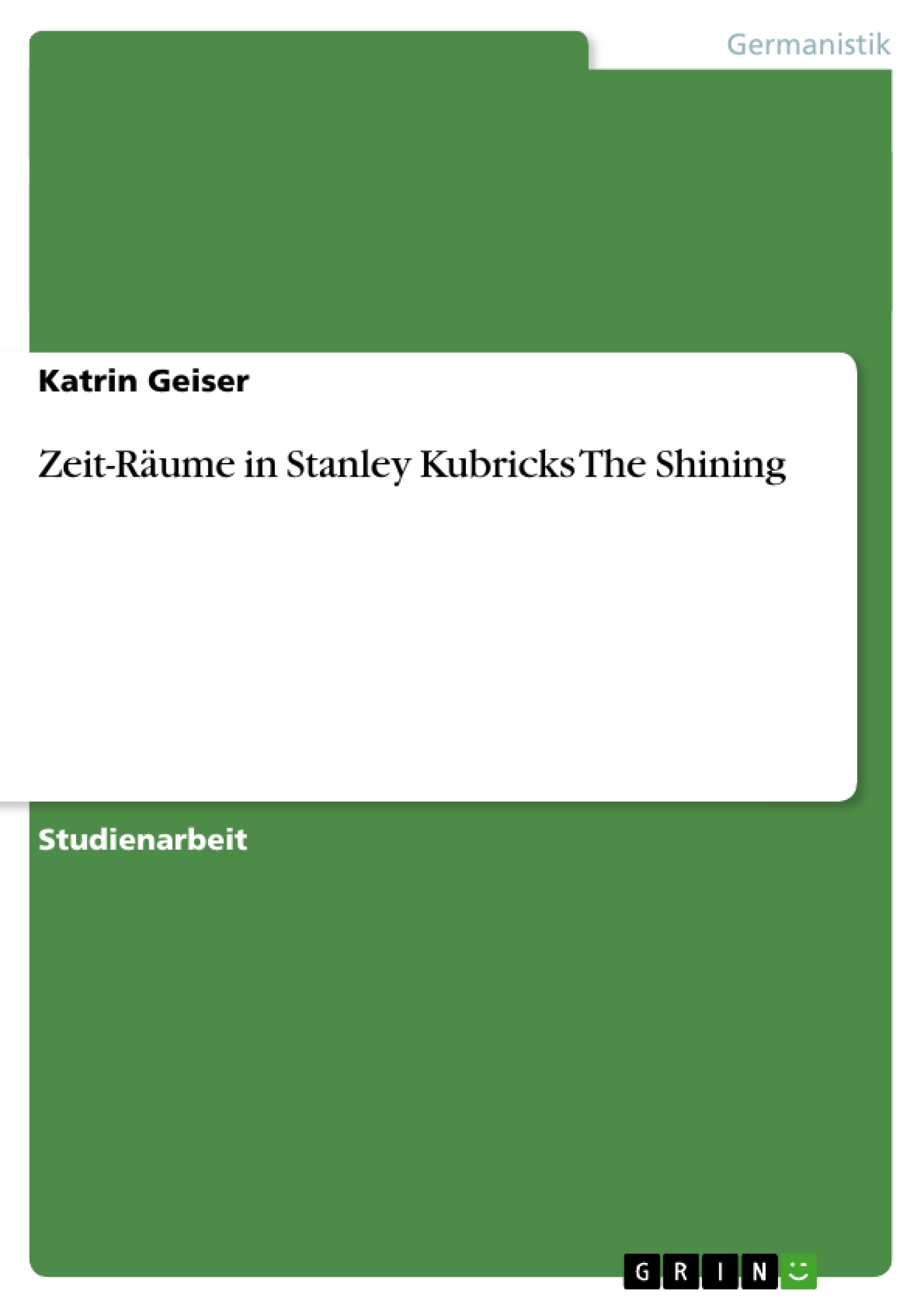In der Geschichte der Filmtheorie galt lange Zeit die Vorstellung, die filmtechnischen Mittel Montage und Mise en Scène seien getrennt voneinander zu betrachten, da sie auf verschiedene Ziele der filmische Arbeit verweisen. In dieser Arbeit soll es nun darum gehen, Jean-Luc Godards Auffassung von der Synthese dieser beiden Techniken zu stützen und durch den Nachweis der Austauschbarkeit der jeweiligen Ziele von Montage und Mise en Scène sogar zu verschärfen.Desweiteren werden die noch vor Godard gängigen Vorstellungen von Realitäten, die der Film ermöglicht, verbunden mit den damaligen Auffassungen bezüglich der zwei Filmtechniken, dargestellt und schließlich mit Godards These und der sich ergebenden Konsequenzen modifiziert. Die Grenzen der Wirklichkeit des Films müssen mit Godard neu definiert werden. Zur Untermauerung dieses theoretischen Rahmens folgt im Hauptteil dieser Arbeit eine Filmanalyse zu Stanley Kubricks The Shining (1980). Dieser Filmist aufgrund ungewöhnlicher Raum- und Zeitkonstruktionen und der damit verbundenen Montagetechnik und Mise en Scène hervorragend für dieseZwecke geeignet. Anhand konkreter Sequenzen wird demnach zunächst die Zeitkonstruktion unter Einbezug der Montage und im Anschluss das Raumkonzept unter dem Gesichtspunkt der Mise en Scène betrachtet. Anschließend wird aufgezeigt, inwieweit diese filmtechnischen Mittel untrennbar voneinander zu betrachten sind. Abschließend folgt die Betrachtung der Selbstreferenz des Films, die sich gewissermaßen aus den Konsequenzen der Synthese von Montage und Mise en Scène ergibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Montage und Mise en Scène
- Expressionismus und Realismus
- Filmanalyse The Shining
- Sequenzgrafik
- Die Gestörtheit der Zeit
- Der äußere Zeitrahmen
- Der innere Zeitrahmen
- Die Gestörtheit des Raums
- Das Labyrinth und der hohe Raum
- Der Zeit-Raum
- Die Gestörtheit des Films
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Synthese von Montage und Mise en Scène im Film, basierend auf Jean-Luc Godards Auffassung. Sie hinterfragt traditionelle Vorstellungen von Realismus und Expressionismus im Film und deren Einfluss auf die jeweiligen Techniken. Die Filmanalyse von Stanley Kubricks "The Shining" dient als Fallbeispiel zur Veranschaulichung der These.
- Synthese von Montage und Mise en Scène
- Expressionistische und realistische Filmtheorien
- Raum- und Zeitkonstruktionen im Film
- Wirklichkeitsdarstellung im Film
- Selbstreferenzialität des Films
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor: die Synthese von Montage und Mise en Scène im Film nach Jean-Luc Godard. Sie skizziert die bisherigen gegensätzlichen Auffassungen von Realismus und Expressionismus im Kontext der Filmtechniken und kündigt die Filmanalyse von Stanley Kubricks "The Shining" an, um diese These zu belegen. Der Film wird als besonders geeignetes Beispiel aufgrund seiner ungewöhnlichen Raum- und Zeitkonstruktionen hervorgehoben. Die Einleitung bereitet den Leser auf die folgende detaillierte Untersuchung vor, indem sie die methodische Vorgehensweise andeutet und die Bedeutung der Synthese von Montage und Mise en Scène für das Verständnis filmischer Wirklichkeit betont.
Montage und Mise en Scène: Dieses Kapitel beschreibt die traditionellen Ansichten von Montage und Mise en Scène im Expressionismus und Realismus. Im Expressionismus wird die Montage als Mittel zur psychologischen Führung des Publikums und zur Manipulation der Realität gesehen (Pudovkin), während Eisenstein die Montage als Werkzeug zur Schaffung einer neuen Realität betrachtet. Im Realismus hingegen steht die Reproduktion der Realität im Vordergrund (Kracauer, Bazin), wobei die Mise en Scène eine zentrale Rolle spielt. Godards Synthese dieser beiden Techniken wird als revolutionäre Neuordnung präsentiert, welche die Grenzen der filmischen Wirklichkeit neu definiert und die traditionelle Trennung zwischen Montage und Mise en Scène aufhebt.
Filmanalyse The Shining: Dieses Kapitel analysiert Stanley Kubricks "The Shining" im Hinblick auf seine Raum- und Zeitkonstruktionen. Es untersucht, wie Montage und Mise en Scène in diesem Film untrennbar miteinander verwoben sind und zur Darstellung der gestörten Wahrnehmung von Raum und Zeit beitragen. Konkrete Sequenzen werden analysiert, um die jeweiligen filmtechnischen Mittel zu beleuchten und deren Bedeutung für die Gesamtinterpretation zu verdeutlichen. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, wie der Film durch die Synthese von Montage und Mise en Scène eine eigene, einzigartige Realität schafft.
Der Zeit-Raum: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Zusammenspiel von Raum und Zeit in "The Shining" und wie diese durch die filmtechnischen Mittel dargestellt werden. Es wird analysiert, wie die Verzerrungen von Raum und Zeit im Film die Wahrnehmung des Zuschauers beeinflussen und zum Verständnis der Gesamtkomposition beitragen. Die Analyse fokussiert auf die Interdependenz von filmischer Montage und Mise en Scène im Kontext der Konstruktion eines subjektiven, "gestörten" Raumes und der damit verbundenen Zeitwahrnehmung.
Die Gestörtheit des Films: Dieses Kapitel untersucht die Selbstreferenzialität des Films als Konsequenz der Synthese von Montage und Mise en Scène. Es wird analysiert, wie der Film durch seine eigenen filmtechnischen Mittel seine eigene "Gestörtheit" reflektiert und wie diese Selbstreflexivität zum Verständnis der filmischen Wirklichkeit beiträgt. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, wie die vom Film dargestellte "Gestörtheit" selbst ein Bestandteil der filmischen Konstruktion von Realität ist.
Schlüsselwörter
Montage, Mise en Scène, Expressionismus, Realismus, Jean-Luc Godard, Stanley Kubrick, The Shining, Zeitkonstruktion, Raumkonstruktion, Filmanalyse, Wirklichkeitsdarstellung, Selbstreferenzialität.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Filmanalyse von "The Shining"
Was ist das zentrale Thema des Textes?
Der Text analysiert die Synthese von Montage und Mise en Scène im Film, basierend auf Jean-Luc Godards Auffassung. Er untersucht, wie diese Synthese die traditionellen Vorstellungen von Realismus und Expressionismus im Film beeinflusst und wie sie zur Konstruktion von Raum und Zeit im Film beiträgt. Stanley Kubricks "The Shining" dient als Fallbeispiel.
Welche Filmtheorien werden im Text behandelt?
Der Text behandelt expressionistische und realistische Filmtheorien. Im Expressionismus wird die Montage als Mittel zur Manipulation der Realität gesehen (Pudovkin, Eisenstein), während der Realismus die Reproduktion der Realität betont (Kracauer, Bazin). Der Text argumentiert für eine Synthese beider Ansätze nach Godard.
Wie wird "The Shining" in der Analyse verwendet?
Stanley Kubricks "The Shining" dient als Fallbeispiel, um die These der Synthese von Montage und Mise en Scène zu veranschaulichen. Die Analyse konzentriert sich auf die Raum- und Zeitkonstruktionen des Films und wie diese durch die filmtechnischen Mittel dargestellt werden.
Welche Aspekte von "The Shining" werden analysiert?
Die Analyse von "The Shining" fokussiert auf die gestörte Wahrnehmung von Raum und Zeit im Film. Konkrete Sequenzen werden untersucht, um zu zeigen, wie Montage und Mise en Scène untrennbar miteinander verwoben sind und zur Darstellung dieser "Gestörtheit" beitragen. Die Verzerrungen von Raum und Zeit und deren Einfluss auf den Zuschauer werden detailliert betrachtet.
Welche Rolle spielt die Selbstreferenzialität des Films in der Analyse?
Der Text untersucht die Selbstreferenzialität von "The Shining" als Konsequenz der Synthese von Montage und Mise en Scène. Es wird analysiert, wie der Film durch seine eigenen Mittel seine "Gestörtheit" reflektiert und wie diese Selbstreflexivität zum Verständnis der filmischen Wirklichkeit beiträgt.
Welche Schlüsselkonzepte werden im Text behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Montage, Mise en Scène, Expressionismus, Realismus, Jean-Luc Godard, Stanley Kubrick, "The Shining", Zeitkonstruktion, Raumkonstruktion, Filmanalyse, Wirklichkeitsdarstellung und Selbstreferenzialität.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst Kapitel zu Einleitung, Montage und Mise en Scène, Filmanalyse von "The Shining" (inkl. Sequenzgrafik, gestörter Zeit und Raum, insbesondere das Labyrinth), Der Zeit-Raum, Die Gestörtheit des Films und Schluss.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Synthese von Montage und Mise en Scène im Film und deren Einfluss auf die Darstellung von Raum, Zeit und Wirklichkeit. Der Text will zeigen, wie diese Synthese die traditionellen Kategorien von Realismus und Expressionismus transzendiert.
- Citation du texte
- Katrin Geiser (Auteur), 2004, Zeit-Räume in Stanley Kubricks The Shining, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37649