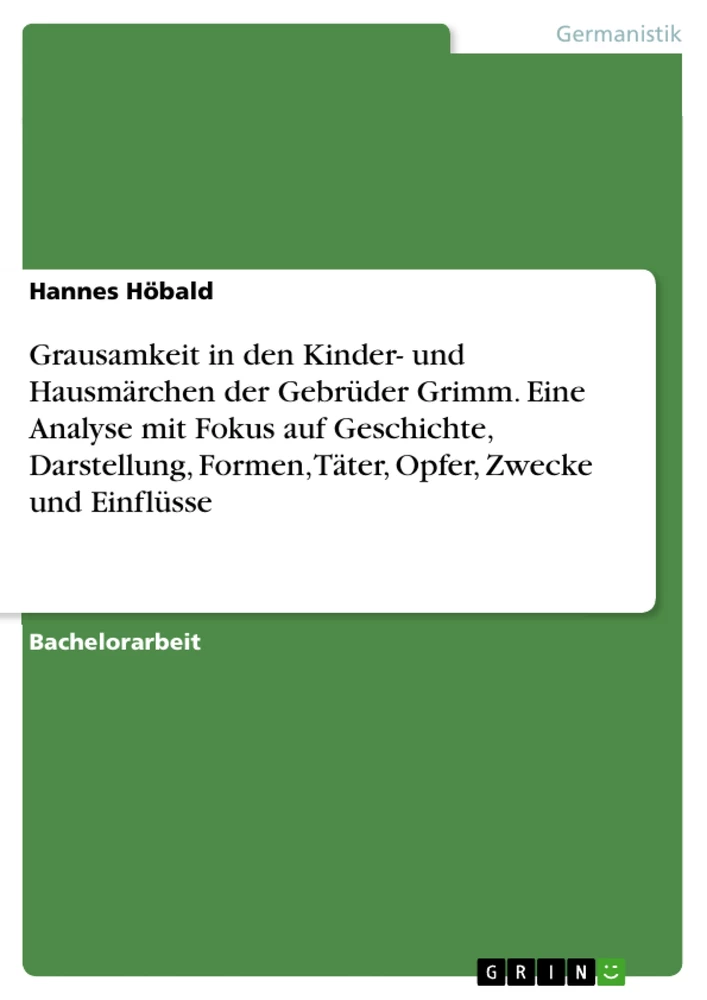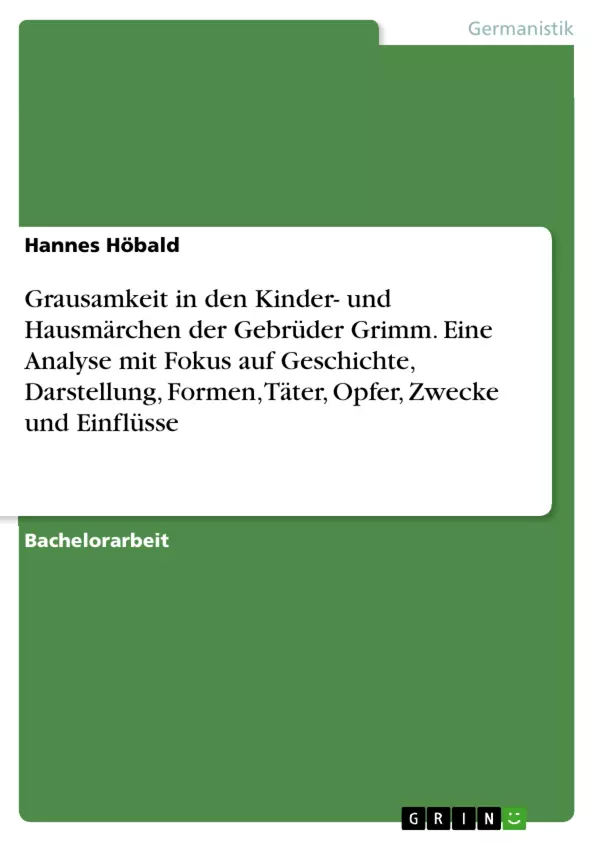Was sind Märchen? Wunderschöne und liebliche Geschichten, in denen von strahlenden Helden und holden Jungfrauen berichtet wird, die am Ende jedes Märchens glücklich und zufrieden leben. Was kommt im Märchen nicht vor? Böses, Abscheuliches, Grausames, all das, was negativ konnotiert ist, ist kein Teil der friedlichen und wunderschönen Märchenwelt. So oder so ähnlich antworten viele Leute, wenn man sie über Märchen befragt, denn aus verschiedensten Gründen scheinen sie den ganzen Bereich der Grausamkeit zu übersehen. Bei der Frage nach dem Gründen dafür scheiden sich die Geister, vielleicht sind die Leser dumm, vielleicht haben sie ein vollkommen verzerrtes Märchenbild erhalten durch die oftmals sehr beliebten Märchenfilme von Walt Disney oder sie überlesen schlichtweg all das Dunkle, Böse, Grausame des Märchens.
Dies wäre sicherlich ein paar weitere Überlegungen wert, aber darum geht es in dieser Arbeit nicht, der Titel lautet immerhin Grausamkeit in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm, es soll sich also explizit auf die Grausamkeiten bezogen werden, die sich in dem weltweit beliebten Märchenbuch der Grimms finden lassen, denn „schon allein die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm bieten einen ergiebigen Katalog grausamer (g.er) Handlungen“ . Wer sich etwas genauer mit diesen Märchen beschäftigt, wird merken, dass sie eine reiche Sammlung beinhalten an verschiedensten Grausamkeiten, von relativ harmlosen Tierverwandlungen wie in KHM 161, über Mütter, die ihre Kinder umbringen, wie in KHM 47, bis hin zu Männern, die in ihrem Schloss Frauenleichen aufgehängt haben, wie in KHM 46. Das sind gerade mal drei Märchen von insgesamt 200, mit den Kinderlegenden sind es 210. Es zeigt sich also deutlich: „extreme Verbrechen, Brudermord, Kindermord, häßliche Verleumdung sind im Märchen an der Tagesordnung, ebenso wie grausame Strafmethoden“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Geschichte der Grausamkeit in den KHM
- Die Darstellung der Grausamkeit
- Die Formen der Grausamkeit
- Grausamkeit mit sichtbaren Schäden für den Körper
- Grausamkeit ohne sichtbare Schäden für den Körper
- Die Täter und Opfer der Grausamkeit
- Der gute Mann
- Der böse Mann
- Die gute Frau
- Die böse Frau
- Das gute Kind
- Das böse Kind
- Das gute Tier
- Das böse Tier
- Zwecke der Grausamkeit
- Die strafende Grausamkeit
- Die lehrende Grausamkeit
- Die erlösende Grausamkeit
- Die verhüllende Grausamkeit
- Einflüsse auf die Grausamkeit
- Kulturhistorische Einflüsse
- Einflüsse aus dem Volksglauben
- Einflüsse durch andere Erzählgattungen
- Grausamkeit im Kinderzimmer
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Grausamkeit in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte dieser Thematik zu beleuchten und zu analysieren. Dabei sollen sowohl die historische Entwicklung der Grausamkeit in den KHM als auch die verschiedenen Formen und Zwecke der Grausamkeit untersucht werden. Zusätzlich werden die Täter und Opfer der Grausamkeit sowie die Einflüsse auf diese Thematik betrachtet.
- Die historische Entwicklung der Grausamkeit in den KHM
- Die Darstellung der Grausamkeit in den Märchen
- Die verschiedenen Formen und Zwecke der Grausamkeit
- Die Täter und Opfer der Grausamkeit in den KHM
- Die Einflüsse auf die Grausamkeit in den Märchen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Grausamkeit ein wichtiges Element in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm ist. Es wird auf die unterschiedlichen Reaktionen auf Grausamkeit im Märchen eingegangen, insbesondere die Frage, ob Märchen zu grausam für Kinder seien.
- Die Geschichte der Grausamkeit in den KHM: Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung der Grausamkeit in den KHM. Es wird untersucht, ob besonders grausame Stellen in den Märchen gestrichen oder verändert wurden und welche Einflüsse zu den Veränderungen der Inhalte von Auflage zu Auflage geführt haben.
- Die Darstellung der Grausamkeit: Das Kapitel analysiert die Darstellung von Grausamkeit in den Textpassagen. Es wird untersucht, ob von einer Verherrlichung von Grausamkeit gesprochen werden kann und welche Rolle die Darstellung für die Frage nach der „Grausamkeit“ für Kinder spielt.
- Die Formen der Grausamkeit: Hier werden die verschiedenen Formen von Grausamkeit innerhalb der KHM untersucht. Es wird erörtert, ob es nur grausame Taten gibt, die sich auf den Körper beziehen, oder ob auch psychische Grausamkeiten vorkommen.
- Die Täter und Opfer der Grausamkeit: Dieses Kapitel untersucht die Täter und Opfer der Grausamkeit in den Märchen. Es wird beleuchtet, welche Figuren am häufigsten Opfer und welche am häufigsten Täter in bestimmten Zusammenhängen sind.
- Zwecke der Grausamkeit: Hier werden die verschiedenen Zwecke der Grausamkeit in der Handlung untersucht. Es wird geprüft, ob die grausamen Taten nur als Strafe zu sehen sind oder ob sie auch befreiend wirken können. Zudem wird die Frage gestellt, ob manche grausamen Stellen mehrdeutig zu verstehen sind.
- Einflüsse auf die Grausamkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Einflüssen auf die Grausamkeit in den Märchen. Es werden historische Begebenheiten, der Volksglaube und andere Erzählgattungen als mögliche Einflussfaktoren beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kinder- und Hausmärchen, Gebrüder Grimm, Grausamkeit, Märchenforschung, Kulturhistorische Einflüsse, Volksglaube, Erzählgattungen, Täter, Opfer, Kinder, Pädagogik, Interpretation, .
Häufig gestellte Fragen
Sind die Märchen der Gebrüder Grimm wirklich so grausam?
Ja, die Kinder- und Hausmärchen (KHM) enthalten zahlreiche Grausamkeiten, von Kindermord und Verstümmelung bis hin zu extremen Strafmethoden, die oft übersehen oder durch moderne Verfilmungen beschönigt werden.
Welchen Zweck erfüllt die Grausamkeit im Märchen?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Zwecke: strafende Grausamkeit (Gerechtigkeit), lehrende Grausamkeit (Warnung), erlösende Grausamkeit (Befreiung durch Schmerz) und verhüllende Grausamkeit.
Gibt es neben körperlicher auch psychische Grausamkeit?
Ja, die Analyse zeigt, dass neben sichtbaren körperlichen Schäden auch psychische Gewalt, wie Verleumdung oder emotionaler Missbrauch, ein fester Bestandteil der Märchenwelt ist.
Wer sind typische Täter und Opfer in den Grimm-Märchen?
Die Studie untersucht Rollenbilder wie den „bösen Mann“, die „böse Frau“ (oft Stiefmütter) und das „gute Kind“. Dabei zeigt sich, dass Grausamkeit oft innerhalb familiärer Strukturen auftritt.
Welche Einflüsse prägten die Grausamkeit in den Märchen?
Kulturhistorische Gegebenheiten der Entstehungszeit, der Volksglaube sowie Einflüsse aus anderen Erzählgattungen haben die Darstellung von Gewalt in den KHM maßgeblich beeinflusst.
Haben die Grimms grausame Stellen für Kinder entschärft?
Die Arbeit untersucht die Geschichte der KHM und zeigt, dass Inhalte von Auflage zu Auflage verändert wurden, wobei manche Stellen gestrichen, andere jedoch aus pädagogischen Gründen betont wurden.
- Quote paper
- Hannes Höbald (Author), 2011, Grausamkeit in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Eine Analyse mit Fokus auf Geschichte, Darstellung, Formen, Täter, Opfer, Zwecke und Einflüsse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376532