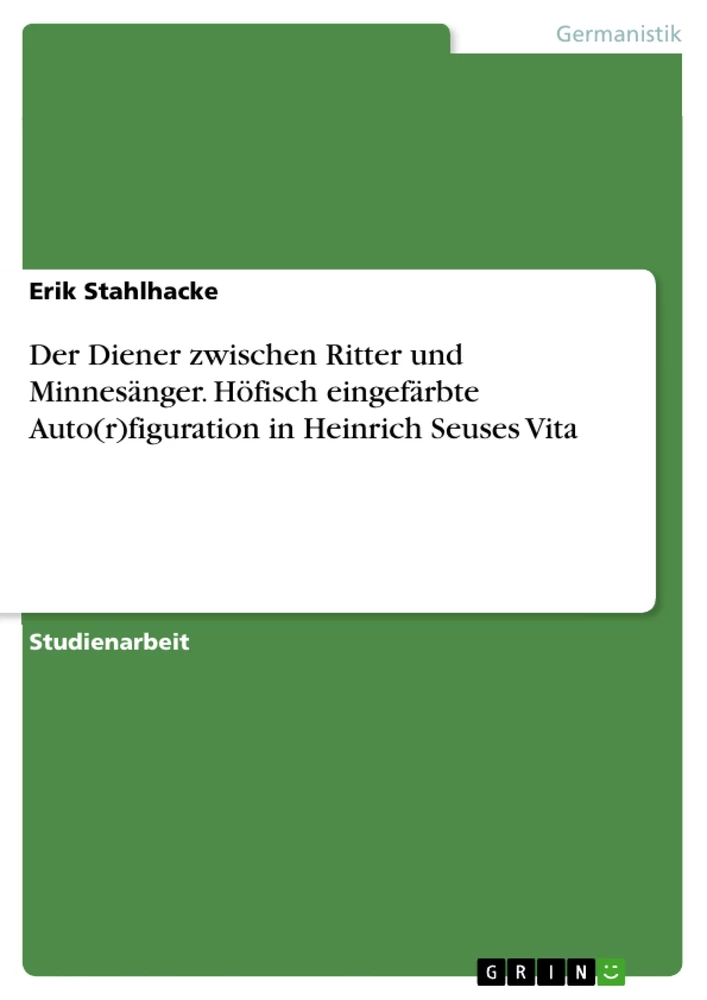Die Vita Heinrich Seuses ist ein in der Forschung viel diskutiertes Werk. Lange wurde sie als Autobiographie gelesen, doch in den letzten Jahren ist die Forschung von dieser Auffassung abgekommen. Man ist sich einig, dass zwar Bestandteile der Vita eindeutig dem Leben des Autors zugerechnet werden können, wie beispielsweise die Fußtuchepisode oder Seuses seelsorgerische Tätigkeit mit Nonnen. Auch die Selbstzüchtigung, wie der Diener sie durchführt, wird, wenn auch in etwas abgeschwächter Form, als authentisch angenommen. Allerdings besteht auch Konsens über die bewusste didaktische Auslegung des Werks und dadurch bedingte strukturgebende Erzähltechniken. Systematische Zusammenfassungen und die Konstruktion eines Doppelwegschemas machen die Vita zu einem Lehrbuch mit stark autobiographischen Zügen. Seuse stilisiert sich selbst im Diener als ein nachahmungswürdiges Vorbild und stellt für seine Rezipienten, hauptsächlich Nonnen, eine starke Möglichkeit der Identifikation dar.
Auffällig oft bedient sich Seuse dabei weltlich-höfischer Bildsphären, die nahelegen, dass ihm sowohl die höfische Kultur als auch die höfische Epik durchaus geläufig gewesen sind. Seuse stammte vermutlich aus einem Konstanzer Patriziergeschlecht und wurde, wie seine Rezipientinnen, nachhaltig vom höfischen Roman beeinflusst. Ritterschaft und Minne sind Leitbegriffe seiner Vita und werden in seinem Sinne funktionalisiert.
Die Forschung hat sich bisher vor allem darum bemüht, das Konzept der geistlichen Ritterschaft zu entschlüsseln. Auch eindeutige Parallelen zwischen der Beziehung des Dieners zur Ewigen Weisheit und einer weltlichen Minnekonzeption wurden mehrfach erörtert. Regelmäßig wurden dabei beide Konzepte miteinander vermengt und die Minnethematik zu Gunsten der geistlichen Ritterschaft vernachlässigt. Aufgabe der vorliegenden Arbeit soll es daher sein, beide Konzepte, soweit dies möglich und angemessen ist, voneinander getrennt zu betrachten. Dabei sollen anhand ausgesuchter Textstellen präzise Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie die beiden weltlichen Rollenbilder, nämlich das des Ritters auf der einen Seite und jenes des Minnenden auf der anderen, konstruiert werden, wie weltliche und geistliche Konzepte miteinander korrelieren und welche weltlichen Texttraditionen herangezogen werden. Anschließend wird zu erläutern sein, zu welchem Zweck Seuse den Diener in weltliche Rollenbilder schlüpfen lässt und inwiefern eine Autorenintention der Figuration deutlich wird.
Inhaltsverzeichnis
- Seuses höfischer Horizont
- Der Diener als Minnender
- Das Zusammenspiel von geistlicher und weltlicher Minne
- Der Diener als Minnesänger
- Einflüsse höfischer Epik
- Konzeption von Männlichkeit
- Der Diener als Ritter
- Ritterlichkeit im Aushalten
- Sprachliche und rhetorische Ausgestaltung von Ritterschaft
- Regisseur Seuse und sein Schauspieler
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Vita Heinrich Seuses und analysiert die Konstruktionen von Männlichkeit und dem Zusammenspiel von geistlicher und weltlicher Minne in der Figur des Dieners. Der Fokus liegt auf der Analyse von Seuses Verwendung höfischer Rollenbilder und Texttraditionen, um den Diener in die Rolle eines Minnesängers und Ritters zu schlüpfen.
- Die Verwendung höfischer Bildsphären und ihre Bedeutung in Seuses Vita
- Das Konzept der geistlichen Ritterschaft in der Vita
- Die Interaktion zwischen weltlicher und geistlicher Minne in der Figur des Dieners
- Seuses Nutzung höfischer Epik und Minnesang in seiner Vita
- Die Autorenintention in der Figuration des Dieners
Zusammenfassung der Kapitel
Seuses höfischer Horizont
Das erste Kapitel beleuchtet Seuses höfisches Umfeld und analysiert die Vita hinsichtlich ihrer autobiographischen Aspekte und didaktischen Ausrichtung. Dabei wird die Bedeutung höfischer Kultur und Epik für Seuse hervorgehoben.
Der Diener als Minnender
Das zweite Kapitel behandelt Seuses Verwendung der Minnethematik in der Vita. Es werden Parallelen zwischen der Liebe des Dieners zur Ewigen Weisheit und einer weltlichen Minnekonzeption gezogen. Die Gegenüberstellung von weltlicher und geistlicher Minne und die Darstellung der Ewigen Weisheit als Minnedame werden analysiert.
Konzeption von Männlichkeit
Das dritte Kapitel betrachtet Seuses Konzeption von Männlichkeit in der Vita. Es werden die vielfältigen Möglichkeiten der Identifikation, die der Diener für die Rezipienten, hauptsächlich Nonnen, darstellt, analysiert.
Der Diener als Ritter
Das vierte Kapitel analysiert die Darstellung des Dieners als Ritter. Es werden die Elemente der Ritterlichkeit im Aushalten und die sprachliche und rhetorische Ausgestaltung der Ritterschaft in der Vita erörtert.
Regisseur Seuse und sein Schauspieler
Das fünfte Kapitel fokussiert sich auf die Autorenintention in der Figuration des Dieners. Es analysiert Seuses Verwendung von weltlichen Rollenbildern und zeigt, wie er den Diener in diese Rollen schlüpfen lässt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit analysiert die Vita Heinrich Seuses unter den Schwerpunkten höfische Kultur, geistliche Ritterschaft, Minnekonzeption, Männlichkeitskonzepte, höfische Epik, Autorenintention und Figurenfiguration. Die Analyse basiert auf der Verwendung von Textbeispielen aus der Vita und bezieht sich auf die Forschungsliteratur zum Thema.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Vita Heinrich Seuses eine echte Autobiographie?
In der Forschung wird sie heute eher als didaktisches Lehrbuch mit autobiographischen Zügen verstanden, in dem Seuse sich selbst als nachahmungswürdiges Vorbild stilisiert.
Warum nutzt Seuse Rollenbilder wie den Ritter und den Minnesänger?
Seuse nutzt diese weltlich-höfischen Bilder, um seinen Rezipienten (hauptsächlich Nonnen) Identifikationsmöglichkeiten zu bieten und geistliche Konzepte durch vertraute kulturelle Codes zu vermitteln.
Was versteht man unter „geistlicher Ritterschaft“ in der Vita?
Es ist die Umdeutung ritterlicher Tugenden wie Tapferkeit und Aushalten auf den geistlichen Kampf und die Askese des christlichen Lebens.
Welche Rolle spielt die „Ewige Weisheit“?
Die Ewige Weisheit wird in der Vita oft als Minnedame dargestellt, zu der der „Diener“ eine Beziehung aufbaut, die Parallelen zur weltlichen Minne aufweist.
Wie beeinflusste die höfische Epik das Werk?
Seuse stammte vermutlich aus einem Patriziergeschlecht und war mit der höfischen Kultur vertraut, weshalb er literarische Traditionen des Minnesangs und ritterlicher Romane funktionalisierte.
- Quote paper
- Erik Stahlhacke (Author), 2016, Der Diener zwischen Ritter und Minnesänger. Höfisch eingefärbte Auto(r)figuration in Heinrich Seuses Vita, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376820