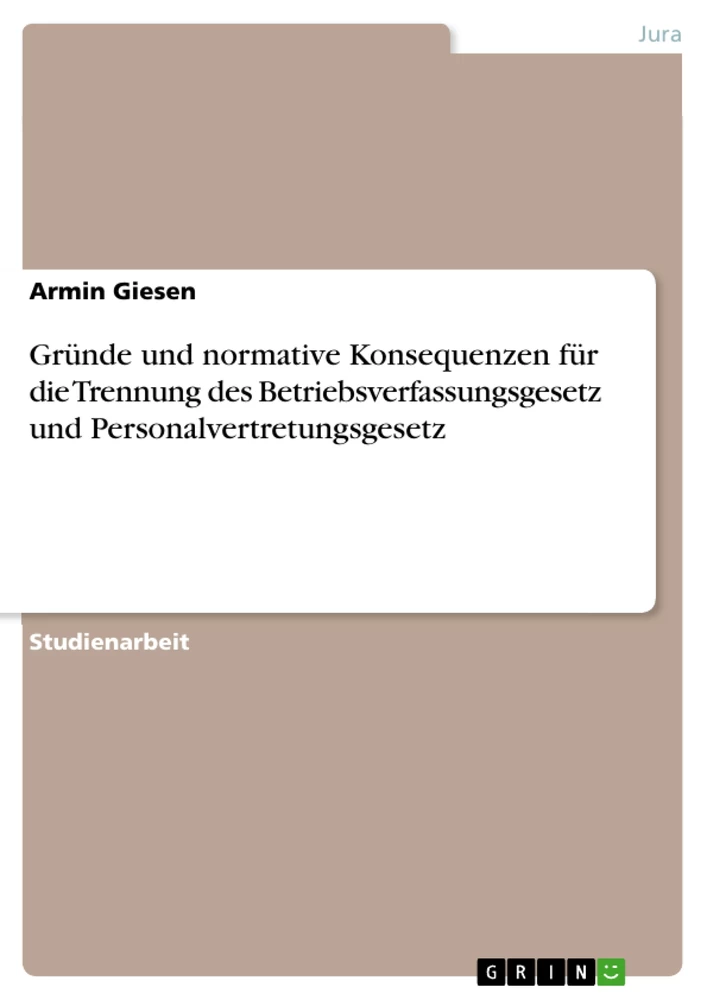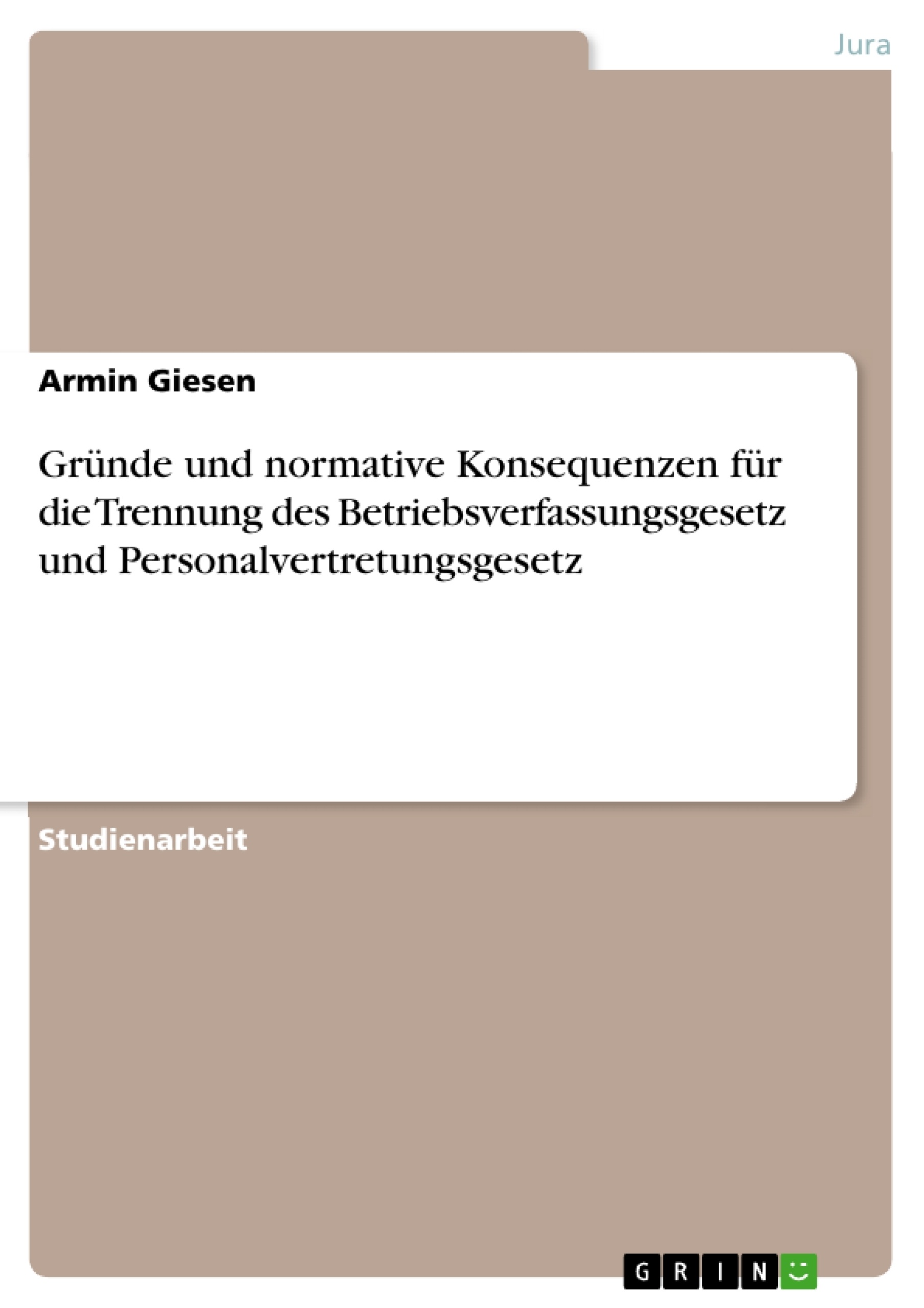Ziel dieser Arbeit ist es darzustellen, warum es zu der Trennung von Betriebsverfassungsrecht und Personalvertretungsrecht kam und welche Gründe und Entwicklungen ausschlaggebend sind und waren. In der heutigen Zeit lässt sich eine Angleichung der äußeren Organisation und Arbeitssituation in Verwaltung und Privatwirtschaft feststellen.
Im ersten Teil soll herausgearbeitet werden, wie es zur der Trennung dieser Rechtsgebiete kam und welche Ursachen dafür ausschlaggebend waren. Dabei wird besonders auf die Entstehung der jeweiligen Gesetze eingegangen. Anschließend wird versucht, die nach dem gegenwärtigen Recht bestehenden bedeutsamen Unterschiede in den Strukturen von Betriebsverfassungsrecht und Personalvertretungsrecht und die Rechte der an der Vertretung Beteiligten durch Vergleich herauszuarbeiten. Ein Schwerpunkt wird dabei auf den Mitbestimmungsrechten und der Institution der Einigungsstelle liegen. Dabei geht es um die Mitbestimmung bezüglich Entscheidungen, die auf der Betriebs- und Dienststellenebene gefällt werden.
Diese Rechte gewähren eine Kompetenz der Beschäftigungsseite auf Teilhabe an die Arbeit betreffenden Entwicklungsprozessen, die sonst allein von der öffentlichen bzw. privaten Arbeitgeberseite bestimmt würden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung und Aufgabenstellung
- B. Trennungsgründe
- I. Geschichte der Gesetzgebung über die „betriebliche“ Mitbestimmung
- II. Entwicklung der Verwaltung
- III. Interessenlage und rechtspolitische Zielsetzung der Gesetze
- IV. Sonderstellung der Beamten
- 1. Ausgestaltung durch Gesetze
- 2. Treuepflicht der Beamten
- C. Unterschiede zwischen BetrVG und BPersVG
- I. Abgrenzung der Geltungsbereiche
- 1. Sachlicher und räumlicher Geltungsbereich
- 2. Persönlicher Geltungsbereich
- II. Gesetzessystematik
- III. Gestaltung der Mitbestimmungsordnung
- 1. Allgemeine Vorschriften über Beteiligungsrechte
- 2. Besonderheiten im Bundespersonalvertretungsgesetz
- 3. Mitwirkungsrechte
- 4. Besonderheit der Einigungsstelle im Personalvertretungsrecht
- IV. Rechtsweg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es darzustellen, warum es zu der Trennung von Betriebsverfassungsrecht und Personalvertretungsrecht kam und welche Gründe und Entwicklungen ausschlaggebend sind und waren. In der heutigen Zeit lässt sich eine Angleichung der äußeren Organisation und Arbeitssituation in Verwaltung und Privatwirtschaft feststellen.
- Die Entstehung der Trennung von Betriebsverfassungsrecht und Personalvertretungsrecht.
- Die historischen Ursachen und Entwicklungen, die zu dieser Trennung führten.
- Die Unterschiede in den Strukturen von Betriebsverfassungsrecht und Personalvertretungsrecht.
- Die Rechte der an der Vertretung Beteiligten, insbesondere die Mitbestimmungsrechte und die Institution der Einigungsstelle.
- Die Bedeutung der Mitbestimmung bei Entscheidungen, die auf der Betriebs- und Dienststellenebene getroffen werden.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Aufgabenstellung: Die Einleitung stellt die Zielsetzung der Arbeit dar, die die Trennung von Betriebsverfassungsrecht und Personalvertretungsrecht untersucht. Sie betont die Angleichung der Arbeitssituation in Verwaltung und Privatwirtschaft.
- Trennungsgründe: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln der Trennung. Es wird auf die Besonderheiten des öffentlichen Dienstes und die Entstehung der jeweiligen Gesetze eingegangen.
- Geschichte der Gesetzgebung über die „betriebliche“ Mitbestimmung: Die Entwicklung der Mitbestimmung in beiden Bereichen wird in diesem Kapitel dargestellt. Der Unterschied zwischen privaten Unternehmen und dem öffentlichen Dienst wird hervorgehoben, wobei die Rolle der Beamten im öffentlichen Dienst besondere Aufmerksamkeit erhält.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Trennung von Betriebsverfassungsrecht und Personalvertretungsrecht, den Gründen für diese Trennung, den historischen Entwicklungen der „betrieblichen“ Mitbestimmung, den Unterschieden zwischen den beiden Rechtsgebieten, den Rechten der Beteiligten und der Bedeutung der Mitbestimmung in beiden Bereichen.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es eine Trennung zwischen BetrVG und BPersVG?
Die Trennung beruht auf historischen Entwicklungen und der besonderen Rechtsstellung von Beamten sowie der spezifischen Interessenlage im öffentlichen Dienst.
Was regelt das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)?
Es regelt die Zusammenarbeit von Arbeitgeber und Belegschaft in der Privatwirtschaft, insbesondere die Rechte und Pflichten des Betriebsrates.
Was regelt das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)?
Es bildet die rechtliche Grundlage für die Mitbestimmung der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung durch Personalräte.
Worin unterscheiden sich die Mitbestimmungsrechte?
Unterschiede liegen in der Gestaltung der Beteiligungsrechte, der Rolle der Einigungsstelle und dem Einfluss der Beamten-Treuepflicht im öffentlichen Dienst.
Gibt es eine Annäherung zwischen Verwaltung und Privatwirtschaft?
Ja, in der heutigen Zeit lässt sich eine zunehmende Angleichung der äußeren Organisation und der Arbeitssituation in beiden Bereichen feststellen.
- Citar trabajo
- Armin Giesen (Autor), 2013, Gründe und normative Konsequenzen für die Trennung des Betriebsverfassungsgesetz und Personalvertretungsgesetz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376838