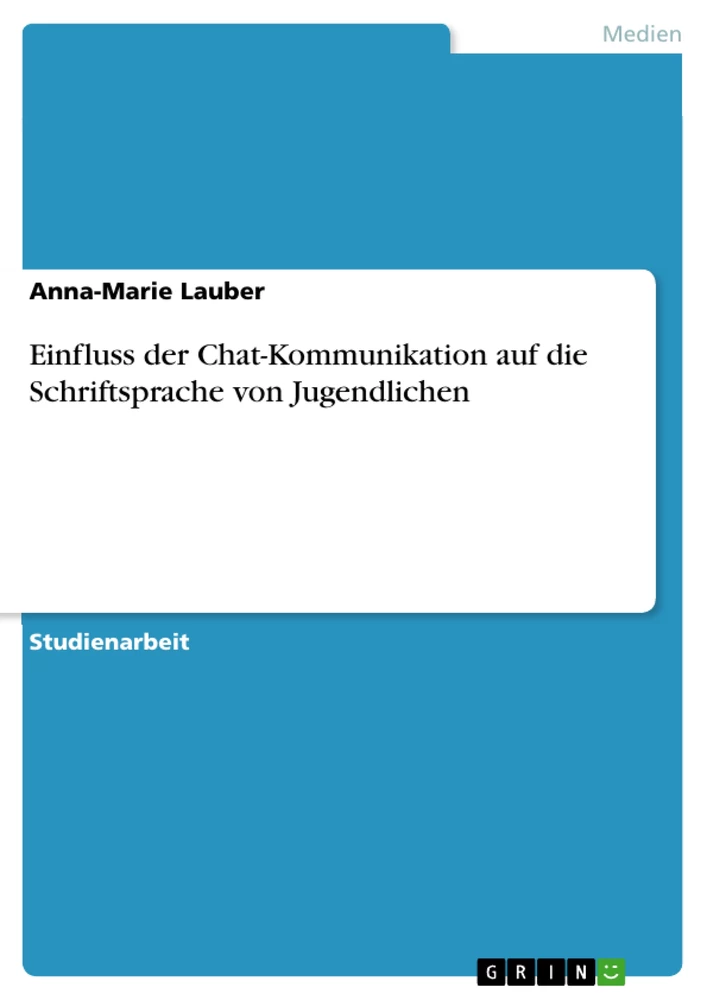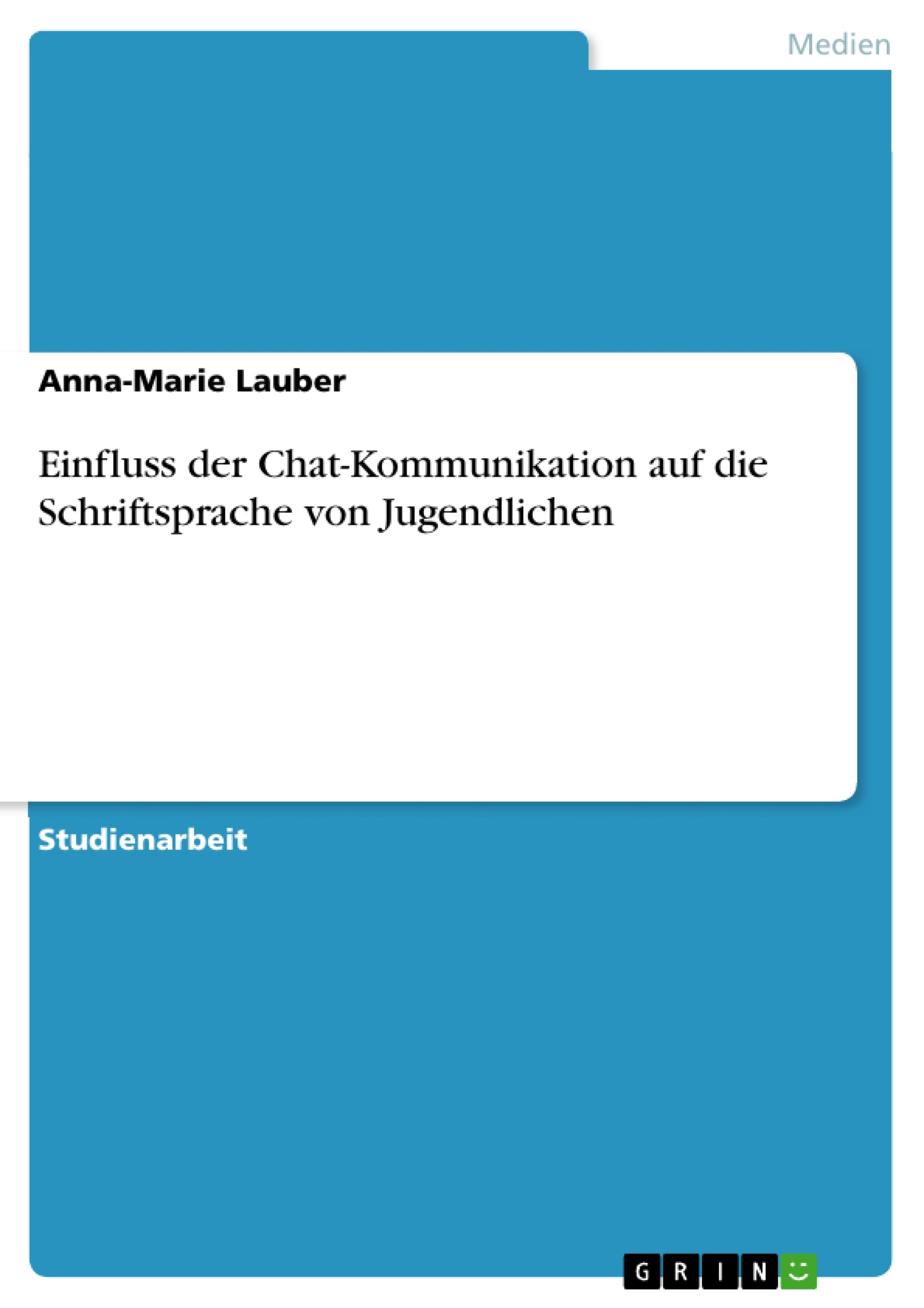In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob und inwieweit sich die Schriftsprache Jugendlicher außerhalb der virtuellen Realität durch den vermehrten Einsatz von Chats in den letzten Jahren verändert hat. Ziel dieser Arbeit ist es, Veränderungen in der Sprache Jugendlicher anhand der aktuellen Forschung zu beschreiben und zu identifizieren.
Hierzu wird zunächst die Kommunikationsform Chat anhand des Modells zur Mündlichkeit und Schriftlichkeit von Koch und Oesterreicher (1994) eingeordnet, analysiert und charakterisiert. Diese Analyse der Kommunikationsform Chat wird im Vergleich mit der Face-to-Face-Kommunikation weitergeführt.
Chats in jeglicher Form sind im letzten Jahrzehnt zu einem wichtigen Bestandteil in der Kommunikation von Jugendlichen geworden. Egal, ob es sich um Instant Messenger wie ICQ, Windows Live Messenger oder WhatsApp, um Webchats oder um die Chat-Funktionen sozialer Netzwerke wie Facebook handelt, ein Großteil der Kommunikation zwischen Jugendlichen findet medienvermittelt statt.
Ob diese vermehrte Verwendung eines neuen sprachlichen Duktus sich auch auf die Schriftsprache der Jugendlichen außerhalb der virtuellen Welt von Chats auswirkt, ist in der Forschung umstritten. Vor allem in der Öffentlichkeit, aber auch in den Publikationen einiger Wissenschaftler, wird die Meinung vertreten, die Sprache, die Jugendliche in den Chat-Programmen verwenden, färbe auf die Schriftsprache außerhalb der Chats negativ ab. In der Gegenposition wird betont, dass Jugendliche (wie auch Personen anderer Altersgruppen) sehr gut zwischen den verschiedenen Sprech- und Schreibsituationen unterscheiden können und so den jeweils angemessenen sprachlichen Duktus verwenden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- KLASSIFIZIERUNG DER KOMMUNIKATIONSFORM,CHATʻ.
- MODELL DER MEDIALEN / KONZEPtionellen MündLICHKEIT BZW. SCHRIFTLICHKEIT....
- EINORDNUNG DER CHAT-KOMMUNIKATION
- ANALYSE DER CHAT-KOMMUNIKATION ............
- GRUNDSÄTZLICHE TRÄGERMEDIALE BEDINGTHEiten in der ChaT-KOMMUNIKATION...
- LINGUISTISCHE MERKMALE DER CHAT-KOMMUNIKATION........
- VERÄNDERUNG DER SCHRIFTSPRACHE JUGENDLICHER DURCH DEN VERMEHRTEN EINSATZ VON CHAT-KOMMUNIKATION? - VORSTELLUNG EINIGER STUDIEN AUS DIESEM FORSCHUNGSGEBIET
- VERGLEICHSSTUDIE ZUR SPRACHVERWENDUNG AUF ARTIKEL- UND Diskussionsseiten DER DEUTSCHEN WIKIPEDIA..
- PROJEKT,,SCHREIBKOMPETENZ UND NEUE MEDIEN“.
- FAZIT UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit sich die Schriftsprache Jugendlicher außerhalb der virtuellen Realität durch den vermehrten Einsatz von Chats in den letzten Jahren verändert hat. Ziel ist es, Veränderungen in der Sprache Jugendlicher anhand der aktuellen Forschung zu beschreiben und zu identifizieren.
- Einteilung der Kommunikationsform Chat anhand des Modells der Mündlichkeit und Schriftlichkeit von Koch und Oesterreicher (1994).
- Analyse der Chat-Kommunikation im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation.
- Vorstellung aktueller Studien zum Thema Sprache und Chat-Kommunikation von Jugendlichen.
- Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfrage.
- Zusammenfassende Schlussfolgerungen und Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der Chat-Kommunikation im Alltag von Jugendlichen dar. Es beleuchtet die kontroverse Diskussion über die Auswirkungen von Chats auf die Schriftsprache. Kapitel 2 klassifiziert die Kommunikationsform „Chat“ anhand des Modells von Koch und Oesterreicher (1994) und stellt die medialen und konzeptionellen Aspekte der Mündlichkeit und Schriftlichkeit gegenüber. Kapitel 3 analysiert die Chat-Kommunikation im Detail und betrachtet ihre spezifischen medialen und linguistischen Merkmale.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: Chat-Kommunikation, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Jugendsprache, Mediensprache, Sprachwandel, Sprachkompetenz, empirische Forschung, Kommunikationstheorie, mediale und konzeptionelle Schriftlichkeit, Sprachvergleich, Internetsprache, digitale Medien.
Häufig gestellte Fragen
Verändert Chat-Kommunikation die Schriftsprache von Jugendlichen negativ?
Das ist in der Forschung umstritten. Während die Öffentlichkeit oft einen Sprachverfall fürchtet, betonen viele Wissenschaftler, dass Jugendliche sehr gut zwischen Chat-Stil und formaler Schriftsprache unterscheiden können.
Was ist das Modell von Koch und Oesterreicher?
Es unterscheidet zwischen medialer und konzeptioneller Mündlichkeit/Schriftlichkeit. Chats sind medial schriftlich, aber oft konzeptionell mündlich (nahe an der gesprochenen Sprache).
Welche linguistischen Merkmale sind typisch für Chats?
Typisch sind Abkürzungen, Emoticons, Kleinschreibung, Lautmalereien (Inflektive wie *lach*) und eine starke Orientierung an der Unmittelbarkeit des Gesprächs.
Gibt es Studien, die Auswirkungen auf die Schulschreibweise belegen?
Die Arbeit stellt Studien wie „Schreibkompetenz und neue Medien“ vor, die untersuchen, ob Chat-Elemente in Schulaufsätze einfließen oder ob Jugendliche kontextabhängig variieren.
Warum nutzen Jugendliche Chats so intensiv?
Messenger wie WhatsApp oder Social-Media-Chats sind essenzielle Werkzeuge zur sozialen Interaktion, Identitätsbildung und ständigen Erreichbarkeit in der Peer-Group.
Was ist das Fazit zum Thema Sprachwandel durch Chats?
Chats führen zu einem neuen sprachlichen Duktus, aber nicht zwangsläufig zum Verlust der Rechtschreibkompetenz in formellen Kontexten.
- Quote paper
- Anna-Marie Lauber (Author), 2014, Einfluss der Chat-Kommunikation auf die Schriftsprache von Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376878