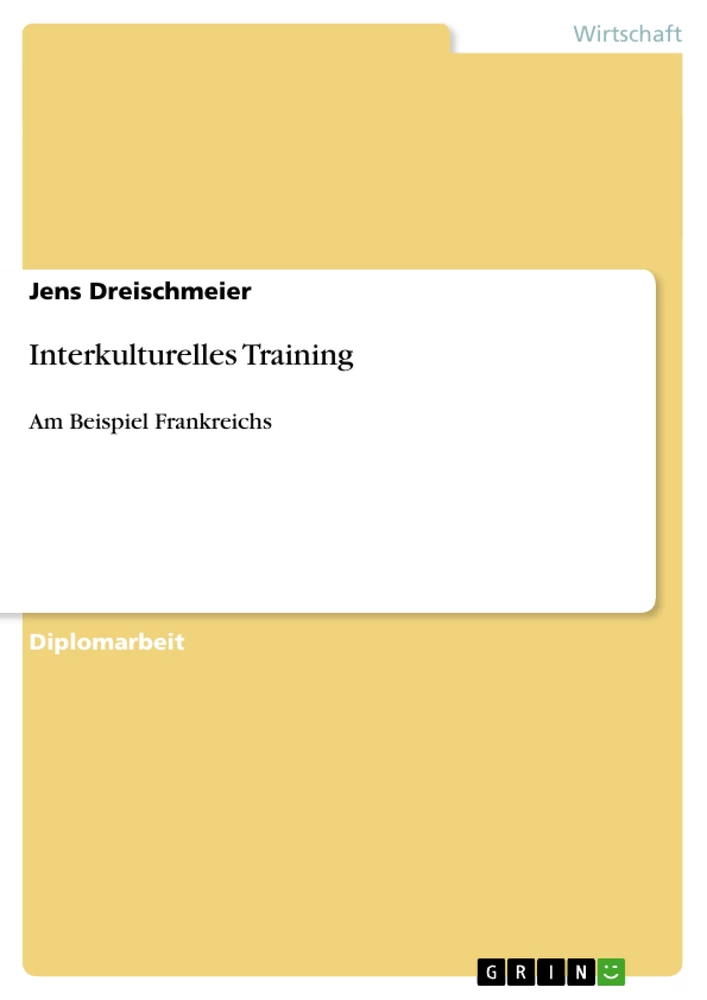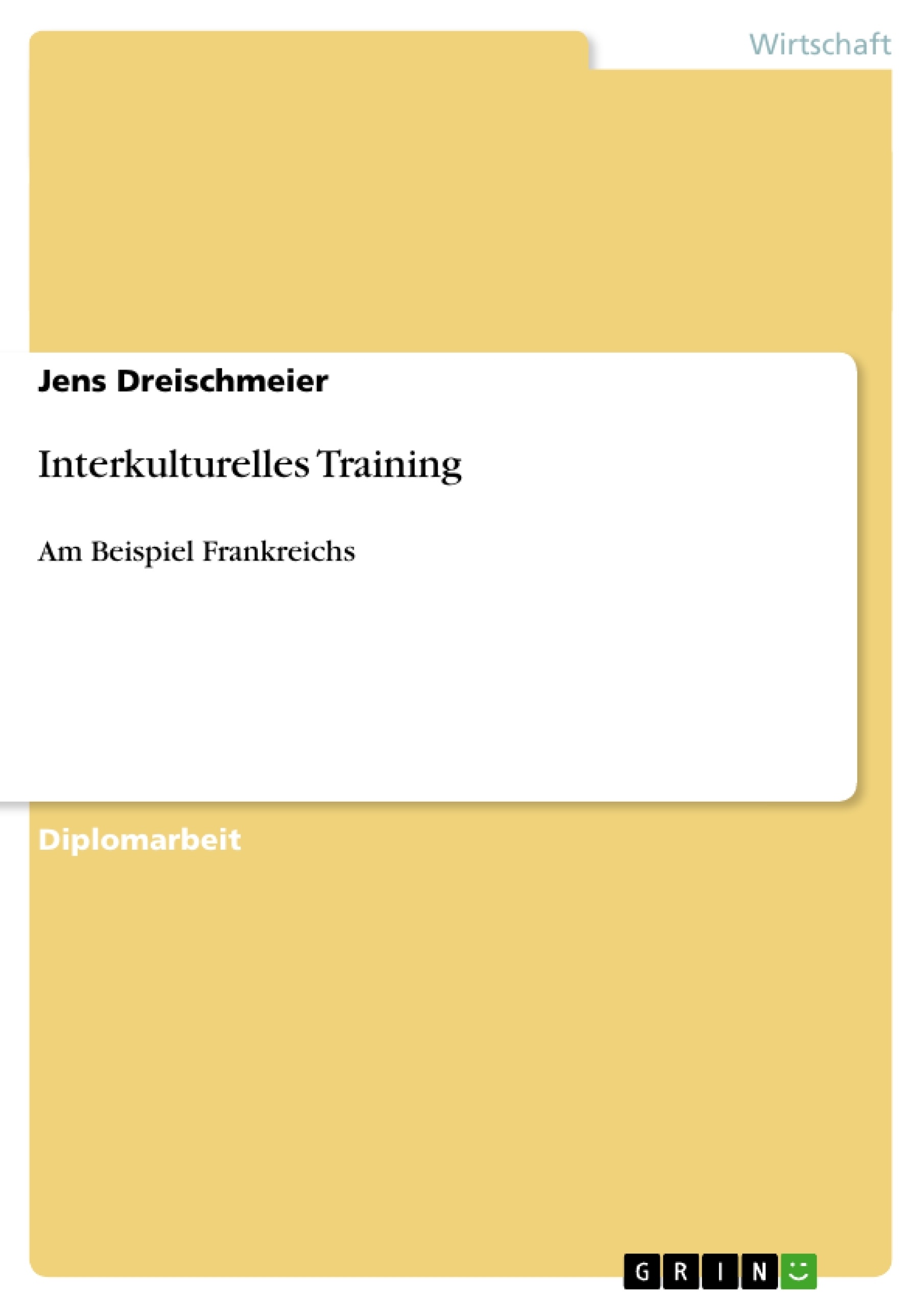Durch steigende internationale Geschäftstätigkeiten, die Gründung von Auslandstöchtern, Fusionen und grenzüberschreitender Joint Ventures wird die Zusammenarbeit mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen zunehmend wichtiger. Unternehmen schicken ihr Personal ins Ausland, Mitarbeiter arbeiten mit fremdkulturellen Interaktionspartnern zusammen und/oder haben viel Auslandskontakt.
Ein wichtiger Handelspartner für Deutschland ist dabei Frankreich. Sowohl bei dem Anteil deutscher Exporte als auch bei dem Anteil der Einfuhren nimmt Frankreich mit 10,6% bzw. 9,2% als deutscher Handelspartner die Spitzenposition 2003 ein. Aufgrund dieser intensiven bilateralen Geschäftsbeziehungen mit Frankreich kommt es in der Praxis häufig zu interkulturellen Kontaktpunkten. Die ohnehin schon bestehende Komplexität einer geschäftlichen Beziehung wird durch den „Kulturfaktor“ erhöht. So zeigen die Schwierigkeiten der aus internationalen Fusionen hervorgegangenen Unternehmen wie EADS oder Aventis, dass kulturelle Unterschiede immer noch massiv unterschätzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Vorgehensweise
- 2. Theoretische Grundlagen zum interkulturellen Lernen
- 2.1 Gegenstand
- 2.2 Interkulturelle Kompetenz
- 2.2.1 Ein Überblick theoretischer Modelle
- 2.2.1.1 Das Modell nach Hampden-Turner & Trompenaars
- 2.2.1.2 Das Modell nach Hofstede
- 2.2.1.3 Das Modell der Kulturstandardforschung
- 2.2.2 Kritische Anmerkungen
- 2.2.1 Ein Überblick theoretischer Modelle
- 2.3 Interkulturelles Lernen
- 2.4 Zeitliche Dimensionen der Auseinandersetzung mit neuen Kulturen
- 3. Kulturelle Unterschiede im Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich
- 3.1 Stereotype und Vorurteile
- 3.2 Bildungssysteme hinsichtlich der Ausbildung von Führungskräften
- 3.3 Die Rolle des Staates in der Wirtschaft
- 3.4 Deutsch-französische Kulturstandards
- 3.4.1 Macht und Einflusswege: externale vs. internale Autorität
- 3.4.2 Entscheidungsprozesse: Dissens vs. Konsens
- 3.4.3 Kommunikationsstile
- 3.4.3.1 Implizite, indirekte Botschaften vs. explizite, direkte Botschaften
- 3.4.3.2 Informeller Diskurs vs. formeller Diskurs
- 3.4.4 Personenorientierung vs. Sachorientierung
- 3.4.5 Zeitmanagement: Simultanität vs. Konsekutivität
- 3.5 Zusammenfassung/Ausblick
- 4. Interkulturelles Training am Beispiel Frankreichs
- 4.1 Notwendigkeiten eines interkulturellen Trainings
- 4.2 Didaktik
- 4.3 Begrifflichkeit und Trainingszeitpunkt
- 4.4 Trainingsteilnehmer
- 4.5 Trainer
- 4.6 Trainingsziele
- 4.6.1 Affektive, kognitive und verhaltensorientierte Ziele
- 4.7 Trainingstechniken
- 4.7.1 Der Culture-specific Assimilator
- 4.7.2 Critical Incidents Exercise
- 4.7.3 Die ,,Markhall“ - Simulation
- 4.8 Trainingsinhalte
- 4.8.1 Modellhafter Ablauf eines deutsch-französischen Trainings
- 5. Schlussfolgerungen und Perspektiven
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Thema des interkulturellen Trainings anhand des Beispiels Frankreichs. Der Fokus liegt auf der Analyse kultureller Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich und deren Bedeutung für die Gestaltung von effektiven interkulturellen Trainingsmaßnahmen.
- Analyse von theoretischen Modellen und Konzepten der interkulturellen Kompetenz
- Vergleich von kulturellen Merkmalen und Werten in Deutschland und Frankreich
- Entwicklung eines Modells für ein interkulturelles Training im deutsch-französischen Kontext
- Diskussion von Trainingstechniken und -inhalten, die die effektive Übertragung von interkultureller Kompetenz fördern
- Bewertung der Relevanz und Bedeutung von interkulturellem Training für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Problemstellung dar, die sich aus dem wachsenden Bedarf an interkulturellen Kompetenzen in der globalisierten Welt ergibt. Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen Beitrag zum Verständnis und zur Gestaltung von effektiven interkulturellen Trainingsmaßnahmen zu leisten. Die Vorgehensweise wird erläutert, wobei die Schwerpunkte auf der Analyse kultureller Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich und der Entwicklung eines Modells für ein interkulturelles Training liegen.
Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen des interkulturellen Lernens und untersucht verschiedene Modelle zur Erfassung und Beschreibung von Kulturstandards. Dabei werden wichtige Begriffe wie interkulturelle Kompetenz, Kulturstandards und interkulturelles Lernen definiert und diskutiert.
Kapitel 3 analysiert die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich, wobei insbesondere die Bildungssysteme, die Rolle des Staates in der Wirtschaft und die jeweiligen Kulturstandards im Vordergrund stehen.
Kapitel 4 widmet sich der Gestaltung eines interkulturellen Trainings am Beispiel Frankreichs. Es werden die Notwendigkeiten und didaktischen Prinzipien für die Gestaltung eines solchen Trainings behandelt. Zudem werden verschiedene Trainingstechniken, wie der Culture-specific Assimilator und die Critical Incidents Exercise, vorgestellt und in Bezug auf ihre Anwendbarkeit in einem deutsch-französischen Training diskutiert. Abschließend wird ein Modellhafter Ablauf eines deutsch-französischen Trainings vorgestellt.
Schlüsselwörter
Interkulturelles Training, Frankreich, Deutschland, Kulturstandards, interkulturelle Kompetenz, interkulturelles Lernen, Kulturvergleich, Trainingstechniken, Trainingsinhalte, interkulturelle Kommunikation, Management, Führungskräfte, Globalisierung.
- Quote paper
- Jens Dreischmeier (Author), 2005, Interkulturelles Training, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37691