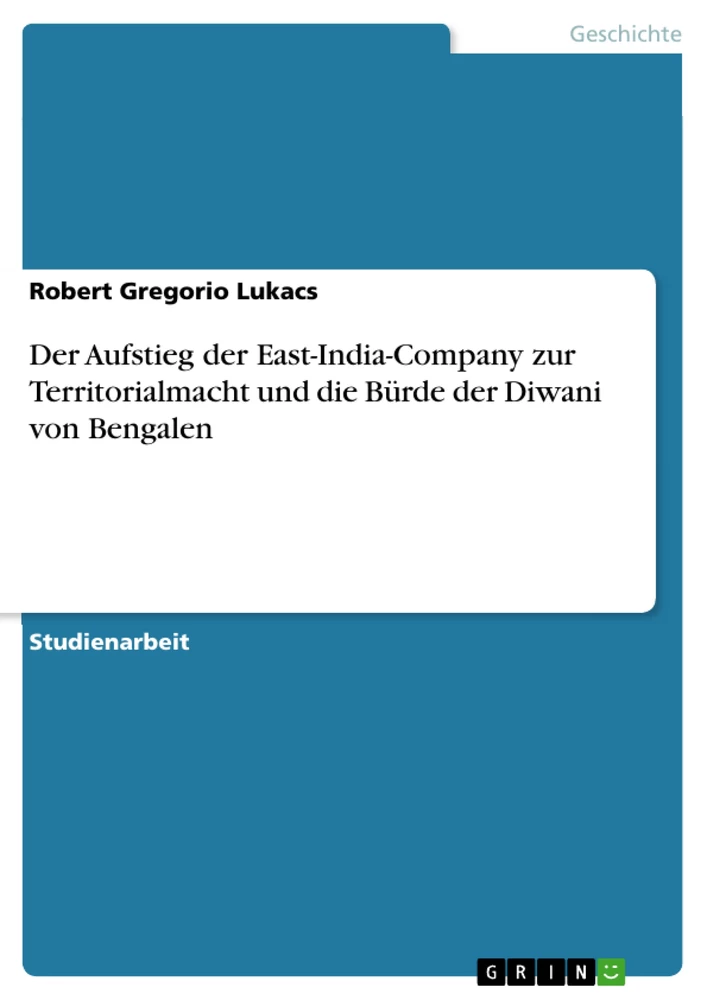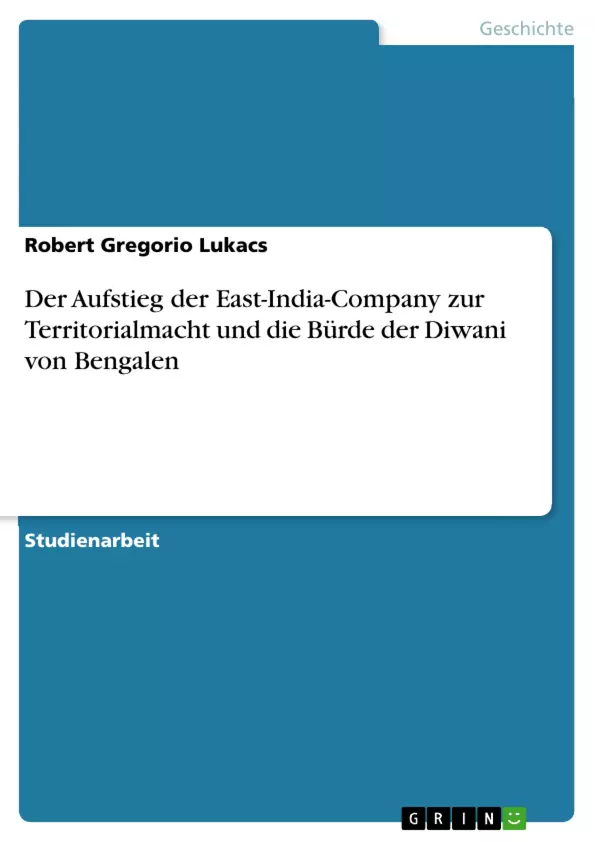Indien bildete einen Machtfaktor während der Ära des europäischen Kolonialismus. Wer Indien beherrschte, regierte über ein Fünftel der damaligen Weltbevölkerung. Nicht nur die menschlichen Ressourcen in Form von gewaltigen Armeen und Bauern standen zur Verfügung. Das Eldorado fanden die Briten nicht in Form von verborgenem Gold in den Dschungeln von Südamerika, sondern in Indien mit seinen riesigen Mengen an Menschen und Land, das den solange herbeigesehnten finanziellen und steuerlichen Segen bringen würde. Die Grossmächte rissen sich um dieses Potenzial.
Die Portugiesen waren die ersten, die Handelsschiffe zur Neuentdeckung von Land und zu Gründungen von Kolonien rüsteten. Die Spanier wollten kürzere Handelsrouten nach Indien finden und entdeckten durch Zufall Amerika. Die Holländer verwalteten bereits dutzende von befestigten Anlagen in Indien und die Franzosen hatten sich durch geschickte Politik grossen Einfluss in Indien erarbeitet. Den unbedeutenden Briten der East India Company schenkte man keine Beachtung.
Welche Umstände ermöglichten der englischen East-India-Company aber ab Mitte des 18. Jahrhunderts de facto eine Alleinherrschaft auf dem indischen Subkontinent zu etablieren? Wie konnten sie sich als Aussenseiter gegen die mächtigeren portugiesischen, holländischen und französischen Indien-Gesellschaften behaupten? Welche historischen Prozesse führten schliesslich dazu, dass die Company zur indischen Territorialmacht aufstieg?
Wie wirkte die duale Funktion eines profitorientierten Handelsunternehmens und eines expansiven militärischen Verwaltungsapparates auf die Struktur der Company aus und wie prägte die Bürde der Diwani den späteren Verlauf der Company?
Ich habe meine Arbeit in drei Teile geteilt. Im ersten Teil gehe ich auf die Geschichte des Mogulreiches ein und wie es zerfiel. Im zweiten Teil gehe ich auf die Handelsaktivitäten der East India Company ein, wie sie sich gegen die mächtigen Handelsrivalen hatte durchsetzen können und wie sie den Aufstieg zur Territorialmacht gemeistert hatte. Im dritten Teil untersuche ich, welche Auswirkungen der Aufstieg zur Territorialmacht auf die Company und seine Umgebung zur Folge hatte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Indien, ein Land fremder Invasoren
- Indien, der Tumultplatz europäischer Kolonialmächte
- Die Briten als Aussenseiter in Indien...
- Der Krieg mit den Franzosen
- Britische Herrschaft in Indien
- Der Machtzuwachs der East India Company
- Wirtschaftliche Veränderungen in Bengalen
- Die Militarisierung der Company
- Warren Hastings..
- Eine überforderte Handelsgesellschaft..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der britischen Herrschaft in Indien im 18. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Umstände, die es der East India Company ermöglichten, sich von einem unbedeutenden Handelsunternehmen zu einer dominierenden Territorialmacht zu entwickeln.
- Der Zerfall des Mogulreichs
- Die Rolle der East India Company im indischen Handel
- Der Aufstieg der Briten zur Territorialmacht
- Die Auswirkungen der britischen Herrschaft auf Indien
- Die duale Funktion der East India Company als Handelsunternehmen und militärischer Verwaltungsapparat
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Zerfall des Mogulreichs, der durch interne Machtkämpfe und externe Invasionen beschleunigt wurde. Das zweite Kapitel fokussiert auf die Handelsaktivitäten der East India Company und ihre Konkurrenz mit anderen europäischen Handelsgesellschaften, wie den Holländern und Franzosen. Dieses Kapitel beleuchtet auch, wie die Company durch geschickte Diplomatie und militärische Stärke ihre Machtposition in Indien festigte.
Schlüsselwörter
Mogulreich, East India Company, Britische Herrschaft, Kolonialismus, Handel, Militär, Territorialmacht, Indien, Bengalen, Französische Compagnie Perpetuelle des Indes, Vereinigte Oostindische Compagnie.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde die East India Company zur Territorialmacht?
Durch den Zerfall des Mogulreichs, geschickte Diplomatie und militärische Siege gegen europäische Rivalen wie Frankreich konnte die Company die Herrschaft über Indien festigen.
Was war die „Bürde der Diwani“?
Die Diwani verlieh der Company das Recht zur Steuererhebung in Bengalen. Dies brachte finanziellen Segen, überforderte aber die Strukturen der reinen Handelsgesellschaft.
Warum konnten sich die Briten gegen mächtigere Rivalen durchsetzen?
Die Briten nutzten interne indische Machtkämpfe aus und bauten eine gewaltige Armee aus einheimischen Bauern und Soldaten auf, um ihre Handelsinteressen militärisch zu sichern.
Welche Rolle spielte Warren Hastings?
Als Generalgouverneur versuchte er, die überforderte Handelsgesellschaft in einen stabilen Verwaltungsapparat umzuwandeln und die britische Macht in Indien zu zentralisieren.
Wie veränderte die Company die Wirtschaft in Bengalen?
Die Umstellung auf profitorientierte Verwaltung und massive Steuererhebung führte zu tiefgreifenden wirtschaftlichen Veränderungen und oft zur Ausbeutung der lokalen Bevölkerung.
- Quote paper
- Student Robert Gregorio Lukacs (Author), 2016, Der Aufstieg der East-India-Company zur Territorialmacht und die Bürde der Diwani von Bengalen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377068