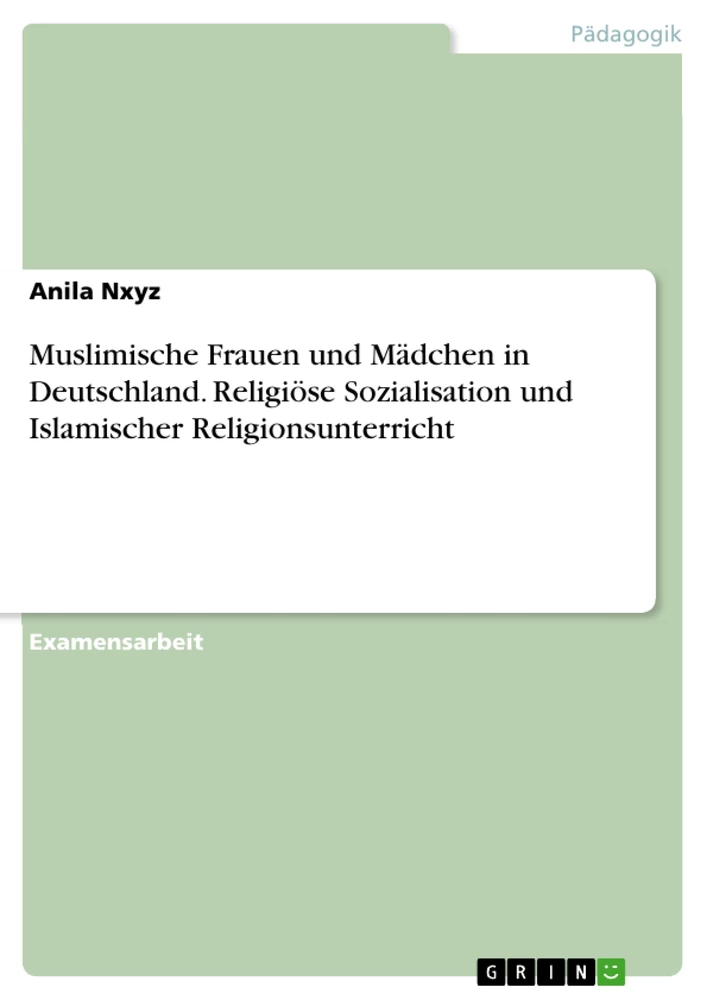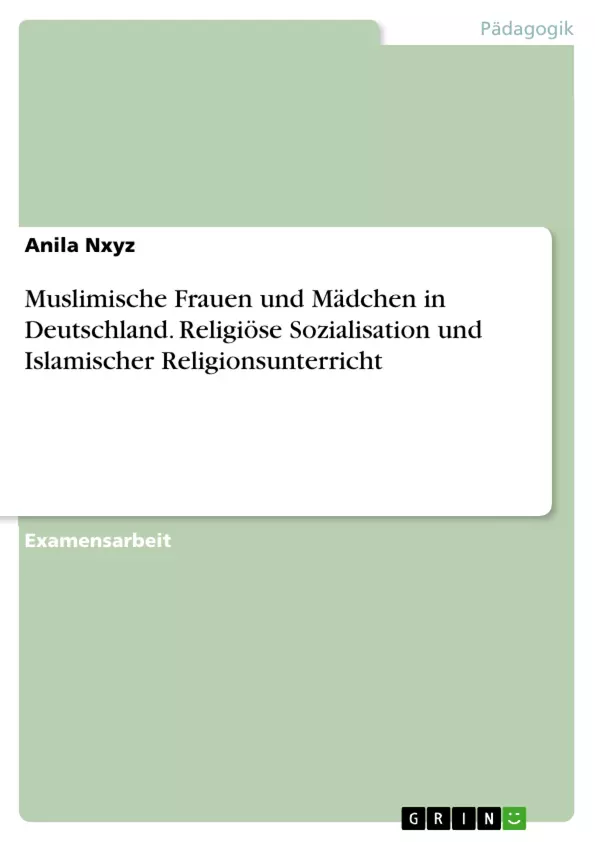Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der religiösen Sozialisation muslimischer Frauen und Mädchen in Deutschland. Sie nimmt dabei vor allem Chancen und Möglichkeiten eines Islamischen Religionsunterrichts an Schulen in den Blick. Insbesondere Musliminnen begegnen sehr häufig dem Vorurteil der Bevormundung und Unterdrückung durch ihre Brüder oder Väter. Aus diesem Grund soll die Arbeit sich im Spezifischen auf den weiblichen Anteil der jungen Muslime in Deutschland konzentrieren, um aufzuzeigen, inwiefern dieses Vorurteil gerechtfertigt ist.
Da häufig angenommen wird, dass es „einen Islam“ gibt, den alle Glaubensanhänger als verbindlich ansehen, muss zunächst überprüft werden, ob diese Annahme der Realität entspricht. Aus diesem Grund wird multidimensional betrachtet, wo die Ursprünge des deutschen Islam liegen und welche Aspekte bei der Heterogenität des Islam in Deutschland zu berücksichtigen sind. Dazu werden auch unterschiedliche muslimische Organisationen und Moscheegemeinden betrachtet, um die Vielfalt des Islam in Deutschland zu verdeutlichen.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Leben von muslimischen Frauen und Mädchen in Deutschland. Da die meisten Muslime in Deutschland einen Migrationshintergrund haben, spielt hierbei die Familie als erste Sozialisationsinstanz eine wichtige Rolle. Neben der Familie wird sich auf die Moscheegemeinden bezogen, die bei der religiösen Erziehung mitwirken, indem sie durch verschiedene Unterrichtsangebote religiöse Inhalte lehren.
Um der privaten Sozialisation eine institutionalisierte Art der religiösen Sozialisation gegenüber zu stellen, wird das Unterrichtsfach Islamische Religion vorgestellt. Zwar wird in Hessen der bekenntnisorientierte Islamische Religionsunterricht angeboten, jedoch zeigen Modelle aus anderen Bundesländern, dass muslimische Schüler auch durch offene Religionsunterrichtsmethoden in das Schulfach integriert werden können.
Spätestens nach dem 11. September 2001 steht der Islam mehr denn je im Fokus der medialen, sozialen und politischen Öffentlichkeit. Zu Unrecht wird mit dem Begriff „Islam“ häufig Gewalt, Terror und Unterdrückung assoziiert, wodurch es insbesondere heutzutage von grundlegender Notwendigkeit ist, sich mit den Inhalten der Religion auseinander zu setzen und zu analysieren, wie der Islam in der deutschen Gesellschaft repräsentiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Islam in Deutschland
- 2.1. Herkunftsländer und Migrationsgeschichte
- 2.2. Die heutige Situation der Muslime in Deutschland
- 3. Religiöse Sozialisation
- 3.1. Was bedeutet religiöse Sozialisation?
- 3.2. Die Familie als Sozialisationsinstanz
- 3.3. Die Moscheegemeinde als Sozialisationsinstanz
- 3.4. Der Islamische Religionsunterricht
- 4. Islamischer Religionsunterricht in Hessen
- 4.1. Die Entwicklung des Islamischen Religionsunterrichts
- 4.2. Das Modell des bekenntnisorientierten Islamischen Religionsunterrichts in Hessen
- 4.3. Die Lehrpläne des Islamischen Religionsunterrichts in Hessen
- 4.4. Chancen und Grenzen des Islamischen Religionsunterrichts
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Handlungsspielräume des Islamischen Religionsunterrichts bei der religiösen Sozialisation muslimischer Frauen und Mädchen in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit der Islamische Religionsunterricht dazu beitragen kann, ein realistisches Bild des Islam zu vermitteln und dem Vorurteil der Unterdrückung von Frauen entgegenzuwirken.
- Die Geschichte und Entwicklung des Islam in Deutschland
- Die heterogene Zusammensetzung der Muslime in Deutschland
- Die Rolle der Familie und der Moscheegemeinden bei der religiösen Sozialisation
- Die Bedeutung des Islamischen Religionsunterrichts als institutionalisierte Form der religiösen Sozialisation
- Die Chancen und Grenzen des Islamischen Religionsunterrichts in Hessen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung Die Einleitung führt in die Thematik der religiösen Sozialisation muslimischer Frauen und Mädchen in Deutschland ein und stellt die Relevanz des Themas in Bezug auf den medialen und gesellschaftlichen Diskurs über den Islam dar. Darüber hinaus werden die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vorgestellt.
Kapitel 2: Islam in Deutschland In diesem Kapitel wird die Geschichte des Islam in Deutschland beleuchtet, die Heterogenität der Muslime in Deutschland anhand ihrer Herkunftsländer und Migrationsgeschichten beschrieben und die heutige Situation der in Deutschland lebenden Muslime aufgezeigt.
Kapitel 3: Religiöse Sozialisation Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der religiösen Sozialisation im Allgemeinen und untersucht die Rolle der Familie und der Moscheegemeinden als zentrale Sozialisationsinstanzen für junge Muslime in Deutschland. Des Weiteren werden verschiedene Ansätze der religiösen Sozialisation und deren Bedeutung für die Entwicklung des muslimischen Selbstverständnisses betrachtet.
Kapitel 4: Islamischer Religionsunterricht in Hessen Das Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Islamischen Religionsunterrichts in Deutschland und fokussiert insbesondere auf die Situation in Hessen. Es wird die Geschichte des Fachs, die verschiedenen Modelle des Islamischen Religionsunterrichts und die Inhalte der Lehrpläne in Hessen analysiert. Darüber hinaus werden die Chancen und Grenzen des Islamischen Religionsunterrichts im Hinblick auf die religiöse Sozialisation junger Muslime diskutiert.
Kapitel 5: Fazit Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bewertet die Handlungsspielräume des Islamischen Religionsunterrichts bei der religiösen Sozialisation muslimischer Frauen und Mädchen in Deutschland.
Schlüsselwörter
Religiöse Sozialisation, Islamischer Religionsunterricht, Muslime in Deutschland, Heterogenität, Frauenbild im Islam, Moscheegemeinden, Familie, Integration, Vorurteile.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die religiöse Sozialisation für Musliminnen?
Sie prägt das Selbstverständnis muslimischer Frauen und Mädchen und findet primär in der Familie, Moscheegemeinden und zunehmend im staatlichen Religionsunterricht statt.
Gibt es 'den einen Islam' in Deutschland?
Nein, der Islam in Deutschland ist äußerst heterogen, geprägt durch unterschiedliche Herkunftsländer, Migrationsgeschichten und verschiedene Moscheegemeinden.
Was sind die Ziele des Islamischen Religionsunterrichts (IRU)?
Der IRU soll eine institutionalisierte Form der religiösen Bildung bieten, Vorurteile abbauen und die Integration muslimischer Schüler fördern.
Wie ist der Islamische Religionsunterricht in Hessen organisiert?
In Hessen wird ein bekenntnisorientierter Unterricht angeboten, der auf staatlich genehmigten Lehrplänen basiert und in Kooperation mit muslimischen Verbänden steht.
Kann der Religionsunterricht Frauenunterdrückung entgegenwirken?
Die Arbeit untersucht, inwieweit der IRU Handlungsspielräume eröffnet, um ein differenziertes Frauenbild zu vermitteln und patriarchale Strukturen kritisch zu hinterfragen.
- Citar trabajo
- Anila Nxyz (Autor), 2015, Muslimische Frauen und Mädchen in Deutschland. Religiöse Sozialisation und Islamischer Religionsunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377084