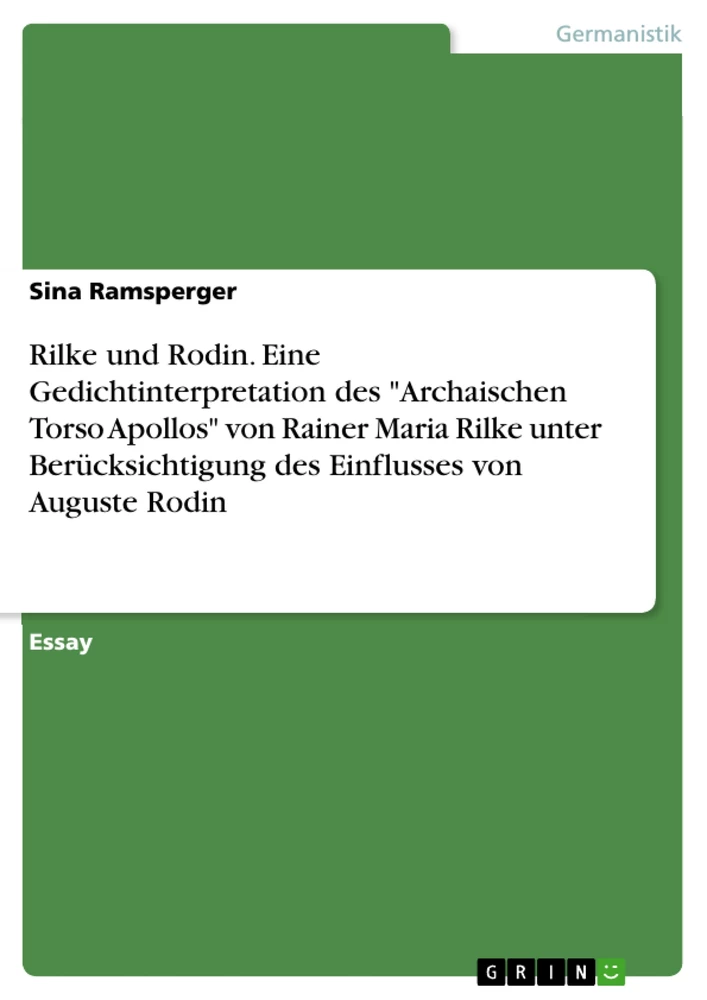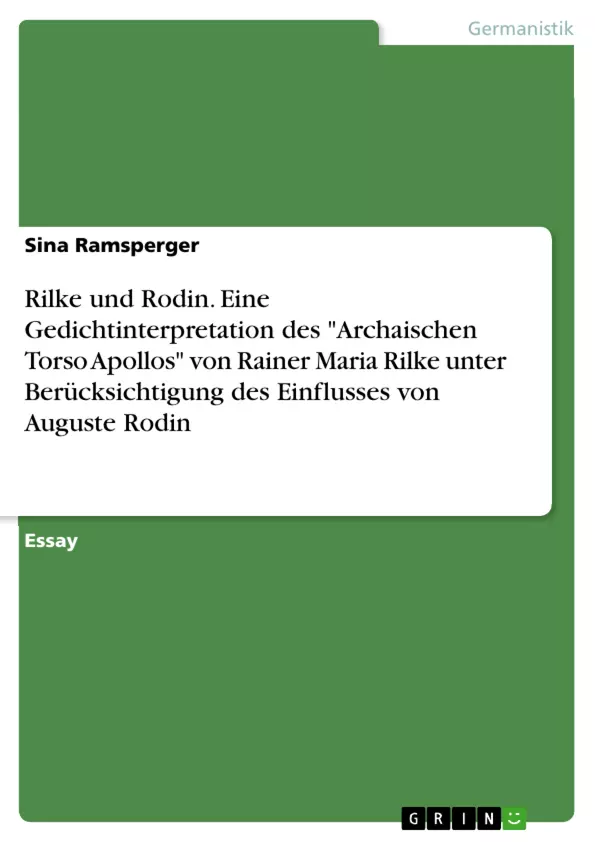Im Rahmen dieses Essays soll das Sonett "Archaischer Torso Apollos" Rilkes interpretiert werden, unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses des französischen Bildhauers Auguste Rodin.
"A mon grand Ami Auguste Rodin" – betrachtet man diese Widmung, die der Sammlung von Rilkes "Neuen Gedichten" vorausgeht, so ist man geneigt, Ralph Freedman zuzustimmen, wenn er von einer "Rodin-Besessenheit" Rilkes spricht. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit dem gewählten Gedicht soll dann daher auch hier in einem zweiten Schritt ein Abgleich mit Rodinschen Gedankenmodellen und eine Interpretation hinsichtlich der zwei Künstler gewagt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Gedichtinterpretation: „Archaischer Torso Apollos“ unter Berücksichtigung des Einflusses von Auguste Rodin
- Die Einheit von lyrischem Ich und Leser
- Der Torso als Kandelaber und die glänzende Erkenntnis
- Das fehlende Haupt und die Bedeutung des "Bug der Brust"
- Die Zeugung und die metonymische Darstellung des Phallus
- Der Vergleich mit einem "entstellten Stein" und die Einheit von Apollon und Dionysos
- Der brechende Stern und das Überwinden von Beschränkungen
- Der Appell an den Leser und die Torso-Gestalt des Lebens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Sonett „Archaischer Torso Apollos“ von Rainer Maria Rilke wird interpretiert, wobei der Einfluss des französischen Bildhauers Auguste Rodin besonders berücksichtigt wird.
- Die Interaktion von lyrischem Ich und Leser
- Die Rolle von Imagination und Interpretation in der Kunst
- Die Verbindung von apollinischer Ordnung und dionysischer Rauschhaftigkeit
- Das Fragmentarische und die Unvollständigkeit der Existenz
- Der Appell an den Leser zur Veränderung des Lebens
Zusammenfassung der Kapitel
- Die erste Strophe etabliert eine gemeinsame Unkenntnis des lyrischen Ichs und des Lesers, die durch die Verwendung des Präteritums "kannten" (V. 1) hervorgehoben wird. Die Metapher der "reifen Augenäpfel" (V. 2) betont die Sinnlichkeit der Wahrnehmung. Der Vergleich des Torsos mit einem Kandelaber (V. 3) stellt den Torso ins Zentrum der Erkenntnis, die aus der Dunkelheit der Unkenntnis entsteht.
- Die zweite Strophe präsentiert weitere irritierende Metaphern, wie den "Bug der Brust" (V. 5). Durch die Kombination mit dem "könnte" (V. 5) entsteht eine dynamische Imaginationskraft, die die Poesie über die Kunst stellt. Rilke lenkt den Blick auf das Wesentliche: die Lenden und die "Zeugung" (V. 8). Die ungewöhnliche Klangstruktur von "Blenden" und "Lenden" verstärkt die Aufmerksamkeit auf diese Stelle.
- Im ersten Terzett wird Apollon mit einem "entstellten Stein" (V. 9) verglichen. Diese Vorstellung wird durch die Begriffe "Raubtierfelle" (V. 11) und die Verbindung zu Dionysos verstärkt. Die antagonistischen Charaktereigenschaften von Apollon und Dionysos werden im Sonett eingesetzt, um eine umfassende Sichtweise der Wirklichkeit zu ermöglichen.
- Das zweite Terzett nimmt Bezug auf den Anfang des Gedichts und verwendet Begriffe des Wortfeldes "leuchten". Der Vergleich mit einem "brechenden Stern" (V. 13) unterstreicht die fragmentarische Gestalt des Torsos und das Überwinden von Beschränkungen. Die metrische Abweichung vom Sonett-Schema (V. 6-7) verstärkt diese Idee formal.
Schlüsselwörter
Gedichtinterpretation, Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Archaischer Torso Apollos, Sonett, Metapher, Imagination, Interpretation, Apollon, Dionysos, Fragmentarität, Unvollständigkeit, Leben, Veränderung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Auguste Rodin das Werk von Rainer Maria Rilke?
Rodins Fokus auf das Handwerkliche und das „Dingliche“ der Skulptur prägte Rilkes Konzept der „Dinggedichte“, bei denen Kunstwerke sprachlich objektiviert werden.
Was ist die Kernaussage von „Archaischer Torso Apollos“?
Das Gedicht beschreibt die überwältigende Präsenz eines fragmentarischen Kunstwerks, das den Betrachter zur radikalen Lebensänderung auffordert („Du mußt dein Leben ändern“).
Warum ist der Torso bei Rilke „archaisch“?
Der Begriff bezieht sich auf die griechische Antike, symbolisiert aber auch eine zeitlose, urwüchsige Kraft, die trotz der Zerstörung des Kopfes aus dem Körper leuchtet.
Welche Rolle spielen Apollon und Dionysos im Gedicht?
Rilke verbindet die apollinische Formstrenge der Skulptur mit dionysischer Rauschhaftigkeit und Vitalität, die durch Metaphern wie „Raubtierfelle“ angedeutet wird.
Was bedeutet die Metapher vom „brechenden Stern“?
Sie verdeutlicht, dass die Ausstrahlung des Torsos so stark ist, dass sie die Grenzen des Steins sprengt und den gesamten Raum sowie den Betrachter erfüllt.
- Quote paper
- Sina Ramsperger (Author), 2017, Rilke und Rodin. Eine Gedichtinterpretation des "Archaischen Torso Apollos" von Rainer Maria Rilke unter Berücksichtigung des Einflusses von Auguste Rodin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377101