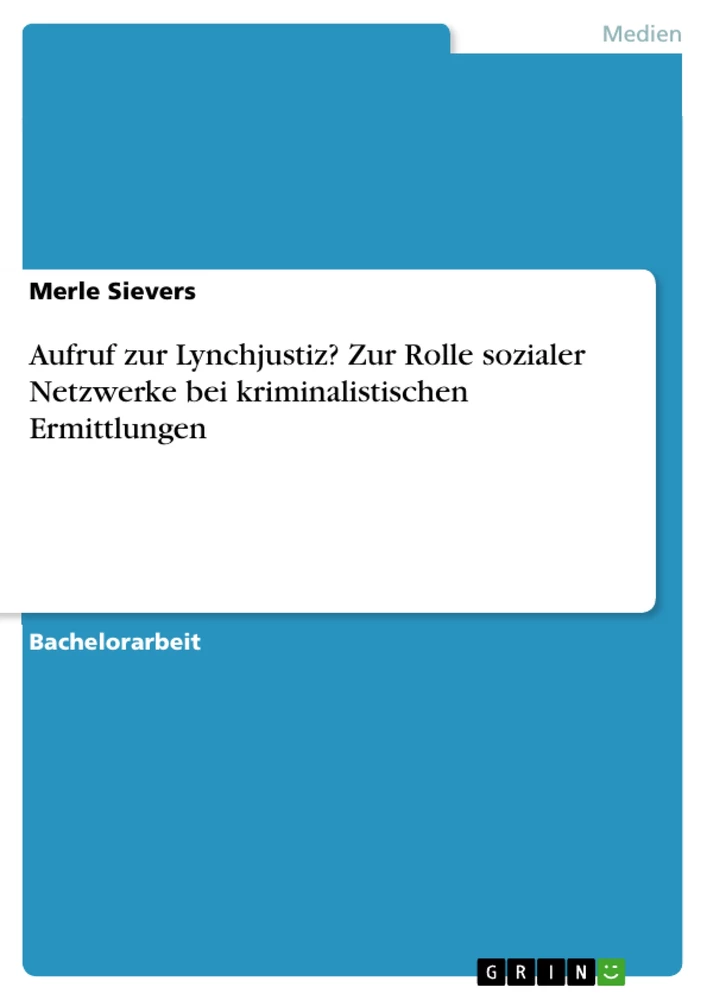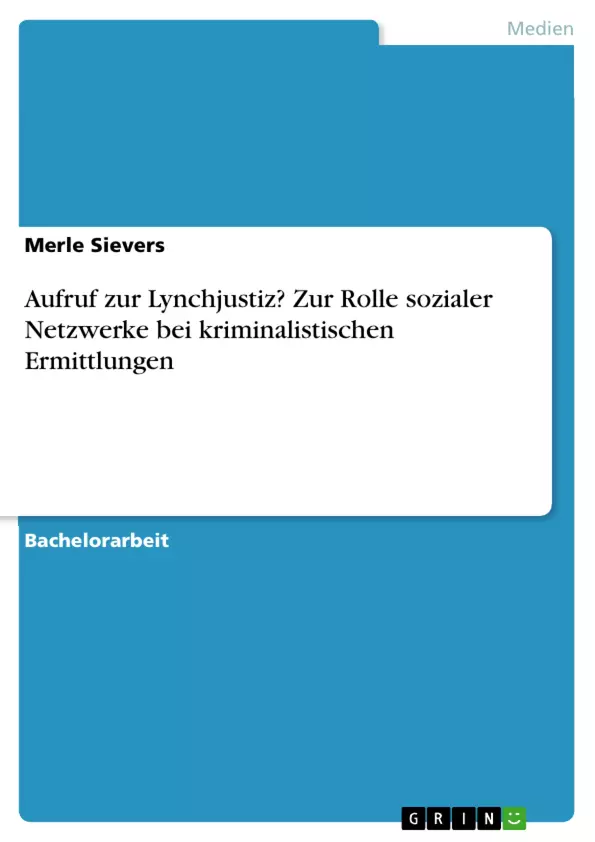Soziale Netzwerke spielen heutzutage eine immer größere Rolle im Leben vieler Menschen. Auch die Polizei nutzt soziale Netzwerke, insbesondere Facebook und Twitter, zunehmend für ihre eigenen Ermittlungen, da sich über diese eine breite Öffentlichkeit schnell erreichen lässt. Parallel dazu kam es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Aufrufen in sozialen Netzwerken, die zur Lynchjustiz gegen (vermeintliche) Straftäter aufforderten. In dieser Arbeit wird untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Phänomenen gibt und worin dieser gegebenenfalls besteht.
Nch einigen grundlegenden Definitionen wird dargelegt, wie die Polizei soziale Netzwerke derzeit für ihre Ermittlungsarbeit nutzt. Dabei werden die Vor- und Nachteile derartiger Fahndungsmethoden aufgezeigt. Des Weiteren wird die Entstehung von Gruppendynamik in sozialen Netzwerken erklärt, wodurch sich in manchen Fällen ein Mob formieren kann, der später zum Ausgangspunkt eines Lynchaufrufes wird.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Betrachtung des theoretischen Modells der drei Handlungskomponenten von Social-Web-Praktiken nach Jan Schmidt, das in seinen einzelnen Aspekten auf die Entstehung von Lynchaufrufen im Netz angewendet wird. Die Anwendung zeigt, dass soziale Netzwerke psychologisch und strukturell günstige Voraussetzungen für die Entstehung eines Lynchaufrufes aufweisen. Durch emotionale Distanz und gefühlte Anonymität, welche in sozialen Netzwerken leicht entstehen, sinkt zusätzlich die Hemmschwelle des Einzelnen, sich an einem Aufruf zur Lynchjustiz zu beteiligen. Der Rolle der Polizei im Entstehungsprozess von Lynchaufrufen bleibt unklar. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass sie mit ihrer Aktivität in sozialen Netzwerken einen indirekten Impuls gibt sowie den Nutzern eine Art Legitimation für die Aufrufe zur Lynchjustiz vermittelt. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse wird deutlich, dass sich das Verständnis des geltenden Rechtsprinzips in der Gesellschaft verschiebt. Die zunehmenden Aufrufe zur Lynchjustiz sind eine Folge davon.
Die Ergebnisse dieser Arbeit werden schrittweise anhand von zwei exemplarischen Fallbeispielen belegt: die Tätersuche der Polizei in Emden im Mordfall Lena (2012) und der FBI-Fahndung nach den Attentätern vom Boston-Marathon (2013). Abschließend wird kurz Ausblick darauf genommen, welche Gefahren sich aus den aufgezeigten Aspekten für den Rechtsstaat ergeben und was eventuell getan werden könnte, um diese einzudämmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begrifflichkeiten
- 2.1. Lynchjustiz
- 2.2. Rechtliche Grundlagen
- 2.3. Soziale Netzwerke
- 3. Fallbeispiele
- 3.1. Lena in Emden
- 3.2. Anschlag auf Boston-Marathon
- 4. Tätersuche der Polizei in sozialen Netzwerken
- 5. Gruppen in sozialen Netzwerken
- 6. Die Rolle von sozialen Netzwerken
- 6.1. Identitätsmanagement
- 6.2. Beziehungsmanagement
- 6.3. Informationsmanagement
- 6.4. Zusammenfassung
- 7. Anonymität schafft Distanz
- 8. Fazit
- 9. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen polizeilicher Aktivität in sozialen Netzwerken und Aufrufen zur Lynchjustiz. Ziel ist es, die Entstehung von Lynchaufrufen im Netz zu analysieren und die Rolle sozialer Netzwerke dabei zu beleuchten. Dabei werden gruppendynamische Prozesse und das theoretische Modell der drei Handlungskomponenten von Social-Web-Praktiken nach Jan Schmidt berücksichtigt.
- Polizistische Nutzung sozialer Netzwerke für Ermittlungen
- Entstehung von Lynchaufrufen in sozialen Netzwerken
- Gruppendynamik und Mobilisierung im Netz
- Rolle von Anonymität und emotionaler Distanz
- Anwendung des Modells der drei Handlungskomponenten von Social-Web-Praktiken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und beschreibt das Spannungsfeld zwischen polizeilicher Nutzung sozialer Netzwerke für Ermittlungen und dem Auftreten von Lynchaufrufen im Netz. Sie skizziert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf der Analyse von Begrifflichkeiten, der Darstellung polizeilicher Praxis, der Untersuchung gruppendynamischer Prozesse und der Anwendung eines theoretischen Modells basiert. Der Bezug auf ein Statement von Barack Obama nach dem Boston-Marathon-Attentat verdeutlicht die Brisanz des Themas.
2. Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Lynchjustiz und soziale Netzwerke, um Missverständnisse zu vermeiden und ein einheitliches Verständnis zu schaffen. Es wird die historische Entwicklung des Begriffs „Lynchjustiz“ erläutert und die rechtlichen Grundlagen werden angerissen. Der Fokus liegt auf der präzisen Definition der Begriffe im Kontext der Arbeit.
3. Fallbeispiele: Dieses Kapitel präsentiert zwei Fallbeispiele: die Tätersuche der Polizei in Emden im Mordfall Lena (2012) und die FBI-Fahndung nach den Attentätern vom Boston-Marathon (2013). Diese Beispiele dienen dazu, den praktischen Kontext der Arbeit zu veranschaulichen und die theoretischen Überlegungen anhand konkreter Situationen zu illustrieren. Die Analyse der Fallbeispiele soll die Dynamiken und Folgen von Online-Ermittlungen und den damit verbundenen Gefahren aufzeigen.
4. Tätersuche der Polizei in sozialen Netzwerken: Das Kapitel beschreibt die gegenwärtige Praxis der Polizei in Deutschland, soziale Netzwerke für Ermittlungszwecke zu nutzen. Es werden die Vor- und Nachteile dieser Vorgehensweise diskutiert, wobei sowohl die Effektivität als auch die potenziellen Risiken und ethischen Implikationen berücksichtigt werden. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Methoden und Strategien der Polizei im Umgang mit sozialen Netzwerken.
5. Gruppen in sozialen Netzwerken: Dieses Kapitel beleuchtet gruppendynamische Prozesse in sozialen Netzwerken, die zur Entstehung von Mobs und letztendlich zu Lynchaufrufen führen können. Es wird erklärt, wie sich Gruppen online bilden, wie sie funktionieren und welche Faktoren zu extremen Verhaltensweisen beitragen können. Die Analyse umfasst die Mechanismen der Meinungsbildung, der Eskalation und der sozialen Kontrolle in virtuellen Gemeinschaften.
6. Die Rolle von sozialen Netzwerken: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von sozialen Netzwerken anhand des theoretischen Modells der drei Handlungskomponenten (Identitäts-, Beziehungs-, und Informationsmanagement) nach Jan Schmidt. Es wird untersucht, wie diese Komponenten zur Entstehung von Lynchaufrufen beitragen. Die Kapitel 6.1, 6.2 und 6.3 bilden Teilanalysen der drei Komponenten und Kapitel 6.4 fasst die Ergebnisse zusammen. Die Analyse soll zeigen, wie die Struktur und die Funktionsweise sozialer Plattformen die Entstehung von Lynchaufrufen begünstigen können.
7. Anonymität schafft Distanz: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Anonymität und emotionaler Distanz auf die Beteiligung an Lynchaufrufen. Es wird beleuchtet, wie die vermeintliche Anonymität des Internets die Hemmschwelle senkt und zu einem riskanten Verhalten führt. Die psychologischen Aspekte der Online-Kommunikation und ihr Einfluss auf die moralische Bewertung von Handlungen werden hier thematisiert.
Schlüsselwörter
Lynchjustiz, soziale Netzwerke, Online-Ermittlungen, Gruppendynamik, Anonymität, Identitätsmanagement, Beziehungsmanagement, Informationsmanagement, Jan Schmidt, emotionale Distanz, Rechtsstaat, Fallbeispiele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Lynchaufrufen in sozialen Netzwerken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen polizeilicher Aktivität in sozialen Netzwerken und Aufrufen zur Lynchjustiz. Sie analysiert die Entstehung von Lynchaufrufen im Netz und beleuchtet die Rolle sozialer Netzwerke dabei, unter Berücksichtigung gruppendynamischer Prozesse und des Modells der drei Handlungskomponenten von Social-Web-Praktiken nach Jan Schmidt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung von Lynchaufrufen in sozialen Netzwerken zu analysieren und die Rolle sozialer Netzwerke dabei zu beleuchten. Die polizeiliche Nutzung sozialer Netzwerke für Ermittlungen, die Gruppendynamik und Mobilisierung im Netz, die Rolle von Anonymität und emotionaler Distanz sowie die Anwendung des Modells der drei Handlungskomponenten von Social-Web-Praktiken stehen im Fokus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt dar und beschreibt das Spannungsfeld zwischen polizeilicher Nutzung sozialer Netzwerke und Lynchaufrufen. Das Kapitel "Begrifflichkeiten" definiert zentrale Begriffe wie Lynchjustiz und soziale Netzwerke. "Fallbeispiele" präsentiert die Tätersuche der Polizei in Emden und die FBI-Fahndung nach den Boston-Marathon-Attentätern. "Tätersuche der Polizei in sozialen Netzwerken" beschreibt die polizeiliche Praxis in Deutschland. "Gruppen in sozialen Netzwerken" beleuchtet gruppendynamische Prozesse. "Die Rolle von sozialen Netzwerken" analysiert diese anhand des Modells der drei Handlungskomponenten nach Jan Schmidt. "Anonymität schafft Distanz" untersucht den Einfluss von Anonymität und emotionaler Distanz. Schließlich folgen Fazit und Ausblick.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselbegriffe sind Lynchjustiz, soziale Netzwerke, Online-Ermittlungen, Gruppendynamik, Anonymität, Identitätsmanagement, Beziehungsmanagement, Informationsmanagement, Jan Schmidt, emotionale Distanz, Rechtsstaat und Fallbeispiele.
Welche Fallbeispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei Fallbeispiele: die Tätersuche der Polizei in Emden im Mordfall Lena (2012) und die FBI-Fahndung nach den Attentätern vom Boston-Marathon (2013). Diese dienen der Veranschaulichung der theoretischen Überlegungen.
Welches theoretische Modell wird angewendet?
Die Arbeit wendet das Modell der drei Handlungskomponenten von Social-Web-Praktiken nach Jan Schmidt an, um die Rolle sozialer Netzwerke bei der Entstehung von Lynchaufrufen zu analysieren. Die drei Komponenten sind Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanagement.
Welche Rolle spielt Anonymität?
Die Arbeit untersucht, wie Anonymität und emotionale Distanz die Hemmschwelle zur Beteiligung an Lynchaufrufen senken und zu riskantem Verhalten führen. Die psychologischen Aspekte der Online-Kommunikation werden thematisiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Der FAQ-Eintrag zum Fazit muss aus dem Text extrahiert werden, da das Fazit selbst im bereitgestellten Text nicht explizit zusammengefasst ist. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet jedoch Hinweise darauf.)
- Citation du texte
- Merle Sievers (Auteur), 2014, Aufruf zur Lynchjustiz? Zur Rolle sozialer Netzwerke bei kriminalistischen Ermittlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377510