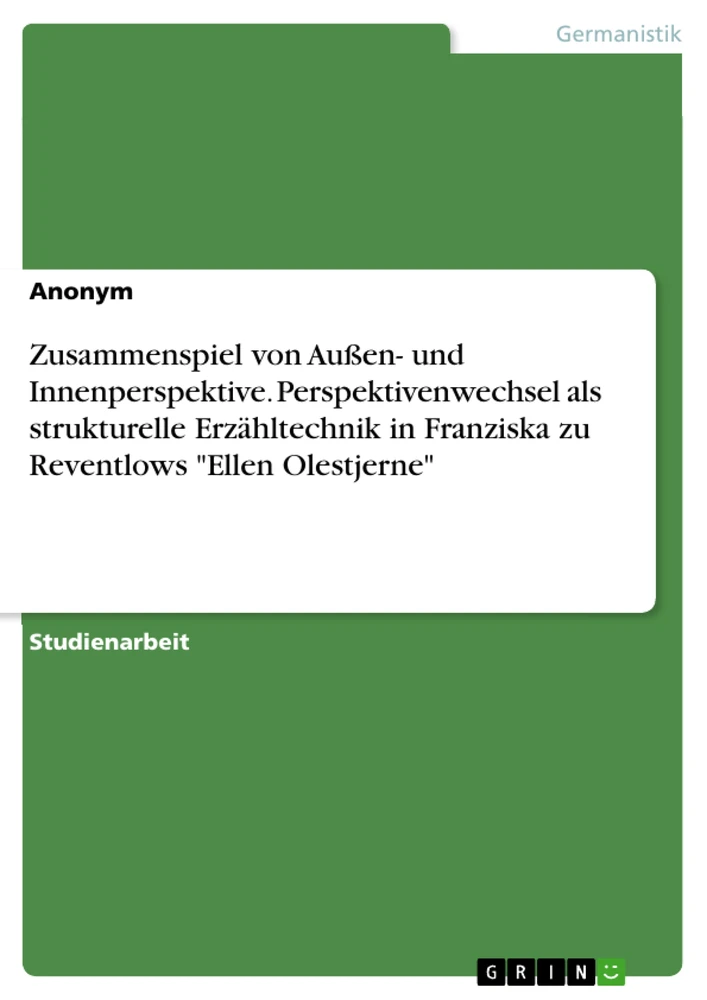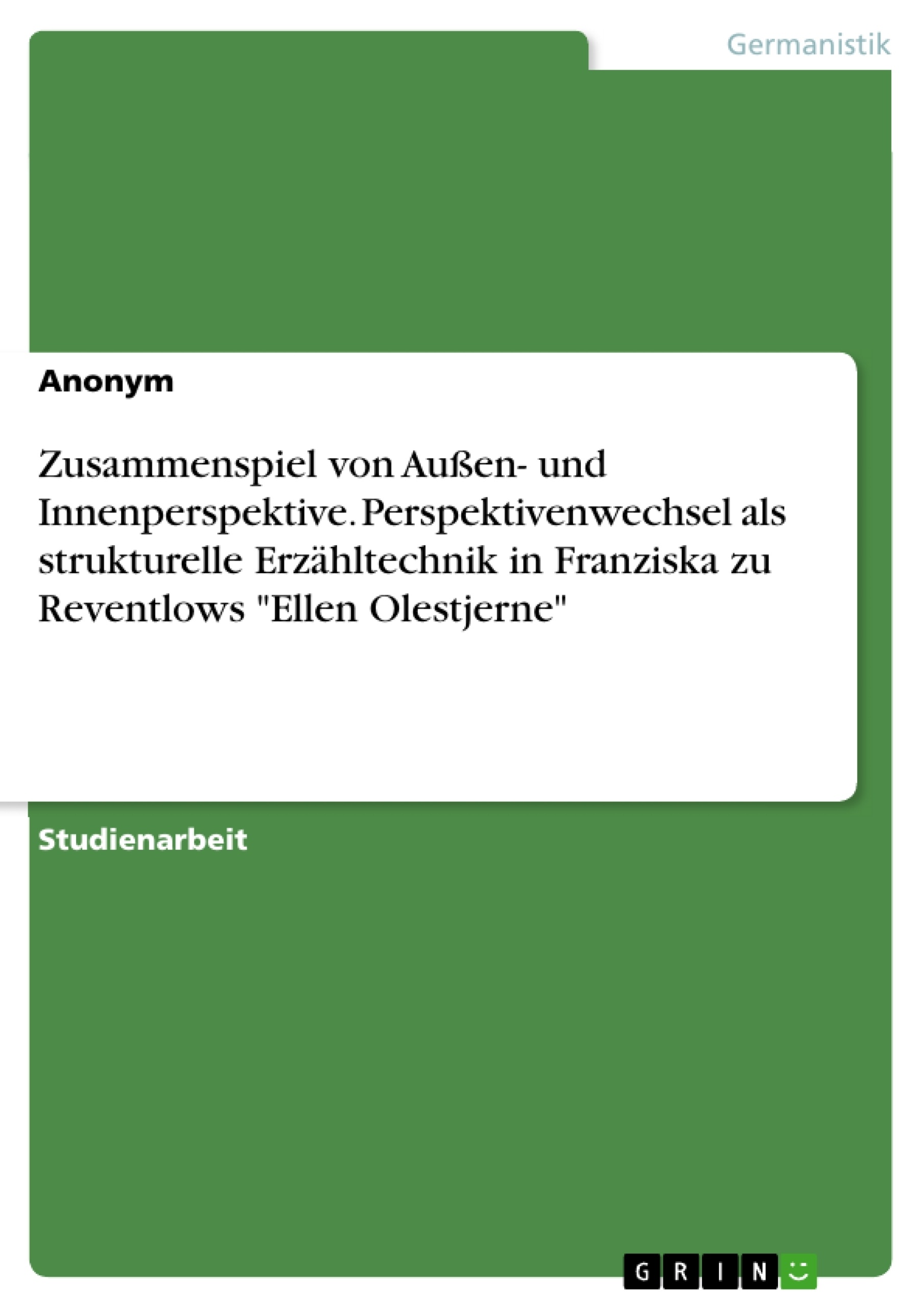Die Hausarbeit behandelt den Roman "Ellen Olestjerne" von Fanny zu Reventlow. Es handelt sich dabei um eine Lebensbeschreibung der Protagonistin Ellen.
Konkret befasst sich die Arbeit mit dem Perspektivenwechsel im Roman, in dem in unterschiedlicher Form Erzähler, Briefwechsel und Tagebucheinträge auftauchen. So entsteht ein ständiger Wechsel zwischen Außen- und Innenperspektive, wodurch dem Roman eine Struktur verliehen wird. Ziel der Untersuchung ist, es durch die unterschiedlichen Perspektiven eine Strukturierung des Werkes aufzuzeigen und die verschiedenen Erzähltechniken zu begründen.
Dementsprechend überprüft die Studie folgende Hypothese: Franziska zu Reventlow wechselt im Roman die Perspektive des Erzählens mit der Absicht dem Leser eine Struktur zu vermitteln, welche verschiedene Lebensabschnitte von Ellen besser beschreibt, um so die Figur und ihr Leben für den Leser nachvollziehbar zu gestalten und ihn emotional zu begleiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Brief- und Tagebuchromane von Franziska zu Reventlow
- Perspektivenwechsel und Struktur des Romans
- Erzähler
- Erster Romanteil
- Zweiter Romanteil
- Briefe
- Mädchenpension
- Friedl
- Lisa
- Tagebucheinträge
- Beginn der Zeit in München
- Schwangerschaft und Romanende
- Erzähler
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Perspektivenwechsel im Roman „Ellen Olestjerne“ von Franziska zu Reventlow, der 1903 erschienen ist. Im Fokus der Analyse steht, wie die Autorin durch unterschiedliche Perspektiven, darunter Erzähler, Briefwechsel und Tagebucheinträge, eine Struktur im Roman schafft und die Außen- und Innenperspektive der Protagonistin Ellen miteinander verknüpft. Die Untersuchung zielt darauf ab, diese verschiedenen Erzähltechniken zu analysieren und zu begründen, wie sie die Figur und ihr Leben für den Leser nachvollziehbar gestalten und ihn emotional begleiten.
- Der Perspektivenwechsel als strukturelle Erzähltechnik im Roman „Ellen Olestjerne“
- Die Wechselwirkung zwischen Außen- und Innenperspektive in der Darstellung von Ellens Leben
- Die Rolle von Briefen und Tagebucheinträgen als Mittel der Figurencharakterisierung
- Die Gestaltung der emotionalen Verbindung zwischen Leser und Protagonistin
- Die Bedeutung von narrativen Mittel im Roman für die Vermittlung von Struktur und Verständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Perspektivenwechsels in „Ellen Olestjerne“ ein und stellt die Forschungsfrage und die Hypothese der Untersuchung dar. Der zweite Abschnitt befasst sich mit der Verwendung von Brief- und Tagebuchromanen in Reventlows Werk und zeigt, dass die Anwendung dieser literarischen Gattungen keine Ausnahme in ihrem Gesamtwerk darstellt. Das dritte Kapitel analysiert die verschiedenen Perspektiven im Roman, darunter der auktoriale Erzähler, die erlebte Figurenrede und Tagebucheinträge. Im Fokus stehen dabei die unterschiedlichen Aspekte der Darstellung von Ellens Kindheit, Jugend und dem Einfluss ihrer Mutter auf ihre Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Perspektivenwechsel, Außen- und Innenperspektive, Erzähltechniken, Brief- und Tagebuchroman, Lebensbeschreibung, Charakterisierung, Emotionalität und Franziska zu Reventlows Roman „Ellen Olestjerne“.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Roman "Ellen Olestjerne"?
Der Roman von Franziska zu Reventlow (1903) ist eine Lebensbeschreibung der Protagonistin Ellen und thematisiert ihre Entwicklung von der Kindheit bis zur Mutterschaft.
Was ist die Besonderheit der Erzähltechnik in diesem Roman?
Reventlow nutzt einen ständigen Perspektivenwechsel zwischen auktorialem Erzähler, Briefen und Tagebucheinträgen, um Außen- und Innenansichten der Figur zu verknüpfen.
Warum werden Briefe und Tagebucheinträge verwendet?
Diese Mittel dienen dazu, die emotionalen Zustände und die persönliche Entwicklung Ellens für den Leser unmittelbar nachvollziehbar zu machen und dem Werk eine Struktur zu geben.
Welche Lebensabschnitte werden durch die Perspektiven strukturiert?
Die Briefe fokussieren oft auf die Zeit in der Mädchenpension und Beziehungen (z.B. Friedl, Lisa), während Tagebucheinträge besonders die Münchner Zeit und die Schwangerschaft beleuchten.
Ist der Roman autobiografisch geprägt?
Ja, "Ellen Olestjerne" gilt als stark autobiografisch gefärbtes Werk von Franziska zu Reventlow, in dem sie eigene Erfahrungen literarisch verarbeitet.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Zusammenspiel von Außen- und Innenperspektive. Perspektivenwechsel als strukturelle Erzähltechnik in Franziska zu Reventlows "Ellen Olestjerne", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377521