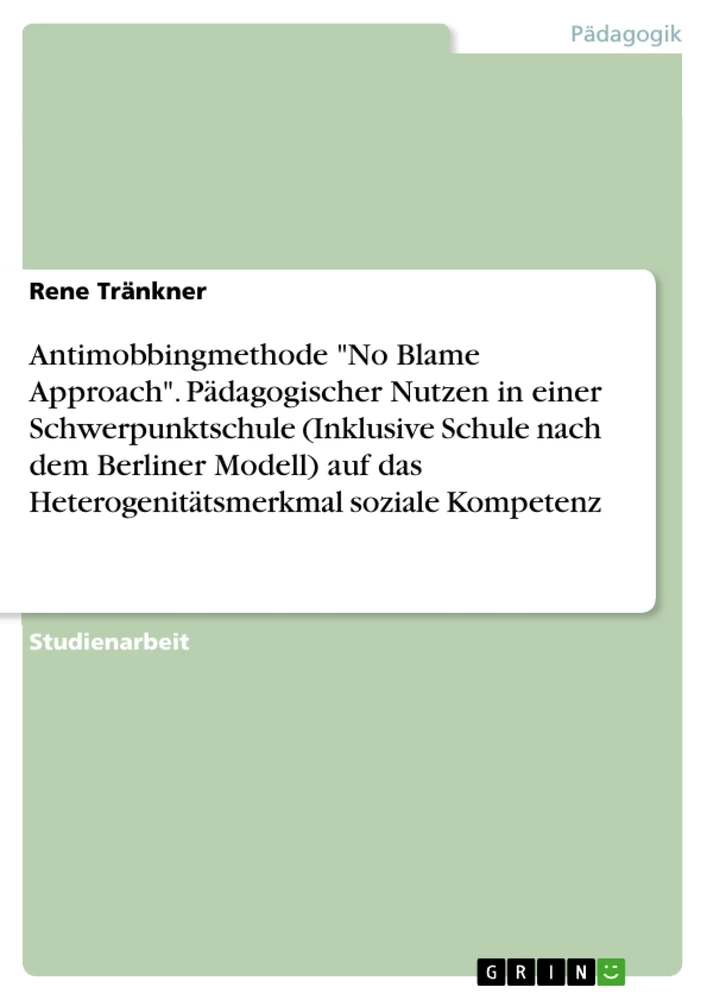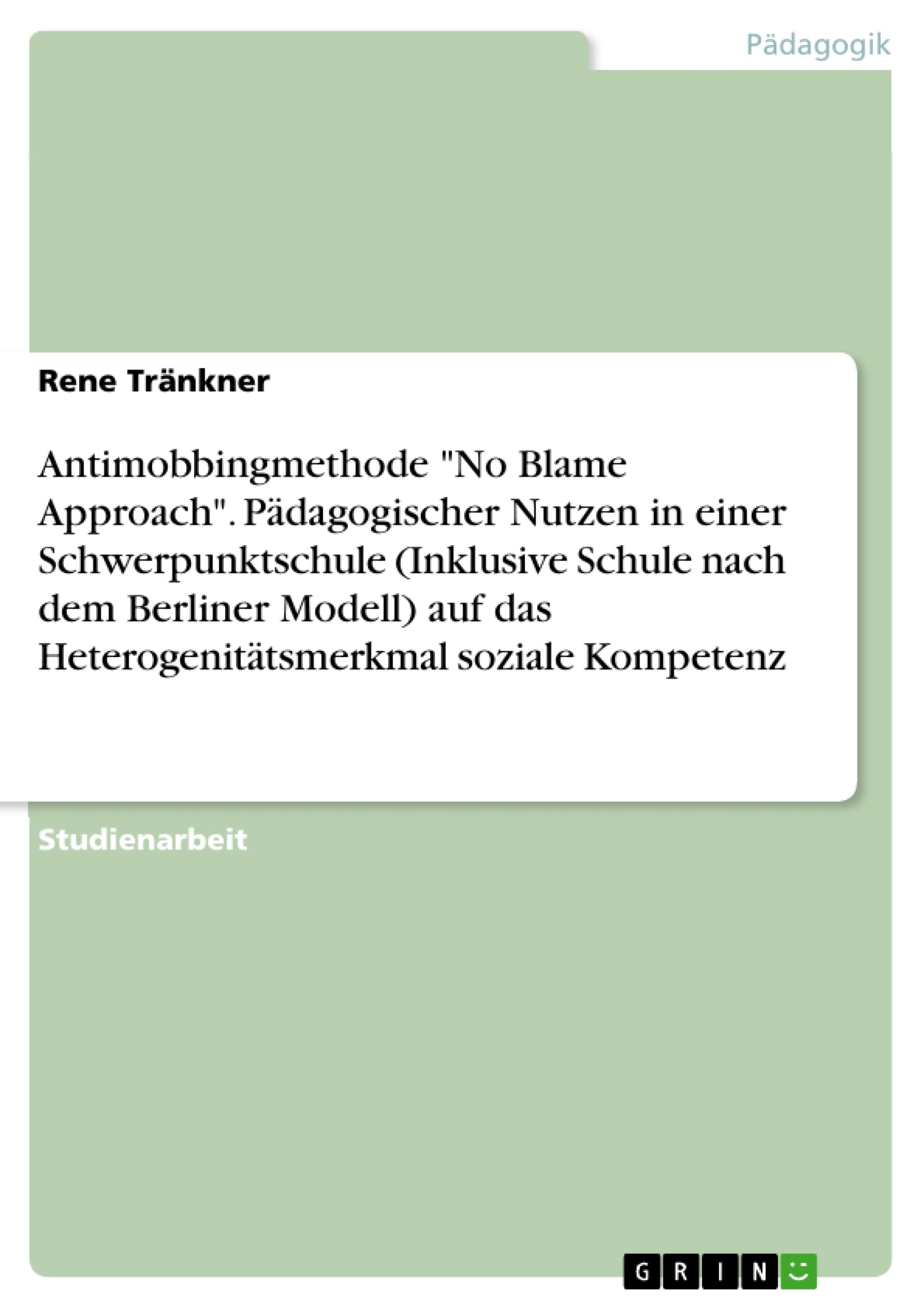Diese Hausarbeit des Moduls 3C Heterogenität in der Schule behandelt das Gewaltphänomen Mobbing in der Grundschule. Wie passt das Thema des Moduls zu diesem Phänomen? Auf der einen Seite besteht durch die Vielschichtigkeit der Unterschiede bei SchülerInnen eine große Chance, durch Toleranz und Austausch ein vielschichtiges Perspektivrepertoire zu erwerben. Auf der anderen Seite existieren auch gegenteilige Tendenzen durch SchülerInnen, die mit der vielseitigen Unterschiedlichkeit nicht umzugehen wissen. Das kann schon im Grundschulalter in Gewalt eskalieren. Eine Form der Gewalt ist das Mobbing. Kinder werden gezielt ausgesucht und erleiden permanente und zielgerichtete körperliche und psychische Angriffe. Das System der Schikane ist verdeckt aktiv, ist nicht offensichtlich und ist nicht wie ein offen ausgetragener Konflikt unter SchülerInnen auf dem Schulhof sichtbar. Gerade im Alter der Grundschulkinder kommt so etwas vor und darf es auch. Es liegt an der Erziehung und der Bildung, den Heranwachsenden einen zumutbaren Weg zu zeigen, diese Destruktivität in ihrem Wesen zu erkennen und durch Anleitung verinnerlicht zur Selbstreflexion zu überwinden. Die No Blame Approach Methode ist eine Methode, die gewaltfrei funktioniert. Sie beschuldigt keinen, sie involviert die TäterInnen in eine Unterstützergruppe, die gegen Mobbing vorgeht und die das Opfer im Fokus behält. Es geht darum, dem Opfer aus dem Mobbing zu befreien, sofort und in der Zukunft. Darüber hinaus zeigte es sich, dass eine pädagogische Wirksamkeit mit einer psychologischen einherging, so dass auch diese Sichtweise in die Arbeit aufgenommen wurde.
Zunächst wird unter Kapitel 2 die Vielseitigkeit der Heterogenität vorgestellt und in beispielhafte Merkmale differenziert. Dann folgt unter Kapitel 3 anhand Annedore Prengels Beitrag zur Heterogenität eine Anerkennung der heterogenen Lerngruppe, betitelt als Chance für jeden, um dann unter Kapitel 4 die Ursachen darzustellen, warum eine SchülerIn schon in der Grundschule zur TäterIn oder zum Opfer werden kann. Kapitel 5 widmet sich der Definition des Mobbing und dessen möglichen Folgen.
Im Kapitel 6 wird vorerst eine Definition der sozialen Kompetenz versucht. Im Kapitel 7 wird die Frage nach dem pädagogischen und eng damit verbunden dem psychologischen Nutzen der Methode gestellt. Das letzte Kapitel fasst in einem Fazit die gewonnenen Erkenntnisse zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Differenzierte Heterogenität
- Heterogenität als Chance für jeden
- Theoretische Einbettung des Phänomens Gewalt an der Schule
- Konstruktivistische und ethnomethodologische Ansätze als verstehende Perspektive: Gewalt als Konstrukt von Definitionsprozessen
- Interaktionistischer Ansatz: Devianz als Produkt schulischer Etikettierungsprozesse
- Stigmatheorie nach Goffman
- Exklusionsrisiko Mobbing
- Definition von Mobbing
- Was unterscheidet Mobbing vom „normalen“ Konflikt?
- Psychische Folgen von Mobbing
- Betrachtung des Mobbing in der Grundschule bezogen auf das Heterogenitätsmerkmal soziale Kompetenz
- No Blame Approach - eine Antimobbingmethode wird vorgestellt
- Warum wurde die No Blame Approach Methode in einer Schwerpunktschule in Berlin-Kreuzberg implementiert?
- Sechs Phasen der Implementierung anhand des Beispiels der Berliner Schwerpunktschule
- Der pädagogische Nutzen des No Blame Approachs
- Der psychologische Nutzen der Methode
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Gewaltphänomen Mobbing in der Grundschule und analysiert, wie das Thema des Moduls „Heterogenität in der Schule“ mit diesem Phänomen zusammenhängt. Die Arbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen, die die Vielfalt von Schüler*innen mit sich bringt und analysiert, wie Mobbing als eine Form von Gewalt die inklusive Entwicklung der Schüler*innen gefährden kann.
- Heterogenität als Chance und Herausforderung in der Schule
- Die Ursachen und Folgen von Mobbing in der Grundschule
- Der No Blame Approach als Antimobbingmethode
- Die pädagogischen und psychologischen Auswirkungen der No Blame Approach Methode
- Die Anwendung der Methode in einer Berliner Schwerpunktschule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Mobbing in der Grundschule und verdeutlicht die Relevanz des Moduls „Heterogenität in der Schule“ für die Thematik. Kapitel 2 beleuchtet die verschiedenen Facetten von Heterogenität in der Schule und die Chancen, die sich aus der Vielfalt der Schüler*innen ergeben. Kapitel 3 thematisiert die pädagogische Bedeutung von Inklusion und die Anerkennung der individuellen Bedürfnisse jedes Kindes.
Kapitel 4 geht auf die theoretische Einbettung des Phänomens Gewalt an der Schule ein und präsentiert den konstruktivistischen und ethnomethodologischen Ansatz, sowie die Stigmatheorie nach Goffman. Kapitel 5 definiert Mobbing und erläutert dessen psychische Folgen. Kapitel 6 betrachtet Mobbing in der Grundschule im Kontext des Heterogenitätsmerkmals soziale Kompetenz.
Kapitel 7 widmet sich der No Blame Approach Methode als Antimobbingmethode. Es werden die Gründe für die Implementierung der Methode in einer Berliner Schwerpunktschule, die sechs Phasen der Implementierung, sowie die pädagogischen und psychologischen Vorteile der Methode diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Heterogenität, Mobbing, Gewalt an der Schule, No Blame Approach, Pädagogik, Psychologie, Inklusion, Exklusion, soziale Kompetenz und Schwerpunktschule. Sie analysiert, wie diese Schlüsselbegriffe im Kontext der Grundschule miteinander in Verbindung stehen und wie sich die Vielfalt der Schüler*innen auf das Phänomen Mobbing auswirkt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „No Blame Approach“?
Es ist eine lösungsorientierte Antimobbingmethode, die ohne Schuldzuweisungen arbeitet. Sie involviert Täter in eine Unterstützergruppe, um das Opfer aus seiner Lage zu befreien.
Warum ist Heterogenität eine Chance im Kontext von Mobbing?
Vielfalt bietet die Möglichkeit, durch Toleranz und Austausch ein breites Perspektivrepertoire zu erwerben, was bei richtiger pädagogischer Anleitung Gewalt vorbeugen kann.
Welche theoretischen Ansätze zur Gewalt werden erläutert?
Die Arbeit nutzt konstruktivistische Ansätze, den interaktionistischen Ansatz (Etikettierung) und die Stigmatheorie nach Goffman, um Gewalt an Schulen zu verstehen.
Was unterscheidet Mobbing von einem normalen Konflikt?
Mobbing zeichnet sich durch permanente, zielgerichtete Angriffe über einen längeren Zeitraum und ein Machtungleichgewicht aus, oft im Verborgenen agierend.
Wo wurde die Methode praktisch implementiert?
Die Arbeit beschreibt die Implementierung in sechs Phasen an einer Schwerpunktschule (Inklusive Schule) in Berlin-Kreuzberg.
Welchen pädagogischen Nutzen hat die Methode?
Sie fördert die soziale Kompetenz und Selbstreflexion der Schüler, beendet die Schikane sofort und verhindert durch die Unterstützergruppe zukünftige Vorfälle.
- Citation du texte
- Rene Tränkner (Auteur), 2017, Antimobbingmethode "No Blame Approach". Pädagogischer Nutzen in einer Schwerpunktschule (Inklusive Schule nach dem Berliner Modell) auf das Heterogenitätsmerkmal soziale Kompetenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377740