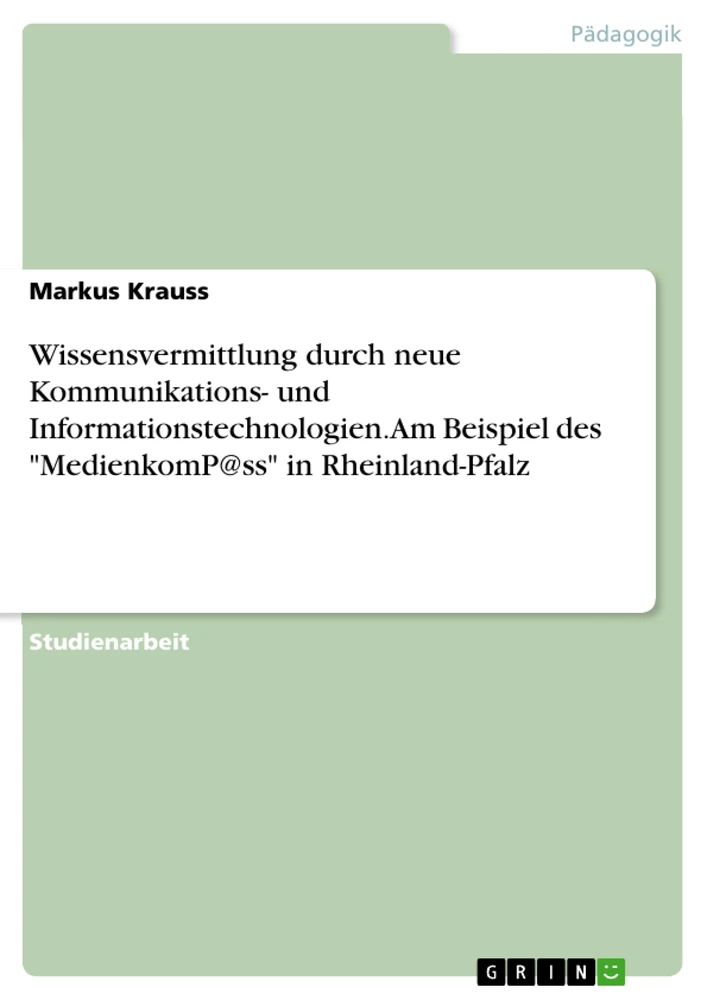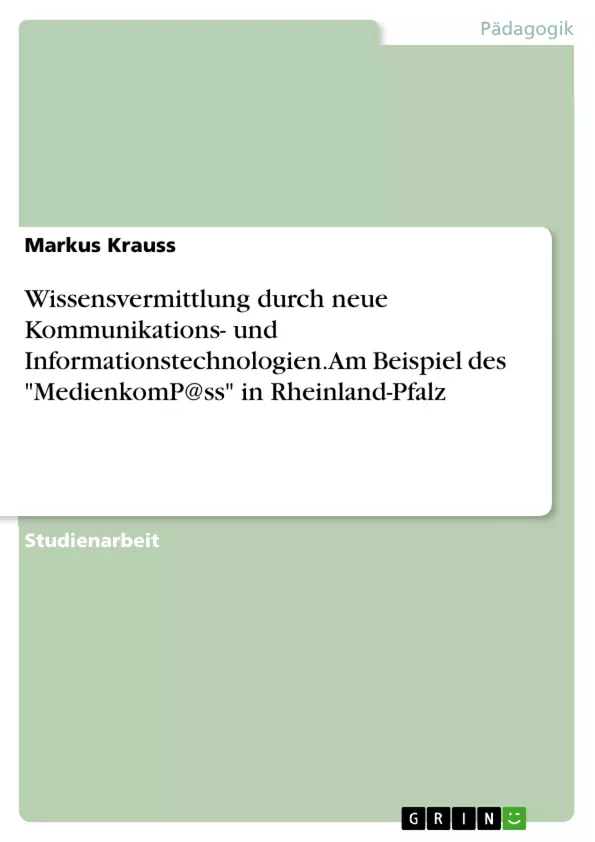Wie können Schulen mit Chancen und Risiken der digitalen Medien umgehen, welche mediendidaktischen Möglichkeiten und Konzepte kommen zur Anwendung? In dieser Arbeit soll im Rahmen dieser Fragestellung auf ein konkretes Projekt des Landes Rheinland-Pfalz eingegangen werden: der "MedienKomp@ss". Hierbei erfüllt der MedienKomp@ss, unter anderem in Form eines Handout für die Schüler, die Funktion eines Kompetenznachweises, vergleichbar mit dem Füller-Führerschein in den ersten Klassen.
Mit der letzten Jahrtausendwende setzte eine rasante Entwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnologie ein. Dies führte zu einer bisher ungeahnten Potenzierung der Kommunikationsmöglichkeiten, zwischen Institutionen, interindividuell sowie zwischen Institutionen und den Individuen, und beschleunigte dadurch wiederum Globalisierungsprozesse. Die Gesellschaft wandelt sich von einer Industrie- zu einer Informationsgesellschaft mit neuen Anforderungen an die heranwachsende Generation. Der Umgang mit digitaler Technologie, genauer: die Kompetenz, die unterschiedlichen Kommunikationsbereiche miteinander in Bezug zu bringen, zu verbinden und zu benutzen (Konvergenz), wird zu einer Schlüsselqualifikation. Vor diesem Hintergrund kommt auch dem Bildungswesen eine entscheidende Rolle zu. Um Schülerinnen und Schüler für diese Entwicklung adäquat vorzubereiten, ist der Erwerb einer umfassenden Medienkompetenz unabdingbar.
Der MedienKomp@ss könnte eine Möglichkeit dafür sein. Um diese genauer einschätzen zu können, wird zunächst das Kompetenz-Standard-Modell für die Medienbildung von Tulodziecki als aktuelle mediendidaktische Theorie vorgestellt. Im Anschluss folgt die Einführung in das aktuelle Projekt des Landes Rheinland-Pfalz zur Förderung der Medienkompetenz der Schüler in der Primar- und Orientierungsstufe (Klassenstufe 1-6). Diesem wird sich genauer gewidmet, und der Forschungsfrage nachgegangen: Wie werden aktuelle mediendidaktische Konzepte und Möglichkeiten im Rahmen des MedienKomp@ss an der Primar- und Sekundarstufe in Rheinland-Pfalz umgesetzt?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Mediendidaktik / Aktuelle Modelle
- 2.1 Lerntheoretische Modelle
- 2.2 Aktuelle mediendidaktische Modelle – das Kompetenz-Standard-Modell für die Medienbildung
- 3 Ist-Zustand der Medienbildung an der Primar- und Sekundarstufe in Rheinland-Pfalz
- 3.1 Informatik
- 3.2 Der Medienkompass
- 4 Vergleich mediendidaktischer Theorien mit dem Medienkompass
- 4.1 Bedienen und Anwenden
- 4.2 Informieren und Recherchieren
- 4.3 Kommunizieren und Kooperieren
- 4.4 Produzieren und Präsentieren
- 4.5 Analysieren und Reflektieren
- 4.6 Beantwortung der Forschungsfrage
- 5 Vorschläge für eine lebensweltbezogene Medienbildung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Umsetzung aktueller mediendidaktischer Konzepte im Rahmen des „MedienKomp@ss“ in Rheinland-Pfalz an Primar- und Sekundarstufe. Sie analysiert den Ist-Zustand der Medienbildung und vergleicht ihn mit bestehenden Theorien. Die Arbeit zielt darauf ab, die Praxistauglichkeit des MedienKomp@ss zu bewerten und Vorschläge für eine verbesserte, lebensweltbezogene Medienbildung zu entwickeln.
- Analyse des Ist-Zustands der Medienbildung in Rheinland-Pfalz
- Bewertung des „MedienKomp@ss“ als Instrument der Medienbildung
- Vergleich des MedienKomp@ss mit aktuellen mediendidaktischen Theorien
- Herausforderungen und Chancen der digitalen Medien im Bildungskontext
- Vorschläge für eine verbesserte, lebensweltbezogene Medienbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den rasanten technologischen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen für das Bildungssystem. Sie hebt die Bedeutung von Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation hervor und benennt die Chancen und Risiken des Umgangs mit digitalen Medien. Die Arbeit fokussiert auf den „MedienKomp@ss“ in Rheinland-Pfalz und formuliert die Forschungsfrage: Wie werden aktuelle mediendidaktische Konzepte und Möglichkeiten im Rahmen des „MedienKomp@ss“ an der Primar- und Sekundarstufe in Rheinland-Pfalz umgesetzt?
2 Mediendidaktik / Aktuelle Modelle: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Mediendidaktik in Deutschland und stellt exemplarisch aktuelle mediendidaktische Konzepte und Theorien vor. Es beleuchtet den Einfluss behavioristischer und kognitionstheoretischer Ansätze auf die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen mit Medien und zeigt die Notwendigkeit der Anpassung an den technologischen Fortschritt auf. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Mediendidaktik und ihrer Reaktion auf technologische und lernpsychologische Veränderungen.
3 Ist-Zustand der Medienbildung an der Primar- und Sekundarstufe in Rheinland-Pfalz: Dieses Kapitel beschreibt den Ist-Zustand der Medienbildung in Rheinland-Pfalz, insbesondere den Informatikunterricht an der Sekundarstufe und das Konzept des „MedienKomp@ss“. Es analysiert den aktuellen Stand der Medienbildung im Kontext des rheinland-pfälzischen Bildungssystems und führt den „MedienKomp@ss“ als zentrales Element der Untersuchung ein. Das Kapitel beleuchtet sowohl die vorhandenen Strukturen als auch das Konzept des MedienKomp@ss als Instrument zur Förderung von Medienkompetenz.
4 Vergleich mediendidaktischer Theorien mit dem Medienkompass: Kapitel vier analysiert den „MedienKomp@ss“ anhand der zuvor vorgestellten mediendidaktischen Theorien und Modelle. Es untersucht, inwieweit die im MedienKomp@ss vermittelten Kompetenzen (Bedienen und Anwenden, Informieren und Recherchieren, Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren und Präsentieren, Analysieren und Reflektieren) den theoretischen Ansätzen entsprechen. Die Analyse ermöglicht es, die Stärken und Schwächen des „MedienKomp@ss“ im Hinblick auf seine mediendidaktischen Grundlagen zu beurteilen und die Forschungsfrage zu beantworten.
5 Vorschläge für eine lebensweltbezogene Medienbildung: Dieses Kapitel enthält Vorschläge zur Verbesserung der Medienbildung, fokussiert auf eine lebensweltbezogene Ausrichtung. Es baut auf den vorherigen Kapiteln auf und schlägt konkrete Maßnahmen zur Optimierung des „MedienKomp@ss“ und der gesamten Medienbildung vor. Die Vorschläge berücksichtigen die Ergebnisse der bisherigen Analyse und zielen auf eine praxisnahe und nachhaltige Förderung der Medienkompetenz.
Schlüsselwörter
Medienkompetenz, Mediendidaktik, MedienKomp@ss, Rheinland-Pfalz, digitale Medien, Informationsgesellschaft, Medienbildung, Lernmodelle, Kompetenzentwicklung, Lebensweltorientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Umsetzung mediendidaktischer Konzepte im Rahmen des „MedienKomp@ss“ in Rheinland-Pfalz
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Umsetzung aktueller mediendidaktischer Konzepte im Rahmen des „MedienKomp@ss“ in Rheinland-Pfalz an Primar- und Sekundarstufen. Sie analysiert den Ist-Zustand der Medienbildung und vergleicht ihn mit bestehenden Theorien, um die Praxistauglichkeit des MedienKomp@ss zu bewerten und Vorschläge für eine verbesserte, lebensweltbezogene Medienbildung zu entwickeln.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse des Ist-Zustands der Medienbildung in Rheinland-Pfalz, die Bewertung des „MedienKomp@ss“, den Vergleich des MedienKomp@ss mit aktuellen mediendidaktischen Theorien, die Herausforderungen und Chancen digitaler Medien im Bildungskontext und Vorschläge für eine verbesserte, lebensweltbezogene Medienbildung.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel plus Einleitung und Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und formuliert die Forschungsfrage. Kapitel 2 gibt einen Überblick über aktuelle mediendidaktische Modelle. Kapitel 3 beschreibt den Ist-Zustand der Medienbildung in Rheinland-Pfalz, insbesondere den „MedienKomp@ss“. Kapitel 4 vergleicht den „MedienKomp@ss“ mit den vorgestellten Theorien. Kapitel 5 enthält Vorschläge für eine lebensweltbezogene Medienbildung.
Welche mediendidaktischen Modelle werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene aktuelle mediendidaktische Modelle und Theorien, darunter lerntheoretische Modelle und das Kompetenz-Standard-Modell für die Medienbildung. Der Einfluss behavioristischer und kognitionstheoretischer Ansätze auf die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen mit Medien wird beleuchtet.
Wie wird der „MedienKomp@ss“ in der Arbeit analysiert?
Der „MedienKomp@ss“ wird anhand der vorgestellten mediendidaktischen Theorien und Modelle analysiert. Die Arbeit untersucht, inwieweit die im MedienKomp@ss vermittelten Kompetenzen (Bedienen und Anwenden, Informieren und Recherchieren, Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren und Präsentieren, Analysieren und Reflektieren) den theoretischen Ansätzen entsprechen und bewertet Stärken und Schwächen.
Welche konkreten Vorschläge für eine verbesserte Medienbildung werden gemacht?
Die Arbeit enthält konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Medienbildung mit Fokus auf eine lebensweltbezogene Ausrichtung. Diese Vorschläge bauen auf den vorherigen Kapiteln auf und schlagen Maßnahmen zur Optimierung des „MedienKomp@ss“ und der gesamten Medienbildung vor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Medienkompetenz, Mediendidaktik, MedienKomp@ss, Rheinland-Pfalz, digitale Medien, Informationsgesellschaft, Medienbildung, Lernmodelle, Kompetenzentwicklung, Lebensweltorientierung.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit beantwortet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie werden aktuelle mediendidaktische Konzepte und Möglichkeiten im Rahmen des „MedienKomp@ss“ an der Primar- und Sekundarstufe in Rheinland-Pfalz umgesetzt?
- Quote paper
- Markus Krauss (Author), 2014, Wissensvermittlung durch neue Kommunikations- und Informationstechnologien. Am Beispiel des "MedienkomP@ss" in Rheinland-Pfalz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377745