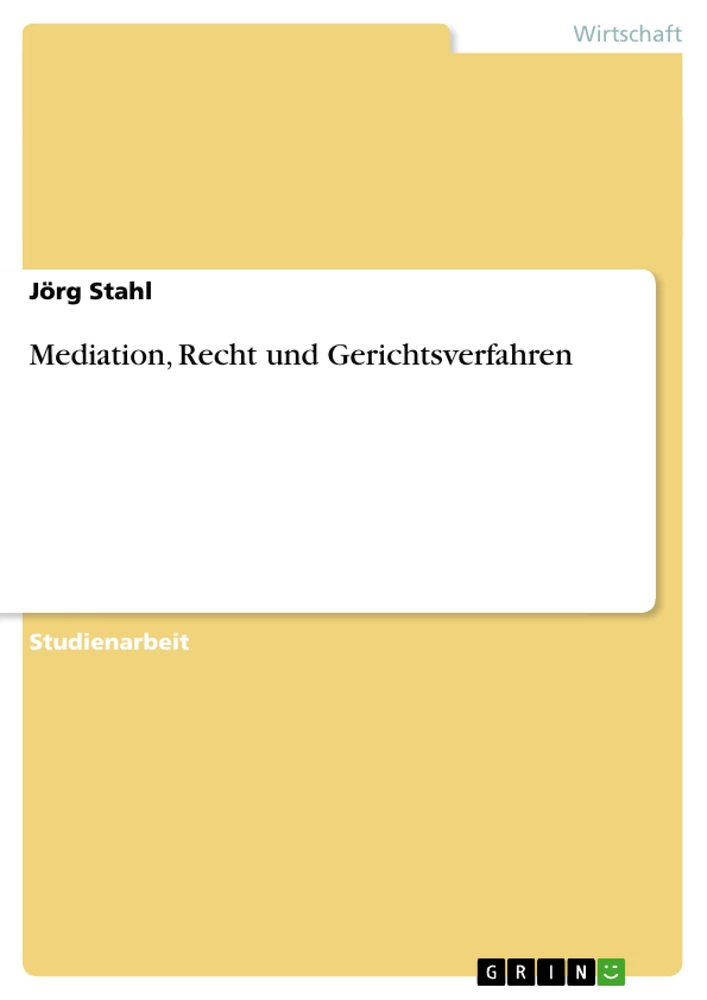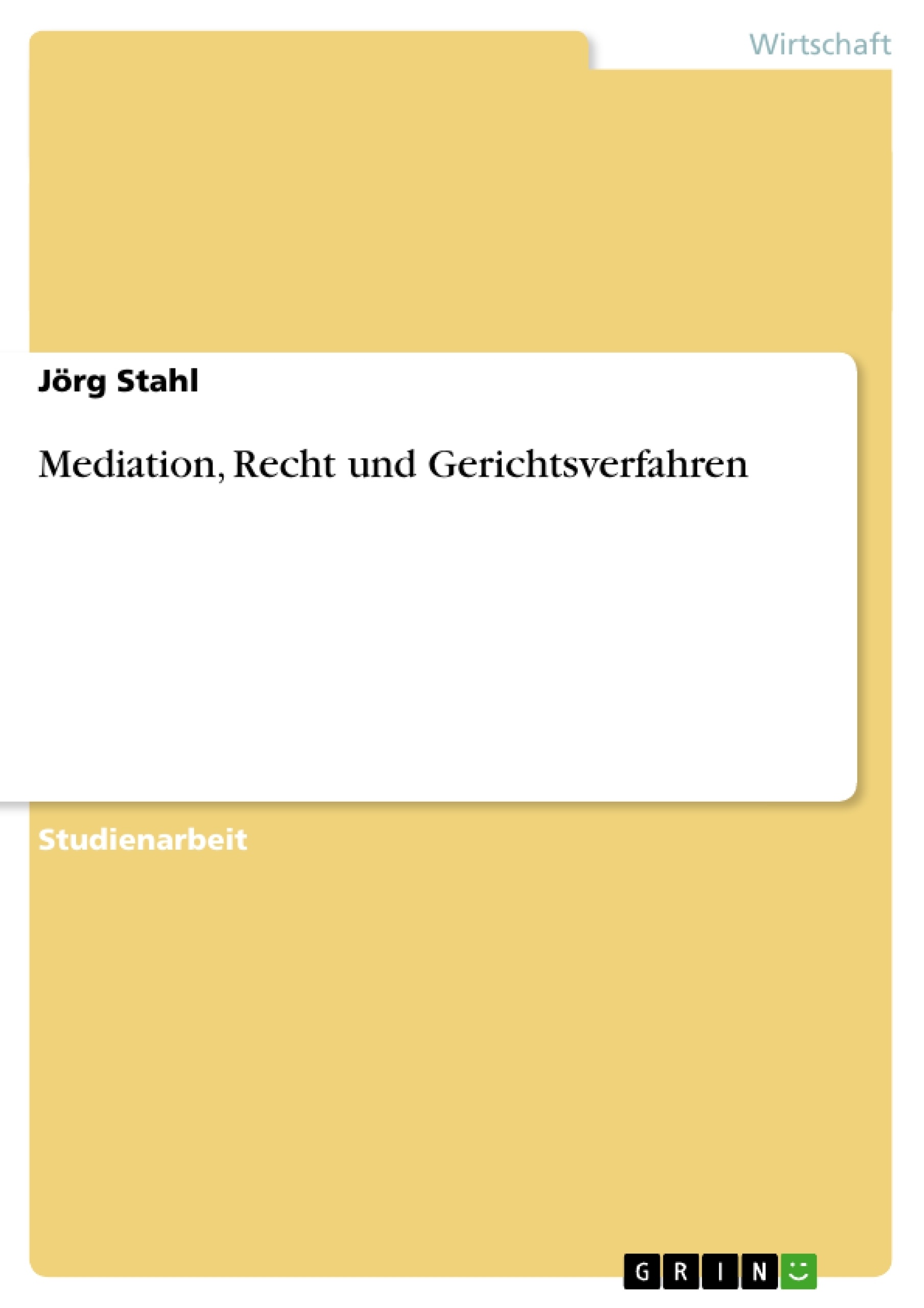Konflikte existieren solange wie die Menschheit selbst. Ohne zu verkennen, dass
Konflikte auch positive Funktionen erfüllen, bedarf es der Konfliktlösung, worunter in
der Literatur auch Möglichkeiten wie Flucht, Vernichtung des Gegners oder
Unterordnung einer Konfliktpartei subsummiert werden.1 Innerhalb eines Rechtsstaates
ist es jedoch Voraussetzung und Ziel einer Gesellschaft, die Interessen aller Menschen
zu wahren. Konfliktlösungen und Konfliktlösungssysteme sind daher in einer
Gesellschaft auch zu bewerten und gegebenenfalls abzulehnen. In der Vergangenheit
hat der Rechtsstaat versucht, immer mehr Konflikte zwischen den Menschen durch die
Schaffung von Normen und Gesetzen zu regeln. Die mit der alleinigen Anwendung von
Gerichtsverfahren zur Durchsetzung objektiven Rechts verbundenen systemimmanenten
Schwächen, wie mangelnde Selbstbestimmtheit der Akteure, hohe Verfahrenskosten
und mangelnde Einzelfallgerechtigkeit bzw. Flexibilität, bedingten die Entwicklung
sogenannter Alternative Dispute Resolution - Ansätze. Ziel dieser außergerichtlichen
Konfliktlösungsverfahren ist eine win-win-Lösung für alle Konfliktparteien auf
freiwilliger Basis, um ein für alle Parteien besseres Ergebnis zu erzielen als dies ein
Gerichtsverfahren erreichen könnte. Ohne die Notwendigkeit von Recht und Gesetz in
Frage zu stellen, erinnerte Sander in seinem Vortrag „Varieties of Dispute Processing“2
daran, dass der Weg zum Gericht zwar ein wichtiger, aber eben nur ein Weg zur
Konfliktbehandlung neben alternativen Formen außergerichtlicher Konfliktlösung wie
Mediation, Negotiation und Arbitration ist. Studiert man die aktuelle Literatur zum
Thema Konfliktmanagement, so ist eine signifikante Häufung von Artikeln und
Büchern zum Thema Mediation in den letzten Jahren festzustellen.
Diese Seminararbeit soll nach Klärung und Einordnung wichtiger Begrifflichkeiten
einen Vergleich zwischen dem klassischen Gerichtsverfahren und dem Verfahren der
Mediation aufzeigen. Zudem soll die Frage geklärt werden, in welchem Verhältnis
Mediation und gesetztes Recht zueinander stehen. Ist Mediation tatsächlich eine
Alternative zum Rechtsweg, ergänzen sich beide Verfahren vielleicht, oder ist das Recht
möglicherweise Voraussetzung für den Erfolg von Mediation. Ferner sollen
Anwendungsgebiete des Rechts in der Mediation herausgearbeitet werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konflikte und Mediation
- 2.1. Definition des sozialen Konflikts
- 2.2. Konfliktlösungsansätze nach Ury, Brett und Goldberg
- 2.3. Mediation und Gerichtsverfahren im Eskalationsmodell nach Glasl
- 2.4. Mediation
- 3. Vergleich: Mediation vs. Gerichtsverfahren
- 3.1. Freiwilligkeit vs. Zwang
- 3.2. Prozessverantwortung vs. Ergebnisverantwortung
- 3.3. Neutralität vs. Parteilichkeit
- 3.4. Interessen vs. Positionen
- 3.5. Kreativität vs. Anspruchsdenken
- 3.6. Zukunftsorientierung vs. Vergangenheitsorientierung
- 3.7. Zeit und Kosten
- 4. Die Rolle des Rechts in der Mediation
- 4.1. Verfassungsrechtliche Grundlage der Mediation
- 4.2. Recht als Verfahrenssicherung durch einen Mediationsvertrag
- 4.3. Das Recht bei der Suche nach Mediationsergebnissen
- 4.3.1. Das Recht als Zulässigkeitsgrenze und Machtkontrolle
- 4.3.2. Rechtliche Konfliktlösung als Entscheidungsgrundlage
- 4.3.3. Gesetzliche Wertungen als Hilfe bei der Lösungssuche
- 4.3.4. Das Recht als vereinbarter Entscheidungsmaßstab
- 4.4. Umsetzung und Durchsetzbarkeit der Mediationsergebnisse
- 5. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Vergleich von Mediation und Gerichtsverfahren als Konfliktlösungsmöglichkeiten. Dabei wird die Rolle des Rechts in der Mediation beleuchtet und untersucht, ob Mediation eine Alternative zum Rechtsweg darstellt, beide Verfahren sich ergänzen oder ob das Recht eine Voraussetzung für den Erfolg von Mediation ist. Darüber hinaus werden Anwendungsgebiete des Rechts in der Mediation herausgearbeitet.
- Die verschiedenen Ansätze zur Konfliktlösung
- Der Vergleich von Mediation und Gerichtsverfahren in Bezug auf Freiwilligkeit, Verantwortung, Neutralität, Interessen und Kosten
- Die Rolle des Rechts in der Mediation
- Die Anwendungsgebiete des Rechts in der Mediation
- Die Umsetzung und Durchsetzbarkeit von Mediationsergebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Konfliktlösung und Mediation ein und stellt die Bedeutung dieser Themen für die Gesellschaft dar. Es wird die Notwendigkeit von Konfliktlösungssystemen im Rechtsstaat betont und die Entwicklung alternativer Konfliktlösungsverfahren wie Mediation, Negotiation und Arbitration erläutert.
Kapitel 2: Konflikte und Mediation
Dieses Kapitel definiert den sozialen Konflikt nach Glasl und erläutert die Konfliktlösungsansätze von Ury, Brett und Goldberg. Es werden die drei Elemente Macht, Recht und Interessen in der Konfliktlösung vorgestellt und die Bedeutung interessenbasierter Strategien hervorgehoben.
Kapitel 3: Vergleich: Mediation vs. Gerichtsverfahren
In diesem Kapitel werden Mediation und Gerichtsverfahren in Bezug auf verschiedene Kriterien wie Freiwilligkeit, Verantwortung, Neutralität, Interessen, Kreativität, Zeit und Kosten verglichen. Dabei werden die spezifischen Charakteristika beider Verfahren und die Vor- und Nachteile im Vergleich aufgezeigt.
Kapitel 4: Die Rolle des Rechts in der Mediation
Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Rechts in der Mediation. Es werden die verfassungsrechtliche Grundlage der Mediation, die Bedeutung des Rechts als Verfahrenssicherung durch einen Mediationsvertrag und die verschiedenen Aspekte des Rechts bei der Suche nach Mediationsergebnissen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Mediation, Konfliktlösung, Gerichtsverfahren, Recht, Interessen, Freiwilligkeit, Verantwortung, Neutralität, Kreativität, Zeit und Kosten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Mediation und einem Gerichtsverfahren?
Mediation basiert auf Freiwilligkeit, Eigenverantwortung und interessenbasierter Lösungssuche, während ein Gerichtsverfahren durch Zwang, Fremdbestimmung und die Anwendung objektiven Rechts geprägt ist.
Welche Rolle spielt das Recht in einem Mediationsverfahren?
Das Recht dient als Rahmen (Mediationsvertrag), als Zulässigkeitsgrenze für Vereinbarungen und kann als Orientierungshilfe bei der Lösungssuche genutzt werden.
Ist Mediation eine echte Alternative zum Rechtsweg?
Ja, sie wird oft als „Alternative Dispute Resolution“ (ADR) bezeichnet, die darauf abzielt, Win-Win-Lösungen zu finden, die flexibler und kostengünstiger als Gerichtsurteile sein können.
Wie werden Mediationsergebnisse rechtlich durchgesetzt?
Die Arbeit beleuchtet die Möglichkeiten der Umsetzung und Durchsetzbarkeit, etwa durch privatrechtliche Verträge oder notarielle Unterwerfungserklärungen.
Was ist das Eskalationsmodell nach Glasl?
Es beschreibt die Stufen der Konfliktverschärfung und hilft zu entscheiden, ob eine Mediation noch möglich ist oder ein macht- bzw. rechtsbasiertes Verfahren (Gericht) notwendig wird.
- Citar trabajo
- Jörg Stahl (Autor), 2005, Mediation, Recht und Gerichtsverfahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37774