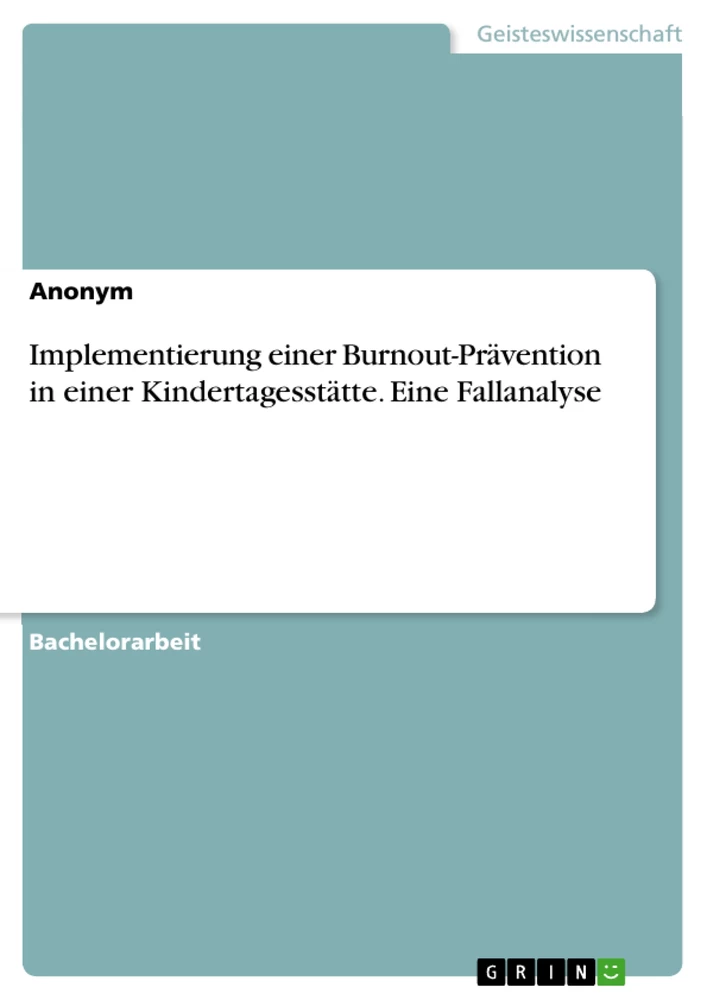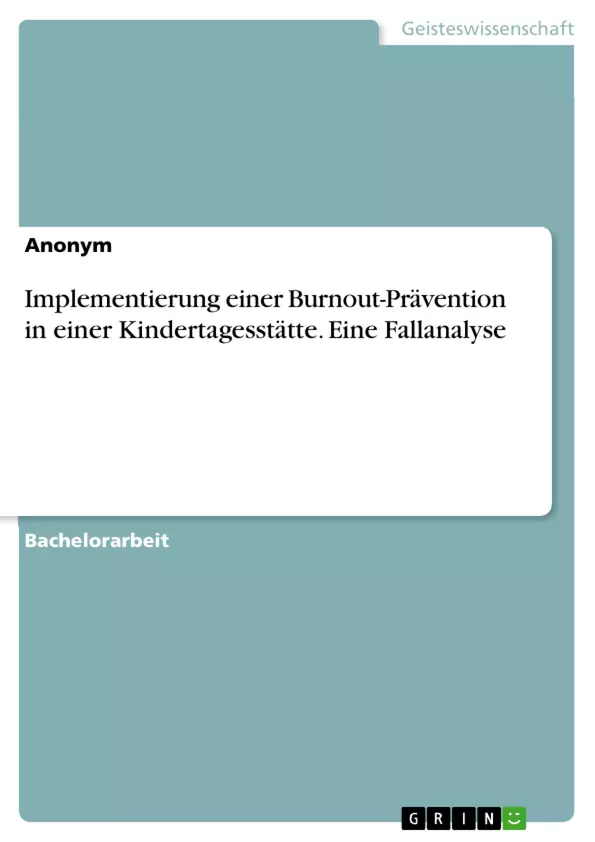Vor dem Hintergrund der steigenden Burnout-Erkrankungen soll im Rahmen dieser Arbeit die Frage gestellt werden, wie eine Burnout-Prävention für Kindertagesstätten geplant und umgesetzt werden kann. Um sich der Beantwortung dieser Frage zu nähern wird eine Fallstudie vorgestellt, in der eine Burnout-Prävention in einer Kindertagesstätte implementiert und evaluiert wurde.
Immer häufiger leiden Menschen in unserer Gesellschaft am Burnout-Syndrom. Besonders häufig sind Personen aus dem sozialen Bereich betroffen. Dies gilt auch für Pädagogen in Kindertagesstätten. Mit der Einführung des Berliner Bildungsprogrammes und der externen Evaluation der pädagogisch inhaltlichen Arbeit in Kindertageseinrichtungen, stiegen die Anforderungen an alle Mitarbeiter. Besonders ungewohnt waren für die Erzieher die schriftliche Dokumentation zu Beobachtungen von Kindern, Projektplanungen und das Führen des Sprachlerntagebuches für jedes Kind. Das Überwinden der Sprachbarriere für eine gute Zusammenarbeit mit vielen Familien nicht deutscher Herkunft stellte eine zusätzliche Herausforderung dar. Trotz eindeutiger Krankheitssymptome wie z.B. Rückenbeschwerden, Erkältung mit Fieber konnte beobachtet werden, dass Pädagogen nicht zum Arzt gingen. Die Selbstfürsorge wurde vernachlässigt.
Um den theoretischen Hintergrund zur Fallstudie zu erläutern, werden im ersten Teil der Bachelorarbeit die Bedeutung, Herkunft und Ursachen für das Burnout-Syndrom erklärt. Ebenso wird der Frage nachgegangen, warum besonders häufig Menschen aus helfenden Berufsgruppen am Burnout-Syndrom erkranken. Welche Motive bewegen Individuen dazu, den Beruf des Erziehers oder Sozialpädagogen zu ergreifen? Wie sind die Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten gestaltet? Theoretische Vorüberlegungen zur Planung einer Burnout-Prävention unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse von Antonovsky und Benner werden aufgezeigt. In der konkreten Falldarstellung werden die Kindertagesstätte und der Träger vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung in die vorliegende Bachelorarbeit.
- 1.1 Bedeutung und Zielsetzung der Arbeit.
- 2. Burnout- Herkunft und Bedeutung des Begriffs.
- 2.1 Begriffserklärung und perspektivische Betrachtungen zu möglichen Auslösern des Burnout-Syndroms.
- 2.2 Phasen der Entstehung des Burnout-Syndroms.
- 3. Situation in sozialen Organisationen.
- 3.1 Besonders Burnout prädestinierte Berufsgruppen.
- 3.2 Problembeschreibung nach dem Riemann- Thomann Modell.
- 3.3 Die Kommunikationsstile nach Schulz von Thun.
- 4. Planung des Burnoutpräventionsprojektes.
- 4.1 Falldarstellung.
- 4.2 Vorstellung des Trägers, der Einrichtung und des Teams.
- 5. Vorstellung des Präventionsprojektes aus theoretischer Sicht.
- 5.1 Begründungen der Salutogenese von Aaron Antonovsky.
- 5.2 Der positive Umgang mit Stress nach dem Ansatz von Patricia Benner.
- 5.3 Resümees der theoretischen Betrachtungen.
- 6. Planung der praktischen Umsetzung des Projektes.
- 6.1 Methodische Vorgehensweise.
- 6.2 Auswertung des Fragebogens- Erstellung einer Analyse des IST-Zustandes.
- 6.3 Implementierung des Burnout- Präventionsprojektes.
- 6.3.1 Vertragliche Gestaltung der Projektvereinbarung zur Burnout- Prävention.
- 7. Prozessbeschreibung der Umsetzung des Projektes in der Kindertagesstätte mit anschließender Reflexion.
- 7.1 Prozessbeschreibung.
- 7.2 Zeitliche und räumliche Bedingungen, Lernwiderstände.
- 8. Evaluation.
- 8.1 Ergebnisse der Zwischenevaluation.
- 8.2 Ergebnisse der Abschlussevaluation.
- 9. Fazit der Implementierung des Burnoutpräventionsprojektes.
- 9.1 Analyse und gewonnene Erkentnisse.
- 9.2 Empfehlungen für die Umsetzung in anderen Einrichtungen.
- 10. Belegung der Thesen.
- 11. Zusammenfassung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Implementierung einer Burnout-Prävention in einer Kindertagesstätte. Die Arbeit analysiert die Entstehung und Ausprägung des Burnout-Syndroms, insbesondere im Kontext der sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die besondere Belastung von pädagogischen Fachkräften in Kindertagesstätten und untersucht, wie ein individuelles Präventionsprogramm effektiv geplant und umgesetzt werden kann.
- Analyse des Burnout-Syndroms und seiner Entstehungsphasen.
- Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten.
- Konzeption und Implementierung eines Burnout-Präventionsprogramms.
- Praktische Umsetzung des Programms in einer konkreten Einrichtung.
- Evaluation der Wirksamkeit des Präventionsprogramms.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Burnout-Prävention im Kontext der sozialen Arbeit und insbesondere in Kindertagesstätten beleuchtet. Kapitel 2 führt in das Burnout-Syndrom ein, erläutert seine Entstehung und definiert die wichtigsten Symptome. Kapitel 3 analysiert die Herausforderungen und Belastungsfaktoren, denen pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten ausgesetzt sind. In Kapitel 4 wird die konkrete Fallstudie vorgestellt und die Planung des Burnout-Präventionsprojekts detailliert beschrieben. Kapitel 5 stellt die theoretischen Grundlagen des Projekts dar, die auf der Salutogenese nach Antonovsky und dem Ansatz von Patricia Benner beruhen. In Kapitel 6 wird die praktische Umsetzung des Präventionsprojekts geplant und die methodische Vorgehensweise sowie die Auswertung des Fragebogens beschrieben. Kapitel 7 schildert den Prozess der Implementierung des Projekts in der Kindertagesstätte und beleuchtet die auftretenden Herausforderungen und Erfahrungen. Kapitel 8 befasst sich mit der Evaluation des Projekts, die sowohl eine Zwischen- als auch eine Abschlussevaluation umfasst. Abschließend fasst Kapitel 9 die gewonnenen Erkenntnisse aus der Implementierung des Burnout-Präventionsprojekts zusammen und formuliert Empfehlungen für die Übertragbarkeit in andere Einrichtungen.
Schlüsselwörter
Burnout-Prävention, Kindertagesstätte, Soziale Arbeit, Pädagogische Fachkräfte, Salutogenese, Stressmanagement, Projektplanung, Implementierung, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Erzieher besonders anfällig für Burnout?
Hohe Dokumentationspflichten, Sprachbarrieren in der Zusammenarbeit mit Familien und eine oft vernachlässigte Selbstfürsorge trotz körperlicher Symptome führen zu einer hohen Belastung in sozialen Berufen.
Welche theoretischen Modelle werden für die Burnout-Prävention genutzt?
Die Arbeit stützt sich auf die Salutogenese von Aaron Antonovsky und den Ansatz zum positiven Umgang mit Stress von Patricia Benner.
Wie wurde das Präventionsprojekt in der Kindertagesstätte implementiert?
Nach einer IST-Analyse mittels Fragebögen wurde eine vertragliche Projektvereinbarung geschlossen und das Team über einen längeren Zeitraum begleitet und evaluiert.
Welche Rolle spielt die Kommunikation bei der Burnout-Entstehung?
Die Arbeit nutzt das Riemann-Thomann-Modell und die Kommunikationsstile nach Schulz von Thun, um Konfliktpotenziale im Team und in der Organisation zu beschreiben.
Was ergab die Evaluation des Projekts?
Die Arbeit dokumentiert die Ergebnisse einer Zwischen- und Abschlussevaluation und gibt Empfehlungen für die Übertragbarkeit auf andere soziale Einrichtungen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Implementierung einer Burnout-Prävention in einer Kindertagesstätte. Eine Fallanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377785